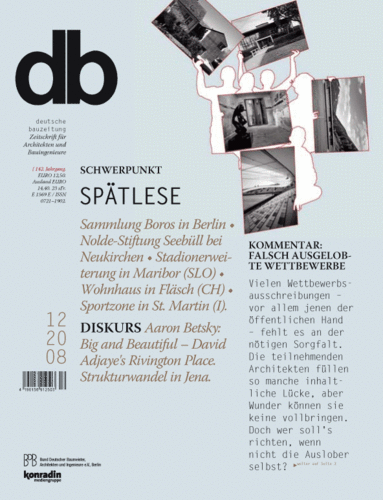Editorial
Zu den schwierigeren Aufgaben von Architekturredaktionen gehört es – neben der Konzeption relevanter, aktueller und das Architekturgeschehen widerspiegelnder Themenhefte –, aus der großen Zahl guter Bauten eine Auswahl zu treffen, die dann in der jeweiligen Ausgabe ausführlich präsentiert wird. Und manches Mal bleibt ein Tropfen Wehmut zurück, wenn in der Redaktionskonferenz entschieden werden muss, dass ein Bauwerk, das gestalterisch und in seiner Detaillierung überzeugt, nicht berücksichtigt werden kann. Was bleibt, ist die Erinnerung an ein fabelhaftes Gebäude.
In der Dezember-Ausgabe stellen wir Bauten vor, die – bisweilen unspektakulär, eigenwillig, von der Begeisterung ihrer Architekten über viele Hindernisse hinweggetragen, mit größter Sorgfalt geplant – nach unserer Meinung einen größeren Rahmen verdient haben.
Jeder von uns hat dabei seine sehr individuelle Wahl getroffen und sich vor Ort noch einmal mit dem Gebäude auseinandergesetzt, die eigene Begeisterung hinterfragt – und das Besondere einzufangen versucht. red
Inhalt
Diskurs
03 Kommentar
Sind im Wettbewerbswesen allein die Architekten in der Pflicht? | Christian Marquart
06 Magazin
12 On European Architecture
David Adjaye's Rivington Place | Aaron Betsky
14 Im Blickpunkt
Jena: gelungener Strukturwandel | Matthias Grünzig
Schwerpunkt
18 Spätlese
20 Neuordnung der Nolde-Stiftung Seebüll von Walter Rolfes Architekten | Ulrike Kunkel
28 Wohnhaus und Sammlung Boros in Berlin von Realarchitektur | Christine Fritzenwallner
36 Wohngebäude in Fläsch (CH) von atelier-f | Rolf Mauer
44 Stadionerweiterung in Maribor (SLO) von OFIS arhitekti | Achim Geissinger
52 Servicegebäude Sportzone in St. Martin (I) von Stifter Bachmann | Elisabeth Plessen
Empfehlungen
62 Kalender
62 Ausstellung
William Lindley (Hamburg) | Christiane Fülscher
64 Neu in …
Rothrist (CH) | Caspar Schärer
Stralsund | Stefan Pangritz
Zürich (CH) | Sabine Wolf
66 Bücher
Trends
68 Energie
Wissenschaftszentrum in Kiel
AC Architektencontor Agather | Scheel, Claas Gefroi
74 Technik aktuell
WDVS-Beschichtungen ohne Biozide | Achim Pilz
Produkte
78 Produktberichte
Fassadentechnik, Befestigungen | rm
90 Software
Neues vom Softwaremarkt | cf
94 Schaufenster | rm
Bauen mit Glas
Anhang
98 Planer / Autoren
99 Bildnachweis
100 Vorschau / Impressum
Detailbogen
101 Berlin: Wohnhaus und Sammlung Boros
104 St. Martin (I): Servicegebäude Sportzone
106 Fläsch (CH): Wohngebäude
Gegenüberstellung
Vor Jahren schied der Schweizer Architekt Kurt Hauenstein aus einer Zürcher Büropartnerschaft aus, um in Fläsch ein neues Büro zu eröffnen. Seine spezielle Ortskenntnis und die Erfahrung, die er sich mit zahlreichen Bauten und Sanierungen in Fläsch und im Kanton Graubünden aneignete, führten für sein eigenes Wohnhaus zu einem Entwurf, der in bäuerlicher Lebenskultur gründet und dörfliches Leben neu interpretiert. Hauenstein stellte einem alten Weinbauernhaus einen bewusst einfach gehaltenen, schroffen Betonkubus gegenüber, der sich überzeugend in Ort und Alpenlandschaft fügt.
Im größten Schweizer Kanton Graubünden ist der Rhein nur ein knietiefes Rinnsal. Erst der Zufluss von Schmelzwasser im Frühjahr vermittelt eine Ahnung, zu welcher Größe der Fluss auf seinem Weg in die Nordsee noch anschwillt. »Bündner Herrschaft« wird der Teil des Kantons Graubünden genannt, in dem das Dorf Fläsch liegt. Der Name geht zurück auf eine Zeit, als der Kreis als Freistaatskonstrukt von drei Schweizer Bünden politisch verwaltet wurde.
Fläsch mit seinen knapp 600 Einwohnern liegt im nördlichsten Teil der »Bündner Herrschaft« am Fuß des Fläscherberges. Seit dem 9. Jahrhundert wird hier Wein angebaut. 16 Weinbaubetriebe bewirtschaften heute 48 Hektar Rebland. Aus ihrer Mitte kommt der »Winzer des Jahres 2008«, Daniel Gantenbein, dessen Weingut anlässlich des Balthasar-Neumann-Preises 2008 mit einer Anerkennung ausgezeichnet wurde (siehe db 6/2008).
Fläsch ist im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) aufgeführt. Die Gemeinde will die Weinlagen, die teilweise im Ort liegen, erhalten und vor einer Überbauung schützen. Nach einem Entwurf der Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur wurden ein Neugestaltungskonzept und ein neues Baugesetz vorgeschlagen, um im Dorfkern gelegene Weinlagen, die als Bauland (Kerngebiet) ausgewiesen wurden, zugunsten der weiteren landwirtschaftlichen Nutzung zu schützen. Angesichts der hohen Grundstückspreise wurde diese Maßnahme und die beabsichtigten Entschädigungen der Grundstücksbesitzer nicht ohne begleitende Neiddebatte geführt. Nach einer ersten Ablehnung in der Gemeindeversammlung im Jahr 2007 konnte die neuen Verordnungen erst Anfang November 2008 beschlossen werden. In diesem Umfeld erwarben der Architekt Kurt Hauenstein und seine Frau Marilies Düsterhaus, die vor zehn Jahren aus Zürich nach Fläsch gezogen waren, ein Grundstück in Randlage; mit einem Gebäudebestand aus einer Zeit, in der die Bündner Herrschaft noch bestand. Das vermutlich Anfang des 18. Jahrhunderts erbaute Bauernhaus wurde von Hauenstein von Grund auf saniert und der ursprüngliche Grundriss mit dem engen und steilen Treppenhaus und den beiden flankierenden Räumen wiederhergestellt.
Die Ausweisung des Grundstücks als bauliches »Kerngebiet« hätte auch einen Komplettabriss mit einem mehrgeschossigen Neubau ermöglicht. Hauenstein entschied sich aber für den Bestand und ersetzte nur die angebaute ehemalige Scheune durch einen Neubau.
Den massiven Wänden des Altbaus hat der Architekt die 50 cm dicken Wände des Neubaus mit einem Gesamtaufbau aus einer innen liegenden 11 cm dicken Fichtenschalung einschließlich Unterkonstruktion mit 14 cm Dämmung und 25 cm Sichtbeton gegenübergestellt. Der eingefärbte Ortbeton der Außenwand wurde abschließend zusätzlich anthrazit hydrophobiert und zitiert nicht nur die dunkel verwitterten Fassaden alter Scheunen, sondern auch die hinter dem Ort aufgehende schwarze Steilwand des Fläscherberges. Die Lochfassade des Neubaus hat ihre Entsprechung in den kleinteiligen Fenstern des alten Wohngebäudes. Die Fenster wurden so in die Kubatur gefügt, dass aus den nahe stehenden Nachbargebäuden kein Einblick möglich ist und jedes der Fenster einen genau komponierten Ausblick in die beeindruckende Kulisse der Schweizer Alpen ermöglicht.
Auf einem als Garage genutzten Sockelgeschoss stehend, sind die beiden Wohngeschosse nur andeutungsweise unterteilt und bilden über die gemeinsame Galerie einen großen Wohnraum, der im Obergeschoss von einem zentralen Kamin dominiert wird. Nebenräume wie Bäder, Toiletten und Aufzugsschacht sind im Zwischenbau untergebracht. Auch hier sind die Räume durch überraschende Ausblicke geprägt; so ist durch das gläserne Dach des oberen Bads eine Sichtbeziehung auf den nahen Berg gegeben. Auch wenn die vorhandene, abenteuerlich steile Treppe des Altbaus nicht modernem Komfortempfinden entspricht, wurde zugunsten eines Aufzuges auf ein weiteres Treppenhaus verzichtet. Zwar läuft der Bauherr diese Treppenanlage mittlerweile leichtfüßig herunter, der Besucher fühlt sich jedoch an einen bergsteigerischen Abstieg erinnert.
Bewusst lebt das Paar mit den Widersprüchen zwischen Alt und Neu. Der Bestand hätte nicht hinreichend gedämmt werden können, ohne dem Bau seinen Charakter zu nehmen. Auf eine thermische und lüftungstechnische Abschottung des Neubaus zum Altbau mit allen seinen offenen Fugen wurde verzichtet. Den »perfekten« Oberflächen im Neubau stehen die von Gebrauchsspuren gezeichneten Türen und Wandvertäfelungen im Altbau gegenüber. Vorgefundene Farbreste in der Küche wurden erhalten und konterkarieren den Perfektionismus einer mit modernsten Geräten ausgestatteten Küche mit ihrem hochpolierten Edelstahl. Umschlossen wird das Grundstück von einer dunklen Mauer aus Stampfbeton, die den typischen grob verputzten Bruchsteinmauern der Gegend formal entspricht. Auch die im Ortsbild häufig vorkommenden ehemaligen Viehtränken hat der Architekt mit einem monolithisch betonierten Brunnen auf seinem Grundstück zitiert.
»Casascura«, dunkles Haus, hat das Ehepaar sein Gebäudeensemble genannt. Der in den massiven Stahl des Hoftores geschnittene Name mag zwar vordergründig den Neubau umschreiben, tatsächlich findet er seinen Ursprung im Nachnamen der Hausherrin.
Für G. W. F. Hegel ist Harmonie ein Moment, in dem sich das qualitativ Verschiedene nicht nur als Gegensatz und Widerspruch darstellt, sondern »eine zusammenstimmende Einheit« bildet. Hauenstein spiegelte den vorgefundenen Grundriss des Altbaus und verbindet diesen gestalterischen Dialog mit einem gläsernen Zwischenbau zu einer architektonischen Gesamtaussage, in der Neu und Alt nebeneinander bestehen können. Bemerkenswert ist auch die »gespiegelte« Materialwahl für den Neubau: Rauer Sichtbeton steht einem grob verputzten Gebäude gegenüber. Die erhaltene Holzvertäfelung im alten Wohnraum und die Putzflächen im Altbau wurden in eine weiß gekalkte Holzschalung aus Fichte an den Innenseiten des Neubaus übersetzt und sind dort durchgängig über Wand- und Deckenflächen geführt. Als Mittler zwischen Alt und Neu dient ein durch alle Räumlichkeiten durchlaufender Eichenholzboden, der mit Kalkzusatz geölt und damit ebenfalls aufgehellt wurde. Es sind auch diese wenigen, aber gut überlegten Materialentscheidungen, die das Gebäudeensemble zu einer »zusammenstimmenden Einheit« machen.db, Mo., 2008.12.01
01. Dezember 2008 Rolf Mauer
verknüpfte Bauwerke
Am Weinberg - Weiterbauen im Bestand
Weltenübergang
Der Hochbunker in Berlin-Mitte hat eine abwechslungsreiche Geschichte hinter sich: Als zivile Luftschutzanlage in der NS-Zeit errichtet und Zufluchtsort Zigtausender, wurde er nach Ende des Zweiten Weltkrieges von der Roten Armee als Gefängnis genutzt und später zum Obstlager, zur Partylocation und nun zum Museum. Doch die erlesene, zeitgenössische Kunst bleibt die meiste Zeit unter Verschluss – schließlich ist die Sammlung Boros in dem aufwendig umgebauten und um ein Penthouse aufgestockten Hochbunker »nur« ein Privathaus des Kunstsammlers, das Kunst und Raum eindrucksvoll vereint.
Schwer und laut fällt die Tür ins Schloss. Abrupt schneidet sie die Außenwelt ab. Ins Innere des ehemaligen Bunkers eingedrungen, hinter meterdicken, nackten, fensterlosen Wänden, weist zunächst nichts auf seine neue Nutzung hin. Nur der Untergrund ist irritierend weich: Ein knallgrüner Teppich belegt den Eingangsbereich. Erst ein paar Ecken weiter erwartet ein nüchtern weißer Tresen den Besucher. Darüber eine Glocke, die wie von Geisterhand gesteuert läutet, ohne einen Ton von sich zu geben, sich ohne Klöppel still hin und her bewegt. Sie ist das erste Kunstwerk, das den Besucher empfängt, und ihn zugleich leicht schaudern lässt. Diese Stimmung wird ihn auch später beim Gang durch die fünf Ausstellungsebenen begleiten. Zwar hat sich die Kunst »ihren Raum« genommen – reine Kulisse sind die Wände und Decken des Bunkers dennoch nicht. In jeder Ecke spürt man sein Vorleben. Das mag in vielen ein Unbehagen hervorrufen und ist dennoch das große Verdienst aller Planungsbeteiligten, ein perfektes Gleichgewicht zwischen Zeitzeugnis und neuer Nutzung. Der Bunker wurde seiner Geschichte nicht beraubt, nicht entmachtet, nicht mit Farbe übertüncht oder mit Kunst überfrachtet. Möglichkeiten dazu hätte es zahlreich gegeben, stehen neben Fassade und Türen doch nur die Treppenhäuser unter Denkmalschutz. Vor allem dort zeigen sich noch deutlich die Spuren der Vergangenheit: Fernsprecher und mächtige Stahltüren blieben original erhalten, ebenso die Oberflächen der Treppenhauswände aus unbehandeltem Sichtbeton mit dem Abdruck der Bretterverschalung.
Die Kunst der Architekten bestand aber auch in den Innenräumen darin, sich zurückzunehmen. Der größte Kraftakt war das Entfernen von Wänden und vor allem von Decken, was nun Sichtbeziehungen auch zu den darunter- beziehungsweise darüberliegenden Etagen schafft. Ohne dies und ohne Kunstwerke würde die Orientierung beim Rundgang wahrhaft schwerfallen – die Kunst, verzahnt über Lufträume, hilft, sich im labyrinthartigen Inneren zurechtzufinden; Raum und Kunst werden eins. Verputzt wurden nur Wände in der eigentlichen Ausstellung, in Absprache mit den Bauherren und Künstlern, die, einbezogen in den Planungsprozess, teilweise Werke speziell für den Bunker konzipierten oder ihre Arbeiten dafür nochmals veränderten. Nur an wenigen Stellen kamen neue Wände in Form von Brüstungen hinzu, »sozusagen das einzige Gestaltungselement von uns«, schmunzeln die Architekten. Sie fanden teilweise über ihr vorheriges Büro zusammen, aus dieser Zeit stammte auch der Kontakt zum Bauherrn. Doch inzwischen haben sich die Wege von Petra Petersson, Jens Casper und Andrew Strickland schon wieder getrennt. Petersson führt das Büro unter dem Namen Realarchitektur weiter, Casper arbeitet eigenständig in Berlin und Strickland hat es in die Schweiz verschlagen.
Zeitreise
Der Bau des »Reichsbahnbunker Friedrichstraße« geht Überlieferungen zufolge zurück auf die im September 1941 datierten Musterbaupläne von Karl Bonatz, Bruder des bekannteren Baumeisters Paul Bonatz. Sie sahen an verschiedenen Standorten jeweils einen gleichartigen, »bombensicheren Schutzraumbau für die Reichsbahn« vor. Im Rahmen des Führer-Sofortprogrammes unter der Leitung Albert Speers umgesetzt, soll der Bunker bereits 1942 über zweieinhalbtausend Menschen aus der Umgebung und Reisende aus dem nahe gelegenen Bahnhof-Friedrichstraße bei Luftangriffen Unterschlupf gewährt haben. Eingänge an allen vier Seiten mit Doppeltreppenanlagen ermöglichten schnellen Einlass. Womöglich wegen seiner exponierten Lage im Stadtraum an einer Straßenkreuzung unweit des Deutschen Theaters gelegen, ist der Hochbunker im Gegensatz zu manch anderen wesentlich aufwendiger gestaltet. Den oberen Abschluss der symmetrischen und jeweils durch Mittelrisalite gegliederten Fassade bildet ein umlaufendes Konsolgesims. Noch heute offenbaren sich an der Fassade die Spuren der Vergangenheit: Sie wurde lediglich gereinigt und in Abstimmung mit der Denkmalpflege an konstruktiv notwendigen Stellen instandgesetzt, die zahlreichen Einschlusslöcher blieben sichtbar.
Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzte die Rote Armee den Hochbunker vorübergehend als Militärgefängnis, bis er ab etwa 1950 als Lagerstätte diente, zu DDR-Zeiten zum Beispiel für Südfrüchte, was ihm die Bezeichnung »Bananenbunker« einbrachte. Aus dieser Nutzungsepoche stammt die Öffnung an der nördlichen Fassade, wo ein Lastenaufzug angebracht wurde – bis heute jeweils das einzige Fenster pro Geschoss.
Wenige Jahre nach der Wende betanzten schließlich zunächst Techno-freaks die leerstehenden Räume und feierten hier die angeblich härtesten Technopartys Berlins. Die Wände wurden bunt, besprayt und bemalt, und die Räume zur halblegalen Adresse für weitere Musik-, SM- und Szenepartys. Nach einigen Razzien und Bauauflagen, die spontan wohl kaum zu realisieren waren – wie lässt sich auch eine Versammlungsstättenverordnung mit den starren Gegebenheiten im Bunker in Einklang bringen? – fand das Treiben 1996 ein abruptes Ende. Und 2003, nach einigen temporären Kunstausstellungen, der Bunker seine neue Bestimmung: 2007 bezog der Kunstliebhaber Christian Boros mit seiner Familie das aufgestockte Penthouse auf dem Dach als seinen Zweit- beziehungsweise Wochenendwohnsitz; seit Juni dieses Jahres gilt es, darunter seine beeindruckende Sammlung zeitgenössischer Kunst zu entdecken [1]. Bereits 1990 begann der heutige Inhaber einer erfolgreichen Werbeagentur, Kunstwerke zu sammeln, etwa von Damian Hirst, Olafur Eliasson, Anselm Reyle oder Tobias Rehberger. Derzeit besitzt er nach eigenen Angaben rund fünfhundert Arbeiten, die er leichtfertig-plakativ mit den Worten »Ich sammle Kunst, die ich nicht verstehe.« kommentiert. In dieser ersten Ausstellung sind – auf einer Fläche von etwa 2500 Quadratmetern – ausschließlich Skulpturen, Raum- und Lichtinstallationen von insgesamt 57 Künstlern zu sehen.
Ein Monster aus Beton
Keine Alltagsaufgabe: Eine massive Stahlbetondecke von drei Metern, 1,80 Meter dicke Außenwände, eine Raumhöhe von zwei bis 2,30 Metern und rund 120 Kammern – so fanden »Realarchitektur« ihr Projekt vor. Nach mächtig Handarbeit, Geduld und Zeitaufwand – 750 Kubikmeter Beton (insgesamt ein Würfel mit über neun Metern Kantenlänge) galt es im Bunker zu zerkleinern und zu entfernen – sind nun nur noch achtzig Räume mit teils bis zu 13 Meter hohen Lufträumen geblieben. Sie werden pro Geschoss nach wie vor über den mittigen Rundgang erschlossen.
Doch der statische Nachweis für den geplanten Umbau erwies sich als schwierig; Daten zur Berechnung der Verkehrs - und Bruchlast fehlten. Aufschluss sollte ein direkter Belastungstest geben: Eine hydraulische Presse versuchte, der Deckenkonstruktion Herr zu werden, sie zum Bruch zu zwingen. Und war mit ihrem Scheitern erfolglos und erfolgreich zugleich: Die tatsächliche Bruchlast bleibt für immer ungewiss – eine Bestätigung und Messergebnisse als Berechnungsgrundlage hatte man damit dennoch. Die Abbrucharbeiten, unüberhörbar im umliegenden Straßenraum, konnten beginnen.
Drei Monate sägten und rüttelten die Handwerker mittels Diamantschneidetechnik allein an der Öffnung der Drei-Meter-Decke für den Aufzug und die Erweiterung des Treppenhauses hinauf zur Wohnung des Bauherrn. Durch das beeindruckend monströse, roh belassene Loch sticht nun die neue Erschließung, ausgeführt mit einem Streckmetall, das unprätentiös und dennoch edel wirkt in seiner Einfachheit, kontrastierend mit der Bruchkante der Deckenöffnung und deren herausstehenden, gekappten Bewehrungsstäben. Hier wird die kolossale Konstruktion zum ersten Mal richtig deutlich – und die Mammutaufgabe, der Planer, Handwerker und Bauherren gegenüberstanden.
Auch finanziell war die Umnutzung eine Herausforderung, weitgehend unkalkulierbar die Kosten. Um diese hüllt sich allerdings Schweigen. Zunächst war geplant, die ersten Geschosse zu vermieten, als man sich, so Petersson, »noch nicht der immensen Kraft des Gebäudes« bewusst war.
Himmel über Berlin
Oben angekommen, scheint die Welt wieder eine andere. Dass man eben in einer erlesenen Sammlung zeitgenössischer Kunst war, daran erinnern zwar ebenso exquisit ausgewählte Möbel und Kunstwerke, aber das bedrückend beklemmende Gefühl hat sich verflüchtigt. Luftiger und lichtdurchlässig wurde es schon im oberen Treppenhaus, nun fühlt man sich frei. Das Penthouse übertrifft in einer faszinierenden Großzügigkeit, architektonischen Qualität und nahezu asketischem Purismus alle Erwartungen. Für Ersteres sorgt die Raumhöhe von 3,75 m bei einer Fläche von 26 mal 26 Metern. Zweiteres darf man wohl vor allem den Planern und Ausführenden verdanken. Das Dritte sicher einer eher ungewohnten Bauherrn-Diszipliniertheit; wenige Materialien und ebenso wenige Möbel bestimmen die Anmutung. Der umlaufenden und trotz ihrer filigranen Wirkung auch das Dach tragenden Stahl-Glasfassade stehen robuste Oberflächen gegenüber: Wände und Decken aus Beton, Böden und Sanitärbereiche aus Muschelkalk, Schrank- und Regalwände aus Eichenholz, angeblich gefertigt aus nur einem, 370 Jahre alten, westfälischen Eichenstamm.
Die Qualität und behutsame bis extravagante Materialwahl, die angenehm ruhig und unaufdringlich wirkt, setzt sich auch im Außenbereich fort: Der Terrassenbelag besteht aus Bankiraiholzlamellen, in den sich ein Wasserbecken gräbt, und der verschiebbare, individuell gefertigte Sonnenschutz aus einem Stahlrahmen mit darin gespannten Aluminiumketten. Gemeinsam mit den umlaufenden Dachgärten und Terrassen ergibt sich eine Fläche von knapp tausend Quadratmetern, eine grandiose Dachwohnung inmitten der Stadt. So gar nicht passt da die – dennoch erfreuliche – Vorstellung, dass das Dach noch mit einer Photovoltaikanlage nachgerüstet werden soll.
Auch dem Stadtraum tun das Grün des Dachgartens und überhaupt das aufgestockte Penthouse gut. Als hätte man dem jahrelang leerstehenden Gebäude wieder Leben eingehaucht. Plump und etwas gedrungen hatte es zuvor gewirkt. Mit dem hinzugekommenen Geschoss findet das Gebäude einen wohlproportionierten Abschluss.
Was bleibt, fällt die mächtige Stahltür erst wieder hinter dem Besucher ins Schloss, ist ein Nachsinnen über seine neue Nutzung. Und über einen leise vernommenen Vorwurf, dieser Ort der Geschichte behandele »distanzlos alle Spuren allein als Material und Zeichen, aber nicht als Dokumente«, seine düstere Vergangenheit diene »mehr der Inszenierung von Kunst und Ego« [2]. Das mag zum Teil stimmen, doch wie hätte es anders aussehen sollen, aussehen können? »Es ist ein Segen, dass Boros diese Werke erworben hat – Versäumnisse der Berliner Museen können so zumindest teilweise ausgeglichen werden«, schreibt dafür die Tagespresse [3]. Nicht nur, dass es ein Segen ist, dass er all jene Kunstwerke über die Jahre gesammelt hat, zugegeben sammeln konnte – ein Glücksfall vielleicht auch, dass gerade er den Bunker behutsam und mit viel Sorgfalt umgestalten ließ und ihm zeitge-nössische Kunst als »das höchste Potenzial geistiger Freiheit«, so Boros, gegenüberstellt. Eine bessere Nutzung hätte man sich hier wahrlich nicht vorstellen können.db, Mo., 2008.12.01
[1] Die Privatsammlung ist generell nur nach Voranmeldung am
Wochenende zu besuchen; siehe: www.sammlung-boros.de
[2] Claus Käpplinger, in: architektur.aktuell, No.342, 9.2008
[3] Kathrin Wittneven, in: Tagesspiegel, 24. Februar 2008
01. Dezember 2008 Christine Fritzenwallner
verknüpfte Bauwerke
Wohnhaus und Sammlung Boros
Verteidigungsring
Das Stadion in Maribor ist nicht von olympischen Ausmaßen – es bietet nur rund 12 500 Sitzplätze – mit seiner erlesenen Architektur hingegen kann es locker im länderübergreifenden Ringen der Fußballclubs um Aufmerksamkeit und Prestige mitmischen. Konzeptionelle Stringenz und gestalterische Präzision heben den Bau in die architektonische Oberliga. Allerdings sind noch nicht alle Ausbaupläne verwirklicht; die Gelder fließen spärlich, Ansprüche und Bedürfnisse der Hauptnutzer ändern sich.
Der NK Maribor ist seit einiger Zeit der erfolgreichste slowenische Fußballverein, und so darf man in der zweitgrößten Stadt des Landes – sie hat 110 000 Einwohner – stolz darauf sein, eine ganze Reihe von Meisterschaften und Pokalsiegen für sich verbucht und es bereits einmal bis in die europäische Champions League geschafft zu haben. Der Fußballverein (Nogometni Klub, abgekürzt: NK) gehört zum Verband der örtlichen Sportvereine mit rund 25 Abteilungen und dem Namen »ZMŠD Braník« – das slowenische Wort Braník steht für Schutz, Abwehr.
Name und Logo von Verband und Vereinen beziehen sich auf das Stadtwappen, das ein wehrhaftes Stadttor zeigt und da¬rüber den göttlichen Schutz in Gestalt einer Taube. Ob allein der spielerische Gegner des Schutzes bedarf – der sich freilich stets warm anziehen muss – darüber lässt sich trefflich philosophieren. Allzu oft gilt es aber auch, während der Spiele die Fans voreinander zu schützen, nicht nur den gegnerischen gegenüber, sondern auch untereinander. Und Schutz brauchen auch jene Stadion-Nutzer, die drohen, vom übermächtigen Platzhirschen in die Ecke gedrängt zu werden. Das wunderschöne, nagelneue Fußballstadion in der beschaulichen Universitätsstadt Maribor muss einiges aushalten.
Volksgarten
Auch das Stadion hat einen der Tradition folgenden Namen: 1873 richtete ein am Ort ansässiger Industrieller am Rande der Altstadt – wohl im Hinblick auf seine eigenen Arbeiter – eine öffentliche Parkanlage zur Förderung der Volksgesundheit ein, Ljudski vrt – zu Deutsch: Volksgarten. Den ersten Leibesübungen im Grünen folgte bald der Fußball: 1920 wurde ein Spielfeld angelegt, das 1952 an der heutigen Stelle als Stadion ein¬gerichtet und 1962 an seiner westlichen Längsseite mit einer Tribünenüberdachung versehen wurde. Mit der Loslösung Sloweniens aus dem jugoslawischen Staatenbund und dem folgenden wirtschaftlichen Aufschwung samt Bevölkerungszuwachs in den Städten wuchs auch der Bedarf an repräsentativen Sportstätten. Den bereits Ende der neunziger Jahre ausgeschriebenen Wettbewerb für die Erweiterung des Ljudski vrt gewann das Gespann aus den beiden in Ljubljana ansässigen und miteinander freundschaftlich verbundenen Architekturbüros OFIS und multiPlan. In ihrem Entwurf verstanden es die Architekten, eine Reihe von Überlegungen und funktionalen Anforderungen in eine Gesamtfigur einzubinden, die zusammen mit der bereits bestehenden Tribünenüberdachung vom Anfang der sechziger Jahre eine einheitlich wirkende Großform ergibt. Die Querträger des alten Dachs lasten im Rücken der Tribüne auf Stützen, zur offenen Seite hin werden sie von einem gewaltigen, leicht zum Spielfeld hin geneigten Stahlbeton-Bogen getragen. Darunter ist ein mittlerweile bedenklich korrodiertes Stahlseilraster gespannt, das wiederum die Dachhaut aus kleinformatigen Aluminiumblechen trägt. Dieser beeindruckenden Bogenkonstruktion entsprechen die wie in einer Wellenbewegung auf- und absteigenden Schwünge des im Hufeisen um die übrigen Spielfeldseiten geführten neuen Tribünendachs. In der Gesamtschau ergibt sich so, egal ob aus der Ferne oder im Inneren, immer ein einheitliches Bild, das zudem mit den sanft geschwungenen Hügeln im Hintergrund korrespondiert.
Dieser Ausgestaltung liegt die Entscheidung zugrunde, an jenen Stellen mit guter Sicht mehr Sitzplätze anzubieten als an denen mit ungünstigem Blickwinkel. Daher wurden die Hauptzugänge in die Ecken gelegt und die Zahl der Sitzreihen dort reduziert. Zentral über dem Spielfeld steigen die meisten Sitzreihen hintereinander auf, und die Dachschwünge erreichen hier jeweils den höchsten Punkt. Im Rücken der Tribüne verläuft als ein zentrales Element des Entwurfs ein durchgehender Umgang, von dem aus alle Plätze erreichbar sind. Beginnend auf Rasenniveau, neben den Auflagerpunkten des alten Tribünenbogens, folgt der Umgang dem Auf und Ab der Tribünenränder und ermöglicht es, frei im gesamten Neubau umherzugehen. Dieser konzeptionellen Durchlässigkeit entspricht auch die Offenheit der Konstruktion: Die Betonpfeiler, auf denen das Dach ruht und von denen aus die weit auskragenden Stahlträger abgehängt sind, fassen jeweils paarweise einen der Zugänge zum Tribünenraum ein. Im Gesamtbild treten sie kaum in Erscheinung und lassen das Dach schwebend erscheinen, zumal die Hinterwand des Umgangs völlig verglast ist und keinerlei Einbauten oder Brüstungen den Blick behindern. Zusammen mit der zweischaligen Dachhaut aus transluzenten Polycarbonatplatten, die nachts von innen beleuchtet werden, entsteht ein offener, heller und sehr heiterer Eindruck – die liebliche Hügellandschaft der Untersteiermark tut dazu ihr Übriges. Diesem luftigen Eindruck können auch die kräftigen Vereinsfarben – Violett und Sonnengelb – nichts anhaben, die sich in großflächigen Plakaten, Beschriftungen und vor ¬allem in den Schalensitzen wiederfinden. Hier ist der mächtige Einfluss des Fußballklubs zu spüren, der das ursprünglich als Sport- und Kulturstätte für ganz Maribor errichtete Stadion mehr und mehr für sich zu vereinnahmen trachtet. Letztlich ist das auch legitim; zwar flossen Gelder aus Töpfen von Stadt (sechzig Prozent), Verein (vier Prozent) und dem EU-Fonds für regionale Entwicklung (36 Prozent); der noch lange nicht abgeschlossene Ausbau ist jedoch nur mit Sponsorengeldern zu bewerkstelligen – und die wird man weniger durch ein freundliches Wesen als vielmehr mit fernseh- und somit werbewirksamen Sportveranstaltungen in der obersten Liga erwirken. Es fehlen bislang die Bestuhlung der allerobersten Sitzreihen und die zweite Glasschale, die den Umgang zu einem rundum windgeschützten Bereich aufwerten soll.
Leider beginnt bereits die Aufweichung des architektonischen Konzeptes. Da die besonders hartgesottenen Fans in ihrer Unbändigkeit nicht nur eine Gefahr für sich selbst, sondern eine ganz generelle darstellen, ging man bereits dazu über, sie abgeschirmt vom Gros der Zuschauer in einen eigenen Bereich zu pferchen. Er wird separat erschlossen und ist aus gutem Grund mit Sitzschalen ohne Rückenlehnen ausgestattet.
An der Längsseite ist ein VIP-Bereich ausgewiesen, den es noch einzurichten und vor allem mit Absperrungen auszustatten gilt. Diese sind im Entwurf zwar vorgesehen, dort aber verständlicherweise als kaum spürbare Linien dargestellt. Das Prinzip der freien Bewegung im Stadion, der offene, demokratische Charakter der Anlage wird durch diese Sektionierung ad absurdum geführt. Bleibt also zu hoffen, dass die Organisatoren sich von der Architektur leiten lassen und den Umgang zum Beispiel als Raum für allgemein zugängliche Sponsoren-Präsentationen offen halten.
Welche Planer und Firmen den weiteren Ausbau zu welchen Teilen übernehmen werden, ist unklar. Ein weiteres Architekturbüro, ComArh aus Maribor, ist im Gespräch. Gerne würden OFIS arhitekti retten, was zu retten ist, doch Informationen, wie es weitergeht, gibt es nur spärliche. Das engmaschige Netzwerk im kleinstädtisch wirkenden Maribor ist vom zwei Autostunden entfernt liegenden Ljubljana aus kaum zu durchdringen. Der als Bauherr auftretende Sportverbund stellt den Ausbau für das kommende Jahr in Aussicht, hält sich sonst aber bedeckt.
Dabei wurde mit einem ganz wesentlichen Teil der Anlage noch gar nicht begonnen: Unter den Tribünen wurde auf ¬einem ober- und einem unterirdischen Geschoss Raum geschaffen für einen Fitnessclub mit Schwimmbecken, Läden, Gaststätten und vier Sporthallen, die man in der Stadt dringend braucht – die nebenan gelegene, 2006 eröffnete Sporthalle Lukna steht bisweilen unter Wasser, weil der darunter liegende Kanal zu knapp bemessen wurde. Man scheint dennoch Zeit genug zu haben, schließlich brauchte es vom Wettbewerb bis zum bespielbaren Stadion allein schon zehn Jahre …
Unauffällige Landmarke
Derweil darf man sich auf dem bereits Erreichten aber getrost ein wenig ausruhen. OFIS arhitekti verwirklichten ein zeichenhaftes Gebäude, das selbst auf kleinsten Hotelfernsehschirmen seinen Wiedererkennungswert entfaltet, gleichzeitig aber wie selbstverständlich im Stadtorganismus zwischen Schulen, kleinen Stadtvillen und weiteren Sportanlagen liegt und gegenüber dem umgebenden Straßenraum sogar mit reichlich Understatement auftritt. Dies liegt zum einen an der geringen, weil vom örtlichen Baurecht so vorgeschriebenen Höhenentwicklung. Zum anderen haben die Architekten die nach außen hin ins Gewicht fallenden Bauteile schlicht »schwarz weggestrichen« – alle Metallprofile und Streckmetall-Brüstungen sind anthrazitfarben beschichtet. Der Rest ist Glas. Die weiten Kurven der Tribünen treten nach außen hin nur in Form des Umgangs in Erscheinung, der sich kühn den schmalen Vorplätzen im Norden und im Süden entgegenschwingt und sich dabei elegant über einen eingeschossigen Unterbau erhebt. Diese im Rechteck angelegte »Basis« ist rundum verglast und wartet darauf, an den Schmalseiten mit Büros und Ladenlokalen belegt zu werden. Ihr Dach fungiert als Verteilerebene für die in das Stadion strömenden Fans und als Aufenthaltszone während der Pause.
Was den Bau in die architektonische Oberliga hebt, ist seine konzeptionelle Stringenz und seine gestalterische Präzision. OFIS arhitekti schaffen es immer wieder, auch mit preiswerten Standardmaterialien ästhetisch hochwertige Oberflächen herzustellen und im besten Sinne »durchgestylte« Erscheinungsbilder zu erzeugen. Sie bearbeiten ihre Aufträge schon fast mehr aus Gewohnheit denn aus der Not heraus so, als stünde nahezu kein Budget zur Verfügung. Mitunter handeln sie sich dadurch auch Unlösbares ein: So ergab sich beispielsweise aus der Kombination gekrümmter Dachflächen mit orthogonalen Tragstrukturen eine problematische Geometrie, die weder bei der beleuchteten Dachuntersicht noch an den Endpunkten des Umgangs gestalterisch zufriedenstellend in den Griff zu bekommen war.
Sicher ist jedoch, dass die Anlage den ein oder anderen gestalterischen Angriff gut aushalten wird. Die – ohne Absprache mit den Architekten – noch vor die unterste Sitzreihe gehängten Gitterroste bieten Platz für noch mehr Fans, fallen aber ¬außer durch miserable Sichtbedingungen kaum ins Gewicht. Bleibt also zu hoffen, dass die Stadt sich dauerhaft gegen allerlei Begehrlichkeiten zu schützen weiß und das Entwurfskonzept des Stadions stark genug ist, dem steigenden Verwertungsdruck seitens der Fußballer standzuhalten … ganz im Sinne von »Ljudski vrt«, dem allen Menschen offenstehenden Volksgarten.db, Mo., 2008.12.01
01. Dezember 2008 Achim Geissinger
verknüpfte Bauwerke
Fussballstadion Maribor
In der Marsch
In der Nähe des nordfriesischen Ortes Neukirchen, zehn Kilometer von der Küste entfernt, schuf Emil Nolde in den Jahren 1927–37 einen Ort, an dem Kunst, Natur und Architektur eine außergewöhnliche Verbindung eingehen und der noch heute eng mit seinem Leben und Werk verbunden ist. 2007 ließ die 1957 gegründete Nolde-Stiftung drei Neubauten errichten, die einerseits sensibel auf den Bestand eingehen und andererseits große Eigenständigkeit beweisen, wodurch die besondere Atmosphäre des Ortes weiter gestärkt wird.
Nachdem man das niedrige, weiße Gartentor passiert hat, führt der schnurgerade Kiesweg entlang eines schilfgesäumten Sielgrabens auf das Ensemble der Nolde-Stiftung zu: das Museum – untergebracht in Noldes Wohn- und Atelierhaus – der Bauerngarten mit Teich, das Mausoleum – in dem Emil Nolde und seine Frau Ada beigesetzt sind – sowie die drei Neubauten »Forum«, »Kontor« und »Botanikum«. Von Bäumen gesäumt, sind die Gebäude im Näherkommen kaum zu sehen bis auf der rechten Seite unvermittelt ein großer Glasbau auftaucht – das Forum, der neue Eingangsbau für die Gesamtanlage, die sich seitlich und dahinter erstreckt. Der Weg, der auf Höhe des Forums von einer langen Bank begleitet wird, führt am südlichen Rand des Geländes weiter und geht schließlich in einen Wiesenweg über.
Der besondere Ort
Als Emil Nolde 1926 die unbebaute Warft in der Landschaft des »Gotteskoog« einschließlich des nahe gelegenen Hofs Seebüll und der dazugehörigen Ländereien erwarb, waren weite Teile des Koogs noch Wasserflächen. In den folgenden Jahrzehnten entstand die heutige, von Gräben und niedrigen Deichen durchzogene, vorwiegend als Weiden genutzte Landschaft mit weit auseinander liegenden Höfen. Unter Mitwirkung des befreundeten Architekten Georg Rieve plante Nolde nach seinen eigenen Vorstellungen zwischen 1927 und 1928 ein Atelier- und Wohnhaus, das er 1934–37 durch einen Bildersaal erweitern ließ. Der aus klaren, geometrischen Formen zusammengesetzte Bau aus Bockhorner Klinkern erhält sein eigenwilliges Aussehen vor allem durch die Anordnung der Fenster sowie durch zwei dreieckige Erkerbauten, deren Dächer sich an der Form damaliger Heuhaufen orientieren. Am Fuße der Warft legte Nolde einen Bauerngarten an, in dem Dahlien und Astern noch bis lange in den Herbst hinein in zahlreichen Farben blühen. Seit den fünfziger Jahren waren auf dem Gelände fünf im Vergleich zum Nolde-Haus eher grob anmutende Bauten errichtet worden, die den zunehmenden Platzbedarf der nach Noldes Tod eingerichteten Stiftung deckten. Diese, gestalterisch unbefriedigenden und technisch unzulänglichen Gebäude wurden im Zuge der 2004 begonnenen Neuordnung des Gesamtareals abgerissen und durch drei architektonisch anspruchsvolle Neubauten ersetzt. Wesentlicher Leitgedanke des von der Stiftung beauftragten Architekten Walter Rolfes war es, das Nolde-Haus mit seinem Garten und dem hinterlassenen malerischen Werk des Künstlers als Einheit wiederherzustellen und diesen authentischen Ort mit seiner großen kulturellen Ausstrahlung zusätzlich zu stärken. Durch die Komposition der Gebäude, ihre klare Formensprache sowie die Materialwahl wird dieses Anliegen absolut überzeugend umgesetzt. Die großen Neubauten – Forum und Kontor – wahren respektvoll Abstand zum erhöht stehenden Altbau. Mit ihm sind sie über Sicht- und Wegebeziehungen verbunden und bilden räumlich ein Dreieck aus. Um die jeweils erheblichen Volumen der Neubauten möglichst dezent in der Landschaft zu platzieren, wurde der mittlere Gebäudeteil aus der Dachfläche »herausgeschoben«, so dass die Baukörper wesentlich kleiner erscheinen als sie sind.
Kontor und Forum
Das Erscheinungsbild des Forums und des Kontors spiegelt ihre jeweiligen Funktionen klar wider: Das Kontor, als Sitz der Stiftung, mit Depot der Nolde-Werke, Bibliothek, Büros und Direktorenwohnung, ist nicht öffentlich zugänglich und hat bedingt durch den großen Wert der Sammlung einen extrem hohen Sicherheitsanspruch, aus dem seine kompakte, eher geschlossene Architektur resultiert. Ein Gebäude wie ein Tresor oder ein Schatzkästchen, dessen Längsseite zum Forum hin nur durch wenige Fenster im Bereich der Büros und der Wohnung gegliedert wird, während sie im Sammlungsbereich fensterlos ist. Im Gegensatz zum übrigen Gebäude sind die Wände in diesem Teil auch nicht aus massivem Mauerwerk, sondern aus Beton. Das Kontor ist an den nordwestlichen Rand des Areals gesetzt und somit von den öffentlich zugänglichen Gebäuden und dem Garten leicht abgerückt. Seine besondere Wirkung entsteht durch den außergewöhnlichen, sehr hart gebrannten, dunklen, fast schwarzen, metallisch glänzenden Backstein, der sich am Bockhorner Klinker des Altbaus orientiert, diesen aber nicht imitiert. Durch ihn wird nicht nur der monolithische Charakter des Gebäudes verstärkt, er verleiht ihm auch sein edles Aussehen, ganz seinem Inhalt entsprechend. Das Ungewöhnliche an diesem, eigens für das Bauvorhaben erdachten und gefertigten Mauerstein ist seine gekippte, leicht spiegelnde Oberfläche, in der das Spiel der Wolken und das in Küstennähe ständig wechselnde Licht sowie die zahlreichen Farben der Natur reflektiert werden. Je nach Wetter, Perspektive des Betrachters, Tages- und Jahreszeit befindet sich die Fassade so in ständiger Veränderung. Unterbrochen und strukturiert wird das wechselhafte Fassadenbild durch einzelne, glatte Läuferschichten, die die oberen und unteren Abschlüsse der Fenster aufnehmen.
Das Forum – als Empfangsgebäude Ort der Kommunikation und Information – mit Kassenbereich, Shop, Restaurant, biografischer Ausstellung, Malschule und Vortragssaal gibt sich dagegen offen und transparent. Die Stahl-Glas-Konstruktion der Außenhaut umschließt eine eingestellte »Skulptur«, die im ersten Geschoss unter anderem die Ausstellung zu Noldes Leben aufnimmt, während im Erdgeschoss Serviceeinrichtungen wie Sanitäranlagen, Schließfächer und die Restaurantküche integriert sind. Die gläserne Gebäudehülle bezieht die Landschaft in die Räume ein; Innen- und Außenraum durchdringen einander, die Übergänge sind fließend. Das Innere ist so gestaltet, dass sich neben den Ausblicken in die Landschaft auch zwischen den Raumeinheiten und den Geschossen vielfältige Blickbeziehungen ergeben.
Die Verschmelzung von Innen und Außen, aber auch die enge, wechselseitige Beziehung der Gebäude zueinander, wird über den Einsatz der Materialien noch unterstützt. So findet sich beispielsweise der Stein des Kontors auch an der dem Kontor zugewandten Seite des Forums und wird außerdem bei beiden Gebäuden in den Innenraum hineingezogen.
Ein Projekt mit Sonderwünschen
Nicht nur der Mauerstein wurde speziell für das Projekt gefertigt, auch die meisten Einbauten – unter anderem flache, lehnenlose Sitzbänke sowie Tresen- und Thekeneinbauten im Shop und Restaurant – wurden von den Architekten mit entworfen und von Handwerksfirmen der Umgebung umgesetzt. Ein Anspruch, der die Projektkosten nicht gerade niedrig hielt, der sich aber allemal gelohnt hat und wesentlich zum stimmigen Gesamteindruck beiträgt. Doch die relativ hohen Gesamtkosten sind nicht ausschließlich gestalterisch, sondern auch konstruktiv begründet. Da die Gebäude in der Marsch stehen, war eine vergleichsweise aufwendige Pfahlgründung erforderlich. Vorteil dabei: 75 der insgesamt 220, 18 Meter langen Pfähle liefern als sogenannte Energiepfähle die Erdwärme für den Betrieb der Fußbodenheizung. Nach Neuordnung des Geländes der Nolde-Stiftung, die neben den Abriss- und Baumaßnahmen auch die Wiederherstellung der authentischen Bepflanzung des Gartens beeinhaltete, ist in Seebüll ein kraftvoll-poetischer Ort entstanden, dessen Sinneszusammenklang sich nur schwer fassen lässt, wenn man ihn nicht selber erlebt hat. Die klare Sprache der beiden so unterschiedlichen und doch verwandten Neubauten verbindet sie über zahlreiche, subtile Verweise mit der Formidee des Nolde-Hauses und zeugt von einem tiefen Verständnis für die Landschaft und das künstlerische Werk Emil Noldes.db, Mo., 2008.12.01
01. Dezember 2008 Ulrike Kunkel
verknüpfte Bauwerke
Neuordnung der Nolde-Stiftung