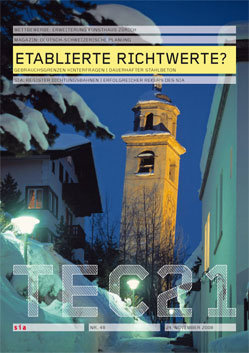Editorial
Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit sind Bauwerkseigenschaften, die im aktuellen Normenwerk definiert sind. Für die Herstellung und Gewährleistung dieser Eigenschaften geben die Tragwerksnormen unter anderem Richtwerte, etwa bezüglich der zulässigen Verformungen, vor. Normen können aber nicht das gesamte Spektrum der in der Praxis auftretenden Beanspruchungen und Anforderungen abdecken und nicht allen aktuellen Entwicklungen in Theorie (neue Berechnungsmodelle) und Praxis (neue Werkstoffe) gerecht werden. Bezüglich Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit genügen Norm- bzw. Richtwerte vielfach nicht.
Die ingenieurmässige Herausforderung besteht dann darin, den Interpretationsspielraum und die nicht festgelegten Parameter der Normen zu nutzen, ohne bei den nicht verhandelbaren, für die Trag sicherheit relevanten Grundlagen Kompromisse einzugehen. Der souveräne Umgang mit dem Spannungsfeld zwischen rigiden Regeln und konstruktiver Gestaltungsfreiheit ist ein Merkmal erfolgreicher und kreativer Ingenieurarbeit. Dieses Heft zeigt dazu aktuelle Beispiele aus Hoch- und Tiefbau.
Im Artikel «Gebrauchsgrenzen hinterfragen» werden die Angaben der Gebrauchsgrenzen in den Tragwerksnormen kritisch analysiert und angepasst. Dabei geht es nicht darum, Tragwerke auszudünnen. Vielmehr wird das Tragwerk auf die Anforderungen aus der Nutzung objektspezifisch abgestimmt, wobei es auch hohen ästhetischen Anforderungen genügen und in ökonomischer Hinsicht die Erwartungen der Bauherrschaft erfüllen soll. Die praktische Umsetzung wird an zwei aktuellen Hochbauten demonstriert: einem vom Estudio Rafael Moneo entworfenen, 2006 / 07 erstellten Laborgebäude in Basel sowie dem kürzlich in Angriff genommenen, von Gigon / Guyer Architekten entworfenen Bürogebäude «Prime Tower» in Zürich. Beim ersteren Bauwerk erwies sich die Verformung eines Stahlfachwerkträgers als kritische Grösse, während beim zweiten Beispiel die Durchbiegung weit gespannter Betondecken die Gebrauchstauglichkeit der Büroräume in Frage stellen kann.
Der Beitrag «Dauerhafter Stahlbeton» zeigt anhand von Forschungsarbeiten und neuen Entwicklungen an Kunstbauten, dass Dauerhaftigkeit nicht allein von der Einhaltung der Normen und Richtwerte abhängt. Diese Eigenschaft wird auch von der Dichtigkeit des Betons, von der Korrosionsbeständigkeit der Bewehrungen und von der Wirksamkeit von Oberflächenschutzmassnahmen am Beton bestimmt. Hier besteht Handlungsbedarf, um alle für die Korrosionsbeständigkeit der Bewehrungen, und damit für die Dauerhaftigkeit, bestimmenden Einflussgrössen und Massnahmen in einer griffigen Norm zusammenzufassen und praxisbezogene Richtwerte festzulegen.
Aldo Rota
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Erweiterung Kunsthaus Zürich
12 MAGAZIN
Deutsch-Schweizerische Planung
16 GEBRAUCHSGRENZEN HINTERFRAGEN
Paul Lüchinger, Joseph Schwartz
Die in den SIA-Normen bedingt verbindlichen Richtwerte für die Gebrauchstauglichkeit können objektspezifisch angepasst werden. Änderungen müssen in der Nutzungsvereinbarung festgehalten werden.
21 DAUERHAFTER STAHLBETON
Eugen Brühwiler
Neben normgemässen Überdeckungen sind auch die Betonqualität und der Oberflächenschutz eine Voraussetzung für dauerhafte Kunstbauten. Ein neues Konzept im Brückenbau verwendet Hochleistungsfaserbeton in kritischen Bereichen.
27 SIA
Erfolgreicher Rekurs des SIA | Register Dichtungsbahnen
31 PRODUKTE
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
Gebrauchsgrenzen hinterfragen
Die in den SIA-Tragwerksnormen empfohlenen Richtwerte für die Gebrauchstauglichkeit sind bedingt verbindlich. Sie können und müssen teilweise objektspezifisch angepasst werden. Die notwendige Beurteilung verlangt den Planern viel individuelles, objektbezogenes Abwägen ab und erfordert viel Erfahrung.
Das Tragwerk stellt ein Subsystem des Gesamtbauwerks dar. Sein Konzept wird im Rahmen des Entwurfs als Teil der integralen Planung in Zusammenarbeit mit allen beteiligten Fachleuten entwickelt. Dieses nimmt Bezug auf die gesamtplanerischen, die architektonischen sowie auf die betrieblichen Belange und berücksichtigt gleichermassen die Randbedingungen aus der Umwelt wie die gesetzgeberischen Rahmenbedingungen. Aus diesen Gegebenheiten folgen die grundlegenden Anforderungen an das Tragwerk, die mit verschiedenen Massnahmen erfüllt werden können. Im Falle der Tragwerksbemessung hat sich sowohl in der nationalen als auch der internationalen Normenpraxis seit längerer Zeit die Betrachtung von Grenzzuständen durchgesetzt.1, 2 Als solche werden die Tragsicherheit und die Gebrauchstauglichkeit unterschieden.
Tragsicherheit: Verbindlich
Gegenüber Tragwerksversagen fordert die Gesellschaft allgemein die Sicherheit von Personen im Einflussbereich von Bauwerken. Bauherrschaft, Benutzer und Dritte stützen sich dabei auf einschlägige Rechtsgrundlagen. Den anerkannten Stand der Technik beschreiben entsprechende Regeln zur Tragsicherheit in den Normen – in der Schweiz sind dies die SIANormen. Da an der Tragsicherheit ein öffentlich-rechtliches Interesse besteht, ist sie nicht verhandelbar und das dazugehörige Normenwerk somit verbindlich (siehe Kasten Seite 20).
Gebrauchstauglichkeit: Verhandelbar
Nebst der Tragsicherheit steht die Zweckerfüllung und damit die Gebrauchstauglichkeit eines Bauwerks im Vordergrund des Bauherreninteresses. Sie orientiert sich an Fragen nach der vorgesehenen Nutzung des Tragwerks und den Ansprüchen der Benutzer. An der Gebrauchstauglichkeit besteht ein privatrechtliches Interesse, sie wird demnach in Absprache zwischen Bauherrschaft und Projektierenden geregelt.
Die Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit sind ab Beginn der Projektierung zu diskutieren und im Rahmen der Projektentwicklung laufend neu zu beurteilen. Die Folgen der Entscheide sind im Voraus aufzuzeigen und zwischen dem Besteller und dem Ersteller frühzeitig festzulegen. Dafür dient die Nutzungsvereinbarung als wichtiges vertragliches Instrument mit technischem Inhalt zwischen Bauherrschaft und Projektierenden einerseits und Benutzern (z.B. Mietern) andererseits. Die entsprechenden Regeln der Tragwerksnormen sind ein möglicher Leitfaden in der Diskussion. Sie bezwecken einheitliche Sprachregelungen und kategorisieren Begriffe, Vorgehensweisen und Nachweise.
Objektspezifische Richtwerke
Bauingenieure beurteilen die Gebrauchstauglichkeit bezüglich dreier Aspekte: Funktionstüchtigkeit, Aussehen des Bauwerks und von den Benutzern erwarteter Komfort. Gemessen wird sie anhand von Kriterien wie Schwingungen, Rissbildung und Verformungen, wobei Letzteres zu den am häufigsten diskutierten zählt. Es sind die Verformungen, die beispielsweise das Aussehen oder die Funktionstüchtigkeit des Bauwerks wegen Schäden an Einrichtungen beziehungsweise an nichttragenden Bauteilen beinträchtigen können. Für jedes Kriterium – und unabhängig von den drei Aspekten – werden die Gebrauchsgrenzen für die jeweils verifizierten Bemessungssituationen, die alle vorhersehbaren Bedingungen während der Nutzung und Ausführung eines Bauwerks einschliessen sollen, festgelegt. Die qualitative und die quantitative Entwicklung der Regeln in den Tragwerksnormen des SIA orientiert sich an Erfahrungswerten aus der Praxis – sowohl hinsichtlich Bemessungssituationen als auch bezüglich Bemessungskriterien und deren Grenzen. Darum sollten die Angaben der Gebrauchsgrenzen nur im Sinne von Richtwerten interpretiert werden – sie müssen fallweise hinterfragt und eventuell angepasst werden.
Bei heute geläufigen Spannweiten bei Flachdecken von 7 bis 10 m bedeutet der Wert l/350 beispielsweise 20 bis 30 mm Durchbiegung beziehungsweise etwa 6 ‰ Auflagerdrehwinkel. Eine detaillierte Berücksichtigung der Konstruktion und der Situation erfolgt aber höchstens in allgemeinen Anmerkungen wie: «Wenn Einbauten besonders empfindlich auf Verformungen des Tragwerks reagieren, sind neben oder anstelle von bemessungstechnischen vor allem auch konstruktive Massnahmen gegen Beschädigung vorzusehen.» Die zu erwartenden Durchbiegungen müssen kritisch analysiert und geprüft werden. Wird der Vergleich zwischen verlangten und auftretenden Durchbiegungen ohne Absprache mit allen am Projekt Beteiligten gemacht, kann dies zu Missverständnissen und damit zu grossen Problemen führen.
Vorabklärungen an planerischen Schnittstellen
Aus Erfahrung besteht in der Planung grosser Bedarf an Vorabklärungen sowohl in der Phase der Projektierung als auch während der Vorbereitung der Ausführung. Auswirkungen der zu erwartenden Verformungen auf die Nutzung und auf die nichttragenden Bauteile oder Einbauten müssen beispielsweise während der Projektierung erfragt und geklärt werden. Allenfalls notwendige konstruktive Massnahmen wie Überhöhung oder Anschlüsse an nichttragende Bauteile können dann rechtzeitig geplant werden. Im Rahmen der Ausführungsvorbereitung müssen die Planer zum Beispiel die Einbausequenzen von Tragwerksteilen und nichttragenden Bauteilen analysieren, den Einbau der Beläge ermitteln (Oberfläche horizontal oder der Durchbiegung folgend) oder sicherstellen, dass bei überhöhten Stahlbetondecken auch die Oberfläche überhöht abtaloschiert wird.
Beispiel 1: Glasfassade auf „weichen“ Deckrändern
In einem Laborgebäude in Basel werden die Deckenlasten auf der Vorderseite des Gebäudes zu den Randstützen der vierstöckigen Glasfassade abgetragen. Die Stützenlasten werden im Erdgeschoss von einem weit gespannten, einfeldrigen Stahlfachwerkträger mit beidseitiger Auskragung abgefangen (Bilder 2 und 3) und schliesslich über zwei Stützen in die Untergeschosse abgetragen. Damit ein einheitliches Fassadenbild entsteht, sind der Fachwerkträger wie die Stützen in die Glaskonstruktion eingebunden (Bild 4). Im Vergleich zu den punktgestützten Innenbereichen der Flachdecken stellt die Abfangung eine «weiche» Auflagerung der Deckenränder dar. Die Verformungen im Bereich der Glasfassade beeinflussen deshalb die Konzeptentwicklung des Tragwerks und dessen konstruktive Durchbildung und Ausführung wesentlich. Obwohl die rechnerischen Durchbiegungen des annähernd geschosshohen Fachwerkträgers äusserst gering und die Richtwerte gemäss der SIA-Norm weit unterschritten waren, mussten die Planer während der Projektierung objektspezifische Abklärungen vornehmen. Sie berechneten am Modell, welche Durchbiegungen im quasi-ständigen und welche im häufigen Lastfall entstehen. Um den detaillierten Montagevorgang zu planen, ermittelten sie die zu erwartenden Verformungen vor und nach der Montage der Glasfassade. Aus der Bewegung ergab sich die zeitliche Abfolge für den Einbau der Deckenauflasten (Bodenbeläge) und der Fassadenlasten. Ausserdem mussten sie die Extremwerte der Verformungen infolge seltenen Lastfalls ermitteln, die zu irreversiblen Schäden an der Glasfassade führen. Die Resultate bildeten die Grundlage für die Ausbildung der Anschlüsse der Glasfassade an die Tragstruktur.
Aus der Koordination und Lösungsfindung während der Projektierung entwickelten sich die Vorgaben für die Ausführung – und wiederum neue Fragen: Wie gross ist die initiale Überhöhung des Fachwerkträgers vorzusehen? Wie sind die Betondecken der Obergeschosse zu schalen und zu betonieren? Wie müssen die Oberflächen abtaloschiert werden, horizontal oder der infolge der zunehmenden Betonlasten von Geschoss zu Geschoss abnehmenden Überhöhung folgend? Diesen eher ungewöhnlichen Fragestellungen überlagern sich die eher alltäglichen Problemstellungen, hervorgerufen durch unterschiedliche Anforderungen an die Massgenauigkeiten im Ortbetonbau und im konstruktiven Glasbau.
Diskutiert wurde auch die Lage der Wärmedämmschicht: Der Fachwerkträger ist den Temperatureinwirkungen im Freien, die Betondecken sind dem Innenraumklima ausgesetzt. Ein statisch wirksamer Verbund von Betondecke und Fachwerkträger erzeugt infolge unterschiedlicher Temperaturen von Obergurt (im Gebäudeinnern) und Untergurt (im Freien) Krümmungen im Querschnitt und somit jahreszeitlich schwankende Trägerdurchbiegungen. Da solche zusätzlichen und veränderlichen Durchbiegungen von der Glasfassade nicht aufgenommen werden können, war ein konzeptioneller Entscheid notwendig: Der Träger musste von der Betondecke konstruktiv getrennt und in seiner Längsrichtung beweglich gelagert werden.
Beispiel 2: Weit gespannte Betondecken
Im polygonalen Grundriss des Bürogebäudes in Zürich ist die Hauptnutzung der Geschosse grundsätzlich entlang der Fassaden in die Raumtiefe angeordnet. Die nichttragenden Bürotrennwände sind radial beziehungsweise senkrecht zur Fassade und damit parallel zur Tragrichtung der Decken ausgerichtet. Sie folgen somit der Deckensenkung, müssen aber trotzdem die Deckenverformungen (Bild 5) unbeschadet aufnehmen können. Den möglichen Lösungsansatz beeinflussten neben baulich-konstruktiven Kriterien insbesondere auch hohe Anforderungen an die Schalldämmung zwischen den Büroräumen.
Es mussten konstruktive Massnahmen an Wandkopf und -fuss der Bürotrennwände vorgesehen werden, wobei auch die Deckendurchbiegungen auf ein der Problemstellung adäquates Mass zu begrenzen waren. Als massgebend galten die Verformungen nach dem Versetzen der Wände. Nach SIA-Norm wäre bei Spannweiten von 8 bis 10 m und dem gängigen Richtwert von l/350 eine Deckendurchbiegung von rund 25 mm erlaubt. Diese Gebrauchsgrenze war aber hier unter den gegebenen Umständen unzureichend: Die nichttragenden Trennwände wären belastet worden. Die geplanten Durchbiegungen wurden darum reduziert. Während die Durchbiegungen des geschweissten Stahlfachwerkträgers im ersten Beispiel rechnerisch genau vorausgesagt werden konnten, bestimmten bei den Stahlbetondecken in diesem Beispiel verschiedene, mit Unsicherheiten verbundene Parameter die Genauigkeit der zu erwartenden Durchbiegungen. Insbesondere die Streuung der Baustoffeigenschaften bewirkt Unsicherheiten in den Prognosen. Bei Betonbauten sind die erst nach Jahren abklingenden Langzeitverformungen und das mögliche Rissbild, das unter der massgebenden Belastung eintreten kann, die prägenden Faktoren für die effektiv auftretenden Durchbiegungen. In schlaff bewehrten Betondecken können die Langzeitverformungen im gerissenen Zustand durchaus den drei- bis vierfachen Wert der am homogenen Tragwerk ermittelten Durchbiegungen erreichen. Mit einer einmaligen Überhöhung der Schalungen im Bauzustand können die Auswirkungen dieser Langzeitverformungen in Bezug auf die Funktionstüchtigkeit der Trennwände nicht ausreichend gemildert werden, weil sie per definitionem erst lange Zeit nach dem Einbau der Wände eintreten. Lösungsansätze sind vielmehr in der Verminderung der Rissbildung und der Reduktion der Langzeiteinflüsse zu suchen. Dazu gehören baustofftechnologische und ausführungstechnische Massnahmen wie Betonnachbehandlung oder Ausschalfristen, die auf das verminderte Kriechverhalten des Betons hinzielen. Daneben beeinflussen auch konzeptionelle und bemessungstechnische Massnahmen die Rissbildung günstig.
Eine Vorspannung wirkt sich auf das Verformungsverhalten von Betontragwerken in jedem Fall vorteilhaft aus (Bild 6). Sie erzeugt nach oben gerichtete Umlenkkräfte, die der äusseren Belastung entgegenwirken. Zudem überdrückt sie den Beton, woraus im Endeffekt ein kleineres Rissmoment und wesentlich geringere Durchbiegungen resultieren.
Mehrwert durch Reflektieren
Die Um- und Durchsetzung der Anforderungen hinsichtlich Gebrauchstauglichkeit erfordern eine hohe Bereitschaft zu interaktivem Planen und offenem Kommunizieren zwischen den am Planungs- und am Bauprozess Beteiligten. Die sorgfältige Behandlung der Gebrauchstauglichkeit kann aber auch die Stellung des Bauingenieurs als Treuhänder der Auftraggeber aufwerten. Kontrollierte Durchbiegungen können ganz allgemein als Gütesiegel für die Nutzbarkeit der Gebäude angesehen werden. Geringe Verformungen erhöhen die Flexibilität der Nutzung und indirekt auch den Marktwert des Gebäudes – insbesondere dann, wenn Grundausbau und Mieterausbau nicht von der gleichen Trägerschaft übernommen werden.TEC21, Mi., 2008.11.26
26. November 2008 Joseph Schwartz, Paul Lüchinger
Dauerhafter Stahlbeton
Dauerhaftigkeit ist, neben Gebrauchstauglichkeit und Tragsicherheit, eine der zentralen Anforderungen an neue und instand gesetzte Betonbauwerke. Durch konsequente Anwendung des aktuellen Wissensstandes können heute dauerhafte Stahlbetonbauten realisiert werden. Dauerhafte Bauwerke lassen sich aber auch mit einem neuen Konzept, der Mischbauweise mit gezieltem Einsatz von Hochleistungsfaserbeton, auf wirtschaftliche Weise herstellen.
«Bauwerke sind dauerhaft, wenn sie die Anforderungen an Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit im Rahmen der vorgesehenen Nutzung und der vorhersehbaren Einwirkungen, ohne unvorhergesehenen Aufwand für Instandhaltung und Instandsetzung, erfüllen.» Diese Definition in der Norm SIA 260 (2003) fordert, dass ein dauerhaftes Bauwerk während der geplanten Nutzungsdauer keine die Tragsicherheit oder die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigende Schädigung erfährt. Dauerhaftigkeit ist eine Bauwerkseigenschaft während einer gewissen Zeitspanne und wird somit durch Zeiteinheiten beschrieben.
Die Erhaltung der Substanz bestehender Bauwerke bindet bereits heute grosse finanzielle Mittel. Dauerhafte Bauwerke sind deshalb volkswirtschaftlich interessant und im Sinne der Nachhaltigkeit unumgänglich. Ungenügende Dauerhaftigkeit von Betonbauten (Bild 1 zeigt ein eindrückliches Beispiel) kann heute nicht mehr auf mangelndes Sachwissen zurückgeführt werden. Mit dem aktuell verfügbaren Fachwissen lässt sich Dauerhaftigkeit ohne weiteres erreichen, falls die am Bau Beteiligten diszipliniert und professionell zusammenarbeiten (bezüglich der Qualität und des guten Umgangs am Bau siehe TEC21 46 / 2008). Im Folgenden werden einige aktuelle «Konzepte und Rezepte» zur Gewährleistung der Dauerhaftigkeit von Betonbauten erläutert. Dabei werden die relevanten Angaben in den heute gültigen Normen ergänzt und erweitert.[1]
Konzepte für dauerhafte Bauwerke aus Stahlbeton
Die meisten Schädigungsprozesse an Bauwerken, die die Dauerhaftigkeit gefährden, werden durch direkten Wasserkontakt und Feuchtigkeiten grösser als 90 % stark begünstigt. Demzufolge haben die Massnahmen zur Gewährleistung der Dauerhaftigkeit mehrheitlich zum Ziel, potenziell schädliche Nutzungsbedingungen zu vermeiden. Die Wirksamkeit dieser Massnahmen ist in allen Phasen im Lebenszyklus eines Bauwerks (Projektierung, Ausführung und Erhaltung) auf Grund des folgenden Kriteriums nachzuweisen:
Anforderungen ≤ Leistungsvermögen Geplante Nutzungsdauer ≤ Dauerhaftigkeit
Dieser Nachweis erfolgt qualitativ, denn die erforderliche Dauerhaftigkeit soll nicht berechnet, sondern durch vernünftig gewählte zeitliche Reserven (analog einem «Vorhaltemass») hergestellt werden. Dazu können grundsätzlich zwei Strategien befolgt werden (Bild 2): – Strategie A: Die Tragwerksteile werden so bemessen und konstruiert, dass sie während der Nutzungsdauer keine Instandsetzung (Reparatur) benötigen. Diese Strategie ist in der Regel für das Tragwerk sowie feste Komponenten von Ausrüstungsteilen zweckmässig. – Strategie B: Während der Nutzungsdauer werden in regelmässigen Intervallen geplante Instandhaltungsarbeiten (Unterhalt) ausgeführt, etwa für Verschleissteile von Ausrüstungsteilen, Oberflächenschutzsysteme oder Bestandteile, die einer Abnutzung ausgesetzt sind. Die im Folgenden beschriebenen Massnahmen zur Gewährleistung der Dauerhaftigkeit von Betonbauten bezwecken im Wesentlichen: – einen möglichst dichten oberflächennahen Beton herzustellen, – einen genügenden Korrosionsschutz des Bewehrungsstahls zu gewährleisten, – einen Oberflächenschutz zu applizieren.
Dichter oberflächennaher Beton
Je dichter der oberflächennahe Beton ist, umso grösser ist sein Widerstand gegenüber dem Eintrag von Wasser, Chloriden und anderen Stoffen. Diese Betoneigenschaft soll jedoch nicht nur gefordert, sondern auch bei der Qualitätssicherung nachgewiesen werden. Dies wurde als weltweites Novum in der Norm SIA 262 (2003), Ziffer 6.4.2, verankert. Die Dichtigkeit des oberflächennahen Betons kann gemäss vier Permeabilitätsklassen PK1 bis PK4 (Bild 3) beschrieben werden, entsprechend dem Koeffizienten der Luftpermeabilität kT nach der Torrent-Messmethode2 gemäss Norm SIA 262/1 Anhang E (2003) und dem elektrischen Widerstand ρ des Betons.
Die geforderte Permeabilitätsklasse wird in Abhängigkeit der Expositionsklasse gemäss SIA 262 (2003) Tabelle 1 festgelegt. In jedem Fall ist heute wenigstens die Permeabilitätsklasse PK3 zu fordern, was bei einer fachgerechten Ausführung mit herkömmlichem Beton ohne weiteres erreichbar ist. Bei starker Exposition ist PK2 zu fordern. Die Klasse PK1 kann auch mit verbessertem, herkömmlichem Beton nicht erreicht werden. Falls die erreichte Dichtigkeit des oberflächennahen Betons den Anforderungen nicht genügt, kann der erforderliche Widerstand gegen den Eintrag von Wasser und von chemischen Substanzen beispielsweise mit einem Oberflächenschutz erreicht werden. Die Dichtigkeit des oberflächennahen Betons sollte zusammen mit der Bewehrungsüberdeckung nicht nur bei der Bauausführung im Rahmen der Qualitätssicherung gemessen werden, sondern als wichtigste Kenngrössen der Dauerhaftigkeit auch bei der Zustandsüberprüfung von bestehenden Betonbauten systematisch erfasst werden.
Korrosionsschutz der Bewehrung
Als Schutz vor Bewehrungskorrosion werden in den heutigen Normen einzig Werte für die Stärke der Bewehrungsüberdeckung in Abhängigkeit der Exposition angegeben.[6] Ein genügender Korrosionsschutz der Bewehrung kann jedoch auf verschiedene Weise hergestellt werden. Bild 4 zeigt schematisch eine stark exponierte, chloridhaltigem Spritzwasser ausgesetzte Wand und mögliche Korrosionsschutzmassnahmen für die Bewehrung: – Seit einigen Jahren werden vereinzelt hochlegierte, «nichtrostende» Betonstähle (Stahl 1.4571, 1.4462, 1.4301) oder weniger hochlegierter Betonstahl (Stahl 1.4003) mit erhöhtem Korrosionswiderstand als direkt wirkende Massnahme für Bauteile eingesetzt, die starken Umwelteinflüssen ausgesetzt sind.
– Indirekt wirkende Massnahmen betreffen den Überdeckungsbeton als Korrosionsschutzschicht für den Betonstahl, insbesondere seine Permeabilität und Schichtstärke, sowie verschiedene Oberflächenschutzmassnahmen. In Verbindung mit herkömmlichem Betonstahl genügen sie in der Regel nur bei mittlerer und schwacher Exposition. Bild 7 zeigt die erforderliche Betonüberdeckung zur Gewährleistung eines über 100 Jahre genügenden Korrosionswiderstands für chloridbeanspruchte Bauteile in Abhängigkeit der Stahlsorte, der Expositionsklasse sowie der Permeabilitätsklasse des oberflächennahen Betons. Die Werte stammen aus Simulationsrechnungen, die zur Ermittlung der Wahrscheinlichkeit der Initiierung von Bewehrungskorrosion durchgeführt wurden.[1, 3]
Funktion des Oberflächenschutzes
Bei stark aggressiven Einwirkungen ist neben der Dichtigkeit des oberflächennahen Betons und einer ausreichenden Bewehrungsüberdeckung oft noch ein zusätzlicher Schutz erforderlich. Dies vor allem auch, weil bei der Bauausführung mit Fehlern zu rechnen ist. Die Applikation eines Schutzsystems auf der Betonoberfläche kann dabei eine wirkungsvolle Massnahme sein. Oberflächenschutzsysteme sollen den Feuchtigkeitszutritt begrenzen, um Bewehrungskorrosion und andere Schädigungen wegen zu hoher Betonfeuchtigkeit zu vermeiden. Junger Beton weist ein zusätzlich erhöhtes Wasseraufnahmevermögen auf und ist folglich vor allem durch Frostschäden verletzbar. Eine Hydrophobierung des jungen Betons ist eine sinnvolle Schutzmassnahme, denn sie verhindert die Wassersättigung des oberflächen-nahen Betons. Exponierte Betonoberflächen sollten deshalb heute systematisch hydrophobiert werden. Dabei ist eine Tiefenhydrophobierung zu fordern und anhand von Aufsaugversuchen auch nachzuweisen[4] (Bild 5).
Neuartige Mischbauweise mit hochleistungsfähigem Faserbeton
Ist es sinnvoll, alle Querschnitte von Stahlbetonbauten aus demselben Beton herzustellen? Aus der Überlegung, welche Bereiche wie beansprucht sind, folgt, dass die Verwendung nur einer Betonqualität nicht effizient sein kann. Turbinenschaufeln und andere technische Bauteile bestehen häufig auch aus unterschiedlichen Materialqualitäten. Die Mischbauweise, bei der «höherwertige» Baustoffe in stark beanspruchten Bereichen eingesetzt werden, ist ein neuartiges Konzept im Betonbau. Dabei werden die als Schwachpunkte bekannten Bereiche eines Bauwerks mit Hilfe von verbesserten Baustoffen verstärkt. Ultrahochleistungsfähiger Faserbeton (UHFB) ist ein verbesserter, nicht herkömmlicher Baustoff. Er zeichnet sich durch eine hohe Dichtigkeit (PK1), hohe Festigkeiten und Rissefreiheit bis zu Verformungen von 1.5 – 2.5 ‰ aus. Damit können tragende und gleichzeitig wasserdichte Membranen von 30 mm bis 60 mm Stärke auf diejenigen Bereiche aus herkömmlichem Stahlbeton aufgebracht werden, die durch Umwelteinflüsse oder hohe Kräfte stark beansprucht werden. Mit dem hochwertigen Baustoff können so die Schwachpunkte der Betonbauweise eliminiert und das Bauwerk insgesamt aufgewertet werden. Die Konzeptidee, die sich auf eine über achtjährige Forschung abstützt, wurde bereits mehrmals bei der Instandsetzung von Betonbauten unter Baustellenbedingungen umgesetzt.[5] Das Potenzial dieses Konzepts besteht darin, den Bauvorgang zu vereinfachen, die Bauzeit zu verkürzen und insbesondere die Dauerhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit der Bauwerke deutlich zu verbessern. Dies ist vor allem bei Erhaltungsmassnahmen interessant, denn dadurch können die Bauzeit und damit die Benutzerkosten wesentlich reduziert werden. Obwohl der Materialpreis für UHFB sehr hoch ist, müssen bei dessen Anwendung die Baukosten deshalb nicht höher sein als bei den heute üblichen Methoden. Überlegungen zu Systemen und Bauweisen sind Erfolg versprechender als das traditionelle, auf den reinen «m3-Materialpreis» reduzierte Denken.
Entwurf einer Brücke in Mischbauweise
Ein Beispiel für die beschriebene Mischbauweise ist das Neubauprojekt für eine Autobahnüberführung in Deutschland.[6] Die 46 m lange, 2-feldrige Strassenüberführung wurde nachdem Prinzip entworfen, UHFB einzig in den stark exponierten Tragwerksbereichen einzusetzen (Bild 8), d. h. für die Oberfläche der Fahrbahnplatte, für die Brückenkappen sowie für den Bereich des mittleren Auflagers. Alle anderen Teile des Brückentragwerks verbleiben in herkömmlichem Stahlbeton, denn sie weisen nur eine mittlere Exposition auf. Das Bauprogramm für den Überbau sieht eine Bauzeit von nur 30 Tagen vor. Zuerst werden die vorfabrizierten, vorgespannten Hauptträger montiert. Der Raum zwischen den Trägern über dem Mittelauflager wird mit UHFB aufgefüllt, wobei gleichzeitig ein UHFB-Gelenk hergestellt wird (Bild 9). Danach werden die Längsfugen zwischen den vorfabrizierten Trägern mit demselben Baustoff ausgegossen, und eine 3 cm dicke UHFB-Schicht wird als Abdichtung auf der gesamten Fahrbahnplatte aufgebracht. Die Brückenkappenelemente werden in UHFB vorfabriziert und auf der Fahrbahnplatte mit einem Epoxidkleber befestigt. Abschliessend wird der Strassenbelag eingebracht. In diesem Beispiel wird UHFB in unterschiedlichen Zusammensetzungen als Ortbeton und in der Vorfabrikation eingesetzt.
Anmerkungen
[1] Brühwiler, E., Denarié, E., Wälchli, T., Maître, M., Conciatori, D.: Dauerhafte Kunstbauten bei geringem Unterhalt – Ausgewählte Kapitel. VSS-Bericht Nr. 587, VSS Zürich, 2005 (mit «Empfehlungen für dauerhafte Kunstbauten bei geringem Unterhalt» [nicht veröffentlicht])
[2] Torrent, R., Frenzer, G.: Studie über Messmethoden zur Messung und Beurteilung der Kennwerte des Überdeckungsbetons auf der Baustelle. VSS-Bericht Nr. 516, VSS Zürich, 1995
[3] Conciatori D.: Effet du microclimat sur l’initiation de la corrosion des aciers d’armature dans les ouvrages en béton armé. Thèse no 3408, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse, 2005
[4] Meier, S.J., Wittmann, F.H.: Hydrophobieren von Betonoberflächen – Empfehlungen für Planung und Applikation. VSS-Bericht Nr. 591, VSS Zürich, 2005
[5] Brühwiler, E., Denarié, E., Oesterlee, C.: Hochleistungsfähiger Faserfeinkornbeton zur Effizienzsteigerung bei der Erhaltung von Kunstbauten aus Stahlbeton. VSS-Bericht, Forschungsauftrag AGB 2005/004, VSS Zürich, (zur Publikation vorgesehen)
[6] Brühwiler, E., Fehling, E., Bunje, K., Pelke, E.: Design of an Innovative Composite Road Bridge Combining Reinforced Concrete with Ultra-High Performance Fibre Reinforced Concrete. Proceedings, IABSE Symposium «Improving Infrastructure Worldwide». Weimar, 19.–21. September 2007TEC21, Mi., 2008.11.26
26. November 2008 Eugen Brühwiler