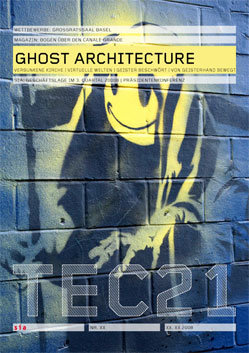Editorial
«The ghost story is indeed virtually the architectural genre par excellence, wedded as it is to rooms and buildings ineradicably stained with the memory of gruesome events, material structures in which the past literally ‹weighs like a nightmare on the brain of the living›. [...] urban renewal seems everywhere in the process of sanitizing the ancient corridors and bedrooms to which alone a ghost might cling.»[1]
Wenn Kosmologen von Geistern reden, meinen sie Weltmodelle, die physikalisch absurde Dinge prognostizieren. Doch gäbe es ohne die Wissenschaften keine Science-Fiction.[2] Umgekehrt schliesst sich der Kreis zur Fiktion, zur Zeitmaschine von H.G. Wells, wenn Virtual-Reality-Technologie künftige Bauprozesse virtuell vorwegnehmen, sie abbilden, kontrollieren und optimieren kann («Virtuelle Welten»). Rückkoppelung ist auch das Thema der Medientechniker, die in der Oper «Der Jude von Malta» die Vision eines Cyberstaates «verwirklichten», indem sie den Protagonisten mittels Interaktivität zu einem «wandelnden Knoten»[3] machten («Von Geisterhand bewegt»).
1984 erweiterte Philip Johnson sein «gebautes Tagebuch», das 1949 mit dem Glass House seinen Anfang genommen hatte, um das «Ghost House» – einen Maschendrahtverhau über einem Lilienbeet. Das Stahlgerüst evozierte die Urhütte, Frank Gehry widmete Johnson die Maschendrahthülle, und das Lilienbeet mag man als Anspielung auf ein Grab deuten. Die Geister der Menschen, die einst ein vernachlässigtes Viertel in San Francisco bewohnten, beschwor die Performance «Ghost Architecture» herauf, indem ihre zerstörten Wohnungen «nachgebildet» wurden («Geister beschwört»).
2007 gewannen InsiteEnvironments den Wettbewerb für die Aufwertung eines ehemaligen Industrieareals in Sheffield, das von zwei Kühltürmen geprägt wird, die abgerissen werden sollen. InsiteEnvironments möchten die hyperbolischen Konturen der Türme mit einer Stahlgitternetzskulptur nachzeichnen, um das industrielle Erbe Sheffields zu versinnbildlichen. Auf ähnliche Weise wollen Anne Niemann und Johannes Ingrisch eine Kirche, die in der Nordsee versank, verkörperlichen («Versunkene Kirche»).
«The ghost story is indeed virtually the architectural genre par excellence.» Isn’t it?
Rahel Hartmann Schweizer
Anmerkungen
[1] Frederic Jameson, The Brick and the Balloon, S. 187, in: ders., The Cultural Turn – Selected Writing on the Postmodern, 1983–1998. Verso, London/New York, 1998
[2] Michio Kaku: Die Physik des Unmöglichen: Beamer, Phaser, Zeitmaschinen. Rowohlt, 2008, S. 11
[3] Ders., Zukunft svisionen. Wie die Wissenschaft des 21. Jahrhunderts unser Leben revolutionieren wird. Knaur, München, 1998. Kaku beschreibt die Vision von Menschen als wandelnden Knoten in einem weltweiten und allgemein zugänglichen Internet.