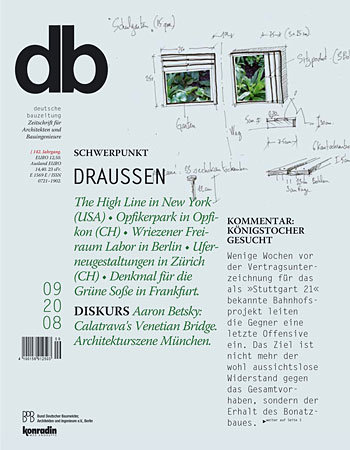Editorial
Nicht nur das Wohnen in der Stadt ist unlängst wieder attraktiver geworden – auch ein neuer Umgang mit Grün- und Freiflächen im urbanen Raum geht damit einher: Teilweise entstehen neue Parkanlagen – wie es uns die Stadt Zürich vormacht – zeitgleich zur Bebauung und oft auch auf kleinen Flächen, Stadt»strände«, Kunstprojekte und Selbsterntegärten entwickeln eine scheinbar magische Anziehungskraft, wieder zugänglich gemachte Flussufer laden zum Verweilen oder gar Baden ein. Die kleinen Oasen im Großstadttrubel ermöglichen »zentrale« Naherholung. Zugleich sind sie Kommunikationsplattform und soziales Bindeglied – gestaltete Außenräume mit vielerlei Facetten und Funktionen und eine neue Herausforderung für Landschaftsarchitekten. cf
Inhalt
Diskurs
03 Kommentar: Stuttgart - Königstocher gesucht | Elisabeth Plessen
06 Magazin
12 On european architecture: A gentle leap - Calatrava's venetian bridge | Aaron Betsky
14 Im Blickpunkt: Münchner Architekturgeschichten | Matthias Castorph
Schwerpunkt
Draussen
19 Zum Thema – Formen und Nutzung urbaner Grün- und Freiflächen | Claudia Moll
22 Opfikerpark in Opfikon (CH) von Planungsgemeinschaft Büro Kiefer und Büro Hager | Sabine Wolf
30 »The High Line« in New York (USA) von Field Operations Architekten: Diller Scofidio Renfro | Fred Bernstein
38 Denkmal für die Grüne Sosse in Frankfurt/M. von Olga Schulz | cf
40 Vier Uferneugestaltungen in Zürich (CH) von asp; Rotzler Krebs Partner; Schweingruber Zulauf | Claudia Moll
50 »Wriezener Freiraum Labor« in Berlin von tx – büro für temporäre architektur | Mathias Remmele
56 … in die Jahre gekommen: Olympiapark in München; Günther Grzimek in Kooperation mit Günter Behnisch & Partner | Ira Mazzoni
59 db-Ortstermin: München
Empfehlungen
64 Kalender
Ausstellungen: Alvar Aalto (München) | Karl J. Habermann
65 Sep Ruf (München) | Karl J. Habermann
66 Neu in …
...Berlin | Claus Käpplinger
...Chemnitz | Elisabeth Plessen
...Stuttgart | Ulrike Kunkel
68 Bücher
Trends
Energie
70 Energetische Sanierung, Teil 1: Alternativen zur Aussendämmung historischer Fassaden | Thomas Dittert
Ökonomie
76 Risiken und grenzen von ppp-modellen | Gudrun Escher
E-Technik
78 Konferenzsysteme | rm
Produkte
Produktberichte
80 Dämmen, Beschichten, Freianlagen | rm
86 Infoticker | rm
88 Schaufenster Aussenbeläge | rm
90 Schwachstellen: Durchfeuchtete Flachdächer | Rainer Oswald
Anhang
96 Planer / Autoren
98 Vorschau / Impressum
Und mittendrin ein Park
Der in Zürichs Nachbarstadt Opfikon gelegene »Glattpark« ist mit 670 000 Quadratmetern das größte Entwicklungsgebiet der Schweiz. Hier wird noch bis 2015 ein ganzer Stadtteil neu erbaut. Sein Zentrum bildet bereits heute der Opfikerpark mit einem rechteckigen, über fünfhundert Meter langen See. Mit dieser Dimension und einem klaren, äußerst großzügigen und minimalistischen Entwurf entwickelt die Anlage ein starkes Bild einer Landschaft, das der heterogenen Struktur der Umgebung wohltuend entgegenwirkt.
Das Glattal nördlich der Stadtgrenze Zürichs ist eine jener Regionen, die zum Synonym für fraktale, urbane Stadtlandschaften geworden sind. Eine Region, die bestimmt ist durch das »Dazwischen« – zwischen Siedlung und Brache, Un- und Umnutzung, zwischen Autobahn, Klär- und Müllverbrennungsanlage, Fernsehstudio, Wohn- und Bürobauten sowie den Gleisen der neuen Glattalbahn. Inmitten dessen liegt nun der Opfikerpark.
Beinahe fünfzig Jahre währte die Planungsdiskussion um die »teuerste Wiese Europas«. Mitte der neunziger Jahre fiel die Entscheidung, die seit 1946 drainierte Sumpffläche, das ehemalige Oberhauserriet, mit einem urbanen Mischquartier – mit Wohn- und Arbeitsraum für je 7000 Personen – zu überbauen. Als Ausgleich zur verdichteten Bauweise wurde im Quartierplan eine 12,4 Hektar große Parkanlage mit See ausgewiesen, eine gigantische Dimension für die Schweiz! Den 2001 ausgelobten Wettbewerb einer »regionalen Parkanlage« gewann das Berliner Büro Kiefer, seit seiner Gründung 1989 eines der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Landschaftsarchitekturbüros. Das Zürcher Büro Hager, mit dem Kiefer, zusammen mit den Fachplanern, eine Planungsgemeinschaft bildete, übernahm die lokale Projektbetreuung und -koordination. Nach einer Bauzeit von eineinhalb Jahren und Baukosten von rund 16,5 Millionen Schweizer Franken (10,2 Millionen Euro) feierte der Park im Dezember 2006 Eröffnung.
Klar zonierter Streifen
Kiefers Projekt reagiert auf die heterogene Umgebung mit einem großzügigen und ruhigen Entwurf einer klar strukturierten Parkanlage: einer linearen, lang gestreckten Sichtbeton- »Skulptur« aus Rampen und Scheiben, flankiert von einer Promenade auf der einen und einer Wiese auf der anderen Längsseite. An den Kopfenden, eingespannt zwischen der Haltestelle Fernsehstudio der Glattalbahn im Süden und der Autobahn im Norden, reihen sich verschiedene Funktionsfelder aneinander. Das Zentrum bildet ein riesiges Wasserbecken, 550 Meter lang, 41 Meter breit und in der Mitte drei Meter tief. Seinen Anfangs- und Endpunkt markieren Plätze: Am urbanen südlichen Siriusplatz tauchen, wie Bootsrampen, nebeneinanderliegende Betonkeile unterschiedlicher Länge und Breite ins Wasser ein. Am gegenüberliegenden Beckenende läuft ein leicht ansteigender Sandstrand in einem Beachvolleyballfeld aus, an das sich ein asphaltiertes Basketballfeld und der nördliche Platz, möbliert mit einer Tischtennisplatte, anschließen. Hier wird das Rampenmotiv wieder aufgenommen und die lineare Form konsequent in einer auf fünf Meter Höhe steil ansteigenden Sichtbetonrampe weitergeführt. Sie formt sich zu einem Aussichtsplatz aus und steigt an dessen rückwärtigem Ende senkrecht auf knapp zehn Meter weiter empor – integriert in den Lärmschutzwall zur dahinter liegenden Autobahn.
Ebenso klar wie die Formen und Elemente der Anlage sind auch die Beläge – Sichtbeton und wassergebundene Decke mit anthrazitfarbener feiner Kiesschüttung. Der entwurfsprägende Minimalismus ist in der Pflanzenverwendung fortgeführt – Platanen (Platanus hispanica), Schilf (Phragmites australis) und Intensivrasen dominieren. Die Anlage hat trotz oder gerade aufgrund ihrer Rigidität großen Charme. Dies liegt vor allem daran, dass sie nicht der Schau, sondern der Nutzung dient – die Rampen laden zum Skaten ein, die häufig als zu wuchtig kritisierten Brückengeländer zum Sprung ins Wasser, die Betonkeile im Süden zum Sitzen und Verweilen – stets als Angebot formuliert, das angenommen werden kann, und stets offen für eigene Ideen der Gäste.
Ein Fuß- und Radwegenetz, das die orthogonalen Strukturen des Baugebietes aufnimmt, ist verbindend über Bebauung und Park gelegt. Sein Hauptelement ist die 7,70 Meter breite Hamilton-Promenade, an die zu Stufen ausgebildete Betonrampen und ein flach ins Wasser abfallender Sandstrand anschließen. Wo die aus der zonal gegliederten Bebauung herausführenden Wege auf die Promenade stoßen, schieben sich platanenbestandene Kanzeln in den See, dreiseitig gerahmt durch brüstungshohe Sichtbetonscheiben. Drei Metallstege überspannen den See orthogonal von den Kanzeln aus.
Ein zweireihiges Schilfband entlang des östlichen Ufers ist Gestaltungselement und fungiert zugleich als Kleinst-Kläranlage: Es entzieht dem Wasser Nährstoffe und sichert dadurch die hohe Wasserqualität des primär durch Regenwasser gespeisten Sees. In naturnahen Nischen des Schilfbandes wachsen Sumpfschwertlilie (Iris pseudoacorus), Froschlöffel (Alisma plantago-aquatica) und Pfeilkraut (Sagittaria sagittifolia). Die anschließende offene Liegewiese grenzt an den »Technik-Wald-Archipel«, wie ihn Gabriele Kiefer in ihrem Entwurf genannt hat. Hier liegt, versteckt hinter zum Teil neu aufgeforsteten Bäumen, ein Relikt des ehedem fraktalen Ortes: Das ursprüngliche Klärwerk, das, frisch saniert, als Tagungszentrum gemietet werden kann.
Landschaftsarchitektur als Motor
Der von der Stadt Opfikon betriebene Park genießt bereits heute große Akzeptanz in der Bevölkerung. Während die Angestellten in den umgebenden Bürogebäuden die nüchterne Noblesse von Promenade und Siriusplatz schätzen, ist der See eine regionale Attraktion. Am Wochenende fahren sogar die Stadtzürcher hierher zum Baden und Entspannen – noch ist der Opfikerpark tatsächlich erholsam und nicht so überlaufen wie die »Badis« an Zürisee und Limmat.
Seinen Erfolg verdankt die Anlage insbesondere drei Faktoren: Erstens der wegweisenden Konzeption des neuen Stadtteils mit der frühzeitigen Fertigstellung des Naherholungsraumes und des Anschlusses an den öffentlichen Nahverkehr. Zweitens dem herausragenden landschaftsarchitektonischen Entwurf mit seiner bildgebenden Klarheit, seiner hohen Flexibilität sowie seinen vielen zulässigen Deutungsmustern und Angeboten. Zentral ist hier das starke Bild, das unsere Räume im »Dazwischen« so häufig vermissen lassen. Ein Bild, das sie eindeutig verortbar macht. Drittens einem Parkmanagement, das auf akute Probleme prompt reagiert: Berechtigten Vorwürfen, der Park biete zu wenig Schatten, zugleich fehle es an Einrichtungen der Nahversorgung, wird mithilfe der »Parklotsen« begegnet. Sie betreiben im Auftrag und in Zusammenarbeit mit der Stadt Opfikon, betreut von der Plattform Glattal – einem Verein für soziale Angebote –, einen mobilen Kiosk auf dem Areal. Hier verleihen sie neben Spielgeräten auch Sonnenschirme, verkaufen Eis und kühle Getränke.
Im Glattal ist die Landschaftsarchitektur nicht nur Beiwerk, sondern wird zum Motor einer zukunftsfähigen Regionalentwicklung. Der Opfikerpark ist kein Solitär, vielmehr eingebunden in ein regionales Freiraumnetz. Er ist einer von mehreren in den letzten Jahren in und um Zürich neu entstandenen Parks (vgl. db 08/07, Parks in Neu-Oerlikon); in direkter Nachbarschaft laufen aktuell mit dem Andreaspark und dem Leutschenpark, der im Herbst 2008 eröffnet wird, zwei weitere Realisierungen. Mit ihnen wird die Agglomeration weiter aufgewertet und die Landschaftsarchitektur als Motor erhält neuen Treibstoff.db, Mo., 2008.09.01
01. September 2008 Sabine Wolf
verknüpfte Bauwerke
Glattpark / Opfikerpark
Endlich mal schlendern!
(SUBTITLE) »The High Line« in New York
Die Todeslinie, wie sie einst die New Yorker nannten, weil täglich Arbeiter auf der ehemaligen Bahnlinie ums Leben kamen, wird in wenigen Monaten als schwebender Garten eröffnet: Mitten in einem durch Hafen und Gewerbe geprägten Teil Manhattans entsteht auf den Überresten der aufgegebenen Hochbahn derzeit der erste Abschnitt eines Parks, der sich in acht Metern Höhe auf mehreren Kilometern zwischen Gebäuden hindurchschlängelt. Die glückliche Verwandlung ist ein Sieg für beherzte Bürger: Um eine Haar wäre die High Line zugunsten einer renditeträchtigen Bebauung abgerissen worden. Nun wird sie wohl dennoch zum Magnet für Immobilienmakler.
Die Eröffnung des Central Parks um 1860 gehörte zu den richtungweisenden Ereignissen, die den Ruf New Yorks als außergewöhnliche Stadt begründeten. Mit dem Park verbesserte sich nicht nur die Lebensqualität der steigenden Zahl von Bewohnern, durch ihn kam auch in die Immobilienpreise eine hierarchische Ordnung: Häuser und Wohnungen mit Blick auf den Park waren plötzlich mehr wert als andere Grundstücke in derselben Gegend. Tatsächlich erwies sich die Wertschöpfung, die durch den Park entstand, als weit höher als die Kosten für seine Anlage.
Der Park als Immobilienmagnet
Ähnliches scheint jetzt im kleinteiligen Meat Packing District und in einigen Vierteln von West Chelsea im äußersten Südwesten Manhattans zu geschehen. Zwar wird der Park, der dort zurzeit entsteht, nur 2,8 Hektar umfassen, der Central Park hingegen hat 337 Hektar. Aber dieser Park, angelegt auf einer aufgegebenen Hochbahntrasse mit Namen High Line und in einer Gegend, in der ohnehin alles sehr schnell zu geschehen scheint, beeinflusst seine Umgebung schon, bevor er überhaupt fertig ist. Der erste Bauabschnitt, der sich über achthundert Meter (acht Blocks) von der Gansevoort Street im Süden bis zur 20. Straße erstreckt, wird noch kommenden Winter eröffnet. Auf beiden Seiten der High Line versuchen Immobilienentwickler bereits, sich gegenseitig mit auffälliger Architektur zu überbieten. Unter den neuesten Bauten befinden sich das Standard Hotel von Polshek Partnership Architects, das in der 14. Straße über die High Line gebaut ist, und das HL23, ein Apartmenthochhaus in der 23. Straße, geplant von Neil Denari, einem der aufsteigenden Architektursterne New Yorks. Das Whitney Museum wiederum plant eine Außenstelle entlang der High Line, die von Renzo Piano entworfen werden soll. Mit der »neuen« High Line kommen nun auch die Schönen und Reichen in die Gegend.
Ironischerweise führten aber gerade die Interessen von Immobilienspekulanten beinahe zum Abriss der High Line. Gebaut in den dreißiger Jahren, um Waren zwischen den Lagerhallen von West-Manhattan hin- und herzutransportieren, wurde sie Ende der siebziger Jahre stillgelegt. Ungenutzt verkam sie zu einem rostigen Koloss. Das weckte Begehrlichkeiten bei Immobilienentwicklern. Sie setzten durch, dass am südlichen Ende der High Line einige Teile amputiert wurden. Und sie forderten, den Rest ebenfalls abreißen zu dürfen. Beinahe hätte die Stadt zugestimmt.
Initiative zur Umnutzung
Einige visionäre New Yorker jedoch hielten die High Line für ein erhaltenswertes Relikt, nicht nur als Industriearchitektur, sondern auch wegen des Freiraumes, den sie in dieser unersättlichen Stadt offen hält. 1999 besuchten zwei Bewohner der Gegend – der eine ein Künstler (Robert Hammond), der andere ein Schriftsteller (Joshua David) – ein Bürgertreffen und befanden sich schnell mitten in einer Diskussion, wie man die High Line retten könnte. Schon bald hatten sie den Verein »Friends of the High Line« gegründet und warben um Unterstützung für die Erhaltung. Als einer der besten Schachzüge erwies sich die Idee, den Fotografen Joel Sternfeld zu überzeugen, Bilder der High Line zu machen. Diese enthüllten eine verborgene Welt aus Bäumen und wilden Pflanzen, von der die meisten New Yorker nichts wussten. Die eindringlichen Fotos wurden vielfach veröffentlicht und die unberührte Natur acht Meter über Manhattan wurde zum Stadtgespräch.
Bald schon hatten Hammond und David unter anderem mit den Schauspielern Kevin Bacon und Ed Norton sowie der Kochbuchautorin und Societylady Martha Stewart hochkarätige Unterstützung. Gleichzeitig hatten sie Zusagen von der Stadtverwaltung, die High Line nicht nur zu erhalten, sondern sich auch finanziell an Restaurierung und Unterhalt zu beteiligen. Bei einem 2002 organisierten Ideenwettbewerb, zu dessen Jury unter anderem die New Yorker Architekten Steven Holl und Bernard Tschumi gehörten, gingen 720 Entwürfe aus 36 Ländern ein. Zurückzuführen ist die überwältigende Beteiligung einerseits auf die internationale Ausschreibung, andererseits aber auch einfach auf das große Interesse an New York nach 9/11 und die an sich reizvolle Aufgabe. Einer der Sieger, Nathalie Rinne aus Wien, schlug ein 2,5 Kilometer langes Schwimmbecken vor; ein anderer, Hugo Beschoor Plug aus Berlin, eine Konstruktion namens »Black Market Crawler«, die nachts die Schienen auf und ab fahren sollte. Im Jahr darauf organisierten Hammond und David einen zweiten Wettbewerb, der realisierbare Entwürfe bringen sollte.
Sieger in diesem Wettbewerb waren die Landschaftsarchitekten Field Operations zusammen mit den Architekten Diller Scofidio (jetzt Diller, Scofidio Renfro), beide in Manhattan ansässig, und zahlreichen anderen Beteiligten. 2004 wurde ihr Entwurf – ein Spiel kristalliner Formen vor dem Hintergrund üppiger Gärten – im Museum of Modern Art ausgestellt, die Besucher waren beeindruckt. Obwohl manche Skeptiker befürchteten, es werde »gebaut nie so aussehen«, wurde bei einem Baustellenbesuch vor Kurzem klar, dass der Park den Zeichnungen im MoMA in beeindruckender Weise immer ähnlicher wird.
Gestalterische Selbstbeherrschung
Verbindendes Element des 180-Millionen-Dollar-Parks ist ein Bodenbelag aus langen Betonfertigteilen, die jeweils an einem ihrer Enden schmaler zulaufen, so dass in den Zwischenräumen Pflanzen wachsen können. Verschiedenste Arten, von Moosen bis zu wilden Blumen, sollen sozusagen durch den Belag nach oben dringen: eine überzeugende Zusammenführung von Stadt und Natur. Der gezielt mäandernde Fußweg wird zu Wasserbecken führen, zu einem Sonnendeck mit Ausblicken auf den Hudson und zu einem Amphitheater (Bilder 7–10), errichtet über der 10. Avenue, bei dem der sich darunter abspielende Verkehr das Spektakel bildet. Wo die High Line schmaler wird, soll sich 2,50 m über der Ebene der früheren Gleise ein Laufsteg aus Metall erheben (Bild 12). Auf beiden Seiten des Stegs werden Essigbäume (Rhus typhina) wachsen, so dass die Parkbesucher wie in einem Wald unter einem Blätterdach dahinschreiten.
14 weitere Baumarten, darunter Kirschen, Hasel und Mispeln, schlug der niederländische Landschaftsgärtner Piet Oudolf vor. Er plante unterschiedlich feuchte Bereiche, von sumpfigem Land über Moosflächen bis zu unterschiedlichen Wiesen – mit kissenförmig, fächerartig und einzeln wachsenen Gräsern, Blumen mit kräftigen Farben, mit immergrünen, dezent bis bunt blühenden Pflanzen und Kletterpflanzen, vom wilden Wein bis zur Clematis. Der Aufbau des Bodens funktioniert ähnlich wie ein Gründach: Auf dem wasserundurchlässigen Beton, mit dem die High Line gedeckt ist, liegt eine gewellte schwarze Dränmatte, darauf eine Schicht feiner Kies zur Entwässerung. Ein Filtervlies trennt die Kiesschicht vom tonigen, groben Unterboden, der mit mineralreichem Oberboden gedeckt ist. Bis zum Setzen der ersten Pflanzen Anfang Herbst bleibt der Boden gegen Erosion durch Wind und Regen abgedeckt.
Wie die Besucher auf die High Line gelangen, war für die Architekten Diller, Scofidio Renfro die größte Herausforderung. Ihren Entwurf dafür nennen sie »langsame Treppenhäuser« – Stufen mit so sanfter Steigung, dass die Besucher sich beim Hochsteigen automatisch Zeit lassen werden. Auch Aufzüge werden an mehreren Stellen installiert. Die architektonischen Eingriffe sollen derart schlicht sein, dass die High Line eine eigene Dominanz entwickeln kann – und nicht ihre neuen Gestaltungselemente; laut Elizabeth Diller »eine Übung in gestalterischer Selbstbeherrschung«. Die Beleuchtung nah am Boden wird den Park sanft illuminieren, und nicht von der Skyline Manhattans ablenken.
Grüne Dichte überm Stadttrubel
Die Bäume und die übrige Vegetation mögen nicht in blühender Pracht sein, wenn die High Line kommenden Winter der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, aber das gehört zum Plan: Da die Initiatoren zukünftig Besuchermassen befürchten, wollen sie ihr Werk außerhalb der Saison eröffnen. Somit haben sie die Möglichkeit, vor dem erwarteten sommerlichen Ansturm letzte Korrekturen an Einrichtungen und Bepflanzungen vorzunehmen. Sie hoffen, dass sich die Besucher zivil und rücksichtsvoll gegenüber den Grünflächen verhalten werden.
In einer Stadt, in der die Menschen in ständiger Bewegung sind, wird die erhöhte Landschaft »aufgebrochen, fragmentiert; nichts wird gerade sein«, erklärt James Corner, Gründer von Field Operations, die Entwurfsidee. »Der Park wird den Menschen die Möglichkeit zum Schlendern geben.« Für New York wird sich damit wohl ein Traum erfüllt haben.db, Mo., 2008.09.01
01. September 2008 Fred Bernstein
verknüpfte Bauwerke
High Line Park
Badenixen und Zauneidechsen
(SUBTITLE) Vier Uferneugestaltungen in Zürich
Während langsam auch in deutschen Städten ein Trend zur Neugestaltung und »Öffnung« von Flussufern zu verzeichnen ist – etwa in Frankfurt, Ingolstadt oder unlängst in Wuppertal –, verdeutlichen mehrere bereits in den vergangenen vier Jahren realisierte Projekte in Zürich den vorbildlichen Umgang der Stadt mit ihren Flussufern. Diese bietet ihren Bewohnern kurzfristige Naherholung direkt am Wohn- oder Arbeitsort – und das auf bemerkenswert einfache und dennoch großzügige Art und Weise.
Sommers wandelt sich Zürich, allseits eher als korrekte Bankenmetropole bekannt, zu einem wahren Badeparadies. Am See und entlang der zwei die Stadt durchfließenden Flüsse Limmat und Sihl laden zehn Badeanstalten und eine Vielzahl öffentlicher Zugänge zu den Gewässern zum Baden mitten in der Stadt ein. Vor allem die Ufer, an denen sich in der Vergangenheit Fabriken und Lagerhallen angesiedelt hatten, haben sich zu begehrten Bade- und Aufenthaltsorten gewandelt. Die konstant gute Wasserqualität hat bestimmt ihren Anteil an der hohen Beliebtheit. Dass immer mehr neue, öffentlich zugängliche Freiräume am Wasser entstanden, ist aber auch mit einem gesellschaftlichen Wertewandel und damit einher gehenden, neuen Ansprüchen an Erholungsgebiete in der Stadt zu begründen.
Bis heute wurden vor allem an der immer schon prominenteren Limmat – Ausfluss des Zürichsees – Projekte realisiert. Planungen und erste neu gebaute Anlagen zur Aufwertung der Ufer der Sihl – der Fluss, der von einem Seitental herkommend in die Limmat mündet – gibt es jedoch auch.
Wiederentdeckung der Flüsse – Wipkingerpark
In den letzten Jahren weihte die Stadt vier größere Projekte ein, die die neue Wertschätzung der Orte am Wasser verdeutlichen. Seinen vierten Sommer erlebt dieses Jahr der Wipkingerpark. Prägendes Element dieses Freiraums an der Limmat ist eine großzügige Treppenanlage zum Fluss. Sie befindet sich anstelle einer ehemaligen Ufermauer. Der heute intensiv genutzte Hauptteil des Parks war früher nicht mehr als ein Grünstreifen entlang dieser Mauer. Im Laufe der Zeit marode geworden, wollte das Tiefbauamt sie zuerst durch ein Low-Budget-Projekt ersetzen: Der Weg sollte verbreitert werden und eine Grünböschung die Mauer ersetzen. Das AWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) bewilligte diesen Vorschlag nicht und plädierte für mehr Gestaltung. Drei Büros wurden aufgefordert, eine Projektstudie mit Honorarofferte und Ideenskizzen einzureichen, Sieger waren schließlich die Landschaftsarchitekten asp aus Zürich. Zu ihrer ursprünglichen Planung gesellten sich schon bald die Erneuerung des in die Jahre gekommenen Spielplatzes des angrenzenden Gemeinschaftszentrums, eine bessere Anbindung des Parks an den bestehenden Uferweg und eine Neuorganisation der großen Wiese neben dem Spielplatz. Kernstück blieb aber die großzügige Treppenanlage: Auf 180 Metern Länge führen Stufen direkt ans Wasser. Sandsteinblöcke mit rauen Oberflächen unterbrechen an mehreren Stellen die lang gestreckten, glatten Betonbänder. Neben einer visuellen Auflockerung dienen sie als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Genauso der vor den Stufen abgeflachte Flussgrund und die partiell aufgeschütteten Buhnen. Die Geröllpackungen unter den hohl aufliegenden Betonstufen werden zudem von den an der Limmat angesiedelten Zauneidechsen bewohnt.
Die langen Betonstufen haben zwar einerseits eine angenehme, unzürcherische Großzügigkeit. Andererseits kann die Treppenanlage gestalterisch aber auch als unsensibel gewertet werden: Das Projekt nimmt wenig Bezug auf den Fluss und seine Strömung, zudem spendet nur ein Baum auf der gesamten Länge Schatten. Dennoch scheint die Treppenanlage dem Bedürfnis vieler zu entsprechen: Kaum wärmen die ersten Sonnenstrahlen die Stufen, sind sie dicht besetzt von Schülern der angrenzenden Berufsschulen, Beschäftigten des neuen Quartiers Limmat-West und Bewohnern der umliegenden, mit Grünflächen eher unterversorgten Stadtteile. Bis spät in die Nacht wird hier der neue Ort am Fluss genossen.
Lettenareal – Bühne und Tribüne
Nicht weit flussaufwärts lockt ein weiterer beliebter Ort die Bevölkerung ans Wasser. Auch hier herrscht im Sommer Hochbetrieb, der »Oberen Letten« ist Zürichs Badeplatz schlechthin und Bühne und Tribüne für das alltägliche Theater. Ohne Tattoo und Piercing fällt man auf. Der ehemals als Bahntrasse genutzte, schmale Streifen entlang dem Wasserwerkkanal, einem Teil der Limmat, hat eine kontrastreiche Geschichte hinter sich: 1990 wurde der Zugverkehr eingestellt, das Gelände blieb sich selbst überlassen. Es wurde zu einem innerstädtischen Ruderalstandort – eine urspünglich vegetationslose Fläche, bei der sich im Laufe der Zeit wieder Pflanzen und Tiere ansiedelten, die sich am stark der Sonne exponierten Standort wohlfühlten. Und nicht nur das: Bald darauf hatte sich hier die offene Drogenszene eingerichtet, das Gelände wurde trotz zentraler Lage von der Bevölkerung gemieden. Nach der polizeilichen Räumung Anfang 1995 sollte es so schnell wie möglich neu genutzt werden. Die Stadt schlug die Fläche der Erweiterung der Badeanstalt am gegenüberliegenden Flussufer zu. Im Sommer desselben Jahres wurden eine Liegewiese, ein Beachvolleyballfeld und ein Holzrost am Wasser eingeweiht. Gerade sein provisorischer Charakter verlieh dem Ort seinen Charme und ließ ihn schnell zum In-Spot der Zürcher Szene werden. Als 2002 der wenige hundert Meter entfernte Lettentunnel aufgefüllt werden und die ehemalige Bahntrasse für den Zeitraum der Bauarbeiten als Baupiste dienen sollte, gab das Anlass zur Neugestaltung – weg vom Provisorium zu einer standhafteren Gestaltung. Das beauftragte Büro Rotzler Krebs Partner entwickelte ein Konzept, das zwei Hauptnutzergruppen gerecht werden musste: Erholungssuchenden und Eidechsen – auf dem Areal hatten sich in der Zwischenzeit so viele bedrohte Pflanzen- und Tierarten angesiedelt, dass es als kommunales Naturschutzgebiet gilt.
Der östliche Teil des Geländes blieb weiterhin Pflanzen und Tieren vorbehalten. Mit Bahnschotter bedeckt, führt er bis zum zugemauerten Tunnel und ist idealer Lebensraum für die wärmeliebenden und geschützten Zaun- und Mauereidechsen – Barfüssige betreten diesen Abschnitt lieber nicht. Sie nutzen den westlich davon gelegenen Hauptteil mit Liegewiese, Sandflächen, Beachvolleyballfeldern und einem heute für Skater gestalteten Asphaltplatz. Zum etwas tiefer liegenden Uferweg führen Betonstufen, unterbrochen von teils neu gesetzten, teils spontan gewachsenen Bäumen. In einer Reihe fest installierter Container befinden sich während des Sommers eine Bar und ein Restaurant, dessen Außensitzplatz auf dem Dach der Container man über eine breite, hölzerne Freitreppe erreicht.
Obwohl der Holzrost nochmals um 16 Meter verlängert wurde und ein großzügiges Angebot an Liegeflächen besteht, findet man an einem schönen Tag nur schwer ein Plätzchen für sein Handtuch. Die Neugestaltung hat der Beliebtheit des Ortes keinen Abbruch getan. Die neuen Elemente ergänzen die bestehenden wie selbstverständlich. Keine gestalterischen Spielereien, sondern das Potenzial des Ortes – das kühle, stark strömende Wasser des Kanals – steht nach wie vor im Vordergrund.
»Kulturufer« Gessnerallee
Im Sommer 2005 konnte eine weitere Treppenanlage am Wasser der Sihl von der Bevölkerung in Beschlag genommen werden. Sie ist Teil der Außenräume der »Kulturinsel Gessnerallee«. In einer ehemaligen Militärreithalle und ihren Nebengebäuden hat sich seit den siebziger Jahren ein reges kulturelles Leben etabliert: ein Theaterhaus mit Restaurant und Bar auf der einen Seite der Straße, Schauspielakademie und Jugendtheater auf der anderen. Der Komplex liegt an der Spitze der Halbinsel, die Sihl und Schanzengraben bilden, längs geteilt durch die stark befahrene Gessnerallee. Durch den Entschluss der Stadt, unter dem Straßenraum eine Tiefgarage zu bauen, konnten zwei Parkdecks aufgehoben werden, die seit den fünfziger Jahren über den Flussraum kragten. Der Bau der Tiefgarage gab zudem Anlass, die Freiräume an der Oberfläche neu zu gestalten. Auch dieses Projekt planten die Landschaftsarchitekten von Rotzler Krebs Partner, die bereits an der Erstellung des Leitbilds Sihls (siehe nächste Seite) beteiligt waren. Mit einem durchgehenden Materialkonzept vereinheitlichten sie die einzelnen, kleinteiligen Außenräume. Die Stufen zum Wasser und neue Ufermauern bestehen aus grauem Sandstein, derzeit noch kleine Weiden nehmen Bezug zum Standort am Fluss und spenden künftig Schatten. Bis diese Treppenanlage zu einem angenehmen Aufenthaltsort wird, müssen die Bäumchen allerdings noch kräftig wachsen. Zurzeit sind die Stufen der Sonne und den Immissionen der viel befahrenen, angrenzenden Straßen stark ausgesetzt und werden erst zögerlich genutzt. Zudem hat die Sihl ein natürlicheres Geschiebe als die Limmat, was nach Regenfällen braunes Wasser bedeutet. Schwimmer vermochte der Ort noch nicht anzulocken, er wird bislang vor allem von den Schülern der Schauspielakademie während ihrer Mittagspause genutzt.
Schräg gegenüber, auf dem Areal, das heute noch von der Zürcher Hauptpost besetzt ist, soll ab 2010 das Quartier »Stadtraum HB« (Hauptbahnhof) entstehen. Den Wettbewerb für die Außenräume konnten auch Rotzler Krebs Partner für sich entscheiden. Ihren Plänen zufolge wird sich der Neue Bahnhofplatz an seinem flussseitigen Ende mit einer Treppenanlage bis an die Sihl schieben.
Historische Atmosphäre – Fabrik am Wasser
Auf halbem Weg zwischen Wipkingerpark und der nicht weit flussabwärts gelegenen Badeanstalt auf der Werdinsel gibt es seit 2007 eine weitere Bereicherung des Fußweges entlang der Limmat: der Außenraum der Ende 19. Jahrhunderts erbauten Fabrik am Wasser. Das Hauptgebäude der ehemaligen Seidenstoffweberei nutzt heute eine bunte Mischung von Handwerkern und Kreativen als Arbeitsort. Am Platz der 1992 abgebrannten Shedhalle entstand eine Grundschule und unmittelbar daran angrenzend neue Wohngebäude.
Zwischen Gebäudekomplex und Fluss befand sich früher der Fabrikkanal, das darin fließende Wasser formten die Landschaftsarchitekten Schweingruber Zulauf – sie gewannen bereits 1994 den nach dem Brand der Halle ausgelobten Wettbewerb – nach: Rasen-, Kies- und Betonbänder wechseln sich ab, in ihrer dynamischen Form erinnern sie an sanfte Wellen. Die Ufermauer ließen die Planer teilweise abreißen, hier »strömt« der Kanal in Form eines kleinen steinigen Strands in den Fluss. Eine partielle Tieferlegung des Uferwegs ermöglichte diese grundsätzliche Änderung des Außenraums. Das kurze »Strandstück« ist dank des direkten Zugangs zum Wasser eine willkommene Abwechslung am Uferweg, der ansonsten immer über dem Wasserspiegel des Flusses liegt. Die der Flussströmung angepasste Steingröße des Strands eignet sich zwar nicht zum In-der-Sonne-räkeln, Sand wäre hier aber im Nu weggespült.
Limmataufwärts, auf der anderen Seite des an das Haupthaus angebauten Turbinengebäudes, setzt sich das Band des ehemaligen Kanals fort. Hier in Form einer Kiesfläche, die dem Restaurant innerhalb des historischen Baus als Außensitzplatz dient. Ein Spielplatz schließt die lang gestreckte Form ab.
Eschen und Erlen stehen locker gestreut auf dem neu gestalteten Grünstreifen. Ob Passanten und Anwohner den nachgeformten Fabrikkanal als solchen erkennen, ist fraglich. Mithilfe des Bandes konnten die Planer aber der Fülle geforderter Nutzungsarten, klar zoniert, gerecht werden. Zudem bleibt die Geschichte des Ortes – wenn auch nur für Eingeweihte – ablesbar.
Eigenverantwortung statt Vorschriften
Allen Projekten ist eines gemein: Keinerlei Zäune oder Mauern trennen die Anlagen vom Wasser, obwohl die Strömung zeitweise stark und das Baden nicht immer ungefährlich ist. Steigt beispielsweise der Pegel der Limmat an, werden beim Wipkingerpark die untersten Stufen überspült. Die Stadt zeigt sich demgegenüber bemerkenswert offen und setzt auf Eigenverantwortung. Für sie sind die neuen Zugänge zum Fluss – ausgenommen das Lettenareal – offiziell keine Badeplätze. Baden ist zwar nicht verboten, geschieht aber auf eigene Gefahr. Genau diese Haltung ermöglicht die verblüffend großzügigen Lösungen.
All diese Einzelprojekte sind Teil übergeordneter Planungsinstrumente. Für die beiden Flüsse sind dies das Leitbild Sihlraum, seit 2003 in Kraft, und das Leitbild Limmatraum, das 2001 veröffentlicht wurde. Ziel dieser Leitbilder und des heutigen Umgangs mit den Flussufern ist es, einerseits den vorhandenen Erholungsraum aufzuwerten, neuen zu schaffen sowie Fahrrad- und Fußwegverbindungen zu verbessern. Gleichzeitig soll sich der ökologische Wert der Ufer erhöhen.
Die Leitbilder definieren auch für die Zukunft Visionen zur Aufwertung der Uferstreifen: Weitere, vor allem stadtauswärts gelegene Abschnitte sollen sich auch künftig zu attraktiven Naherholungsgebieten wandeln, ohne die Bedürfnisse von Pflanzen und Tiere außer Acht zu lassen.db, Mo., 2008.09.01
01. September 2008 Claudia Moll