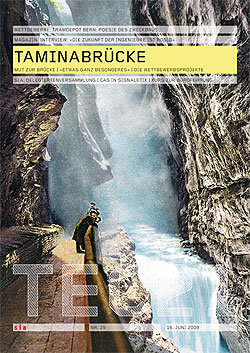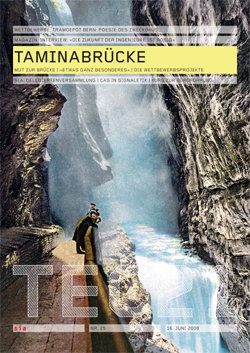Editorial
Dieses Heft widmet sich dem kürzlich entschiedenen Wettbewerb für die neue Taminabrücke, die das Taminatal überspannen und die beiden Dörfer Pfäfers und Valens verbinden soll (Projektierungsbeginn ist vom Kantonsratsbeschluss zum 15. Strassenbauprogramm abhängig und frühestens ab 2009 geplant). Das Siegerprojekt stellt eine kraftvolle und elegante Brücke dar, die sich sorgfältig in das Gelände einpasst und das Gebiet der Taminaschlucht bei Bofel als Schongebiet berücksichtigt. Weshalb an dieser Stelle eine Brücke gebaut werden soll, beschreibt Aldo Rota im Beitrag «Mut zur Brücke».
Der Kanton St. Gallen schrieb im Mai 2007 einen einstufigen, anonymen Wettbewerb aus. Ziel war, einen umfassenden Variantenvergleich von Brückentragwerkskonzepten zu erhalten. Mit den 24 im September 2007 eingegangenen, als Vorprojekte ausgearbeiteten Beiträgen wurde dieses Ziel erreicht. Für die Beurteilung zogen die Jurymitglieder in der Ausschreibung festgelegte Kriterien bei, die nach der aufgeführten Reihenfolge gewichtet waren eine klare Gewichtung zum Beispiel in Prozent wurde aber nicht angegeben. Bauingenieur Mathis Grenacher, eines der neun Jurymitglieder, spricht in «Etwas ganz Besonderes» mit Judit Solt über diese Kriterien. Zudem bringt das Gespräch technische und optische Vorzüge des Siegerprojektes «TaminaBogen» von Leonhardt, Andrä und Partner zum Ausdruck. Im Gegensatz zu den anderen Tragwerkskonzepten gelingt es den Verfassern dieser Lösung, mit den radial am Bogen angeordneten Stützen eine vorteilhafte Konstruktion in Bezug auf den Kräftefluss im Tragwerk und auf den geklüfteten Baugrund zu finden.
In «Die Wettbewerbsprojekte» werden alle eingegangenen Beiträge gezeigt und mit Auszügen aus dem Jurybericht vorgestellt. Vor allem die unterschiedlichen (ausführungs) technischen Lösungen ermöglichten der Jury, die Projekte zu ordnen. Daneben wertete sie optische Qualitäten: Gerade der projektprägende optische Ausdruck erscheint dann vorteilhaft, wenn grundsätzlich eine wahre Teamarbeit dahinter steckt. Voraussetzung dafür sind gegenseitiger Respekt unter allen Fachleuten und echtes Interesse für andere, manchmal auch weniger vertraute Fachgebiete. Die Verfasser des Siegerprojektes sehen eine weitere, sich auf Projekte vorteilhaft auswirkende Chance, einzelne Aspekte in ein Ganzes zusammenzuführen. Aus der Sicht des Stuttgarter Büros Leonhardt, Andrä und Partner GmbH nämlich stellt der Brückenbau eine der letzten Domänen dar, in der Ingenieure noch im klassischen Sinn ganzheitlich als Baumeister wirken können: mit ingenieurtechnischem Sachverstand, architektonischer Entwurfsintelligenz und Gestaltungswillen.
Clementine van Rooden