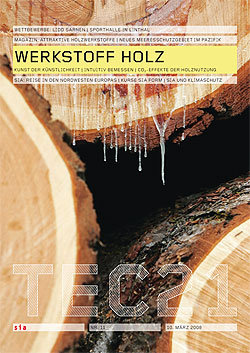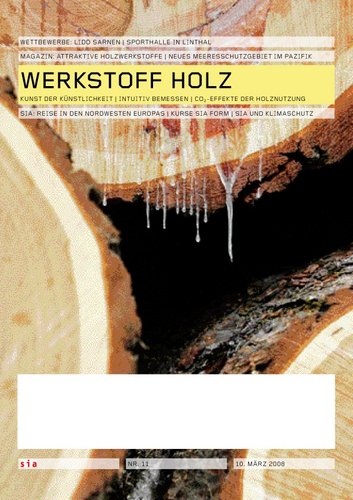Editorial
Die Verwendung von Holz ist aktiver Klimaschutz. Bäume binden das wichtigste Treibhausgas CO2 in Form von Kohlenstoff in ihrem Holz - man spricht daher von Wäldern als CO2-Senken. Um die Vorgaben des Kioto-Protokolls für die Reduktion der Treib-hausgase zu erfüllen, dürfen diese Leistungen des Waldes angerechnet werden, nicht hingegen das Senkenpotenzial der Holznutzung. Dabei bleibt der Kohlenstoff für weitere Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte im Holz gespeichert, wenn es zu Holzprodukten verarbeitet wird. Dazu kommt der Substitutionseffekt: Wenn Holz energieintensive Materialien wie Stahl oder Beton ersetzt oder anstelle von fossilen Quellen als Brennstoff genutzt wird, werden auch dadurch CO2-Emissionen eingespart. Das Steigerungspotenzial für die Holznutzung in der Schweiz ist gross, wie eine Studie zeigt, die wir im dritten Fachartikel in diesem Heft vorstellen. Der Baubranche kommt dabei eine Schlüsselrolle zu, denn das Bauen ist von den Mengen und der Verweildauer her die wichtigste Holzverwendung. In diese Richtung zielt «holz21», ein Förderprogramm des Bundesamts für Umwelt (Bafu). Es fördert unter anderem mit der Auszeichnung «Neue Horizonte - Ideenpool holz21» technisch und ästhetisch überzeugende Beispiele im Holzbau. Nebst zahlreichen innovativen Einzelobjekten und vielen Projekt-ideen würdigte diese sich bereits über drei Jahre erstreckende Aktion die Werke von Holzbauingenieur Walter Bieler und der Zürcher Architekten Burkhalter Sumi. Diesen beiden Büros widmen wir die beiden ersten Fachartikel.
Das Werk von Marianne Burkhalter und Christian Sumi zeugt von einer äusserst differenzierten Auseinandersetzung mit dem Baustoff Holz. Ihre Bauten erforschen das scheinbar einfache Material und die zahlreichen theoretischen Postulate, mit denen es im Laufe der Jahrhunderte befrachtet wurde. Sinnlichkeit und Abstraktion, Wahrnehmung und Interpretation, konstruktive Präzision und farbliche Verfremdung - die Themen mögen komplex sein, die architektonische Umsetzung wirkt stets erfrischend selbstverständlich.
Die Tragwerksplanung von Walter Bieler ist integrierender Bestandteil eines Ganzen. So erfüllen die Holzkonstruktionen alle Aspekte des holzgerechten Entwerfens. Was starr, technisch unflexibel und sogar einschränkend klingt, erscheint in seinen Tragwerken überzeugend, sachlich sauber und trotzdem feinsinnig und ästhetisch. Es zeigen sich darin seine Freude an der Architektur, das von Intuition geprägte Bemessen und die über 30 Jahre aufgebaute Erfahrung.
Claudia Carle, Clementine van Rooden, Judit Solt
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Lido Sarnen | Sporthalle in Linthal
14 MAGAZIN
Attraktive Holzwerkstoffe | Neues Meeresschutzgebiet im Pazifik
20 KUNST DER KÜNSTLICHKEIT
Judit Solt
Architektur: Seit rund 20 Jahren beschäftigen sich Marianne Burkhalter und Christian Sumi mit den vielfältigen Möglichkeiten des Baustoffes Holz.
26 INTUITIV BEMESSEN
Clementine van Rooden
Bauingenieurwesen: An der Holzkonstruktion des Pfarreizentrums in Bonaduz lässt sich die Arbeitsweise von Holzbauingenieur Walter Bieler beschreiben. Sie ist geprägt von Gespür und Erfahrung.
32 CO2-EFFEKTE DER HOLZNUTZUNG
Klaus Richter, Peter Hofer, Ruedi Taverna und Frank Werner
Umwelt: Eine Studie untersuchte, wie die Wald- und Holzbewirtschaftung aussehen muss, um möglichst viel Treibhausgas CO2 einzusparen.
39 SIA
Verwendungsrecht bei Planerwechsel | holz21 an der «Natur 08» erfolgreich | Reise in den Nordwesten Europas | Kurse SIA Form | Mit gutem Beispiel voran
45 PRODUKTE
53 IMPRESSUM
54 VERANSTALTUNGEN
Kunst der Künstlichkeit
Seit den Anfängen ihres gemeinsamen Architekturbüros beschäftigen sich Marianne Burkhalter und Christian Sumi mit Holz. Vom kostenoptimierten Elementbau über raffinierte Fassadenverkleidungen bis hin zu Inneneinrichtungen aus modernen Holzwerkstoffen setzen sie sich mit fast allen Facetten des vielseitigen Materials auseinander. 2007 wurden sie im Rahmen von holz21, dem Förderprogramm des Bundesamtes für Umwelt (Bafu), für ihr bisheriges Werk ausgezeichnet.
Holz ist ein natürlich gewachsenes Material, und mit ihm wächst auch die Vielfalt seiner architekturtheoretischen Deutungen. Mancher Baustoff wird seit Jahrhunderten immer wieder ähnlich bewertet: Marmor verkörpert kostbare Erhabenheit, Stahl industriellen Fortschritt. Holz dagegen weist eine breite Palette möglicher Interpretationen auf. Spätestens im 18. Jahrhundert avancierte es zum Inbegriff urtümlicher Rustikalität. Vitruv hatte die Ursprünge der menschlichen Bautätigkeit noch in drei unterschiedlich materialisierten Behausungstypen – Laubdächer, künstliche Höhlen und Gebilde aus Lehm und Zweigen – geortet und die Entstehung der Baukunst auf die Konkurrenz zwischen diesen Konstruktionstechniken zurückgeführt.[1] Im Gegensatz dazu war die Urhütte des Abbé Laugier ein reiner Holzbau: vier im Quadrat angeordnete, in die Erde gerammte Äste, vier weitere als horizontale Verbindung und ein Satteldach. Daraus hätten sich mit Säulen, Gebälk und Giebel die wesentlichen Bestandteile des dorischen Tempels entwickelt.[2]
Von der Urhütte zum Nullenergiehaus
Hundert Jahre später wies Gottfried Semper diese Theorie zwar dezidiert zurück, lokalisierte aber seinerseits die Anfänge des Bauens im «aus Pfählen und Zweigen verbundenen und verflochtenen Zaun» – und damit in einer anderen Form des Holzbaus. Er betonte, dass technische Ausdrücke wie «Decke, Bekleidung, Schranke, Zaun (gleich mit Saum)» auf den textilen Ursprung dieser Bauteile hinwiesen.[3] Moderne Theoretiker wiederum haben hervorgehoben, dass in der englischen Sprache des Mittelalters die Begriffe «timber» und «house» Synonyme waren und dass auch das deutsche Wort «Zimmer» dieselbe Wurzel habe. Demnach verweise Holz nicht nur auf ein Material, sondern auf das Wohnen schlechthin – eine Interpretation, die in der weit verbreiteten Meinung, Holz sei gemütlich, ihre volkstümliche Bestätigung findet. Von der Urhütte des «guten Wilden» bis zum heutigen Ikea-Interieur signalisiert Holz unkomplizierte, einfache Natürlichkeit. Gleichzeitig steht es aber auch für das Gegenteil: Kostbare Furniere, lackierte Preziosen, Edelhölzer, Schnitzereien und Intarsien sind bis heute Luxuserzeugnisse geblieben. Die geschwungenen Rokokomöbel im Schloss von Versailles ebenso wie die in den 1990er-Jahren schon fast obligaten Ahorn-Wandverkleidungen in Schweizer Bankfilialen sollen nicht Gemütlichkeit, sondern Exklusivität ausstrahlen.
Bei den Exponenten der frühen Moderne löste der Baustoff Holz zwiespältige Reaktionen aus. Einerseits kam er den Forderungen nach Materialgerechtigkeit, Modularität, menschlichem Massstab, Rationalisierung, Standardisierung und Vorfabrikation entgegen. Als organisch gewachsener Baustoff weist Holz Materialeigenschaften auf, die seine Anwendungsbereiche weitgehend vorgeben: Die Belastbarkeit längs zur Faser ist gross, quer zur Faser dagegen klein, der Wuchs des jeweiligen Baumes bestimmt den Massstab der Bauteile, für deren Herstellung sich eine standardisierte Vorfertigung geradezu anbietet. Traditionelle Fügungstechniken – Dübel, Keile, Federn, Schwalbenschwänze – erfordern eine hohe Präzision im Detail, das Postulat nach einer Ablesbarkeit der Konstruktion ist naturgemäss erfüllt. Andererseits lässt der Holzbau nur bedingt jene Abstraktion zu, die Le Corbusier für sein «jeu savant, correct et magnifique des volumes» postuliert.[4] Henry-Russell Hitchcock und Philip Johnson empfehlen denn auch entgegen aller konstruktiven Logik, bei Holzverkleidungen möglichst alle Überlappungen, Fugen und Umrahmungen zu vermeiden, weil diese die Kontinuität der Oberfläche unterbrechen könnten.[5]
Die Verunsicherung, die diese Mehrdeutigkeit auslöst, ist bis heute spürbar. Holz steht für das Urtümliche, Traditionelle, Natürliche, aber auch für kunstvolle Fügung und perfekte Detaillierung. Es gilt als «ehrliches» Material, bei dem sich Form und Konstruktion gegenseitig bedingen; in einer Zeit des formalen Reichtums – und zuweilen auch der Beliebigkeit – ist die Versuchung, die Form durch die Konstruktion gleichsam legitimieren zu wollen, zweifellos gross. Gleichzeitig ist Holz aber auch das Material der Anstriche und Abdeckleisten, die jeder «unverfälschten» formalen Radikalität zuwiderlaufen; in dieser Hinsicht ist es ein Material der Kompromisse. Seine Interpretationen sind widersprüchlich, häufig emotional bedingt und meist moralisch konnotiert. In den letzten Jahren ist ein zusätzlicher Aspekt hinzugekommen: Als nachwachsender Rohstoff, der zudem CO2 bindet, wurde Holz als ökologisch sinnvolles Baumaterial wiederentdeckt. Industrielle Holzwerkstoffe mit homogenisierten Materialeigenschaften, Fortschritte im Bereich mehrgeschossiger Konstruktionen und neue Oberflächenbehandlungen bieten fast unbeschränkte Einsatzmöglichkeiten, die Holz zu einer attraktiven Alternative zu Stahl oder Beton machen. Doch auch bei diesem scheinbar rationalen Umdenken macht sich eine moralische Komponente bemerkbar – etwa, wenn Holz in «ökologischen» Bauten trotz vergleichsweise schlechter Wärmespeicherkapazität als thermischer Puffer eingesetzt wird.
Variationen in Rot
Die Auseinandersetzung mit den kulturellen Referenzen, Materialeigenschaften und technischen Möglichkeiten von Holz prägt die Entwürfe von Marianne Burkhalter und Christian Sumi seit den Anfängen ihrer Zusammenarbeit in den 1980er-Jahren. Dabei nehmen sie sich immer wieder die Freiheit heraus, gewohnte Wahrnehmungsmuster über den Haufen zu werfen: Ihre Annäherung an das Material ist von einer sorgfältig durchdachten Freude am Experiment geprägt. Auch wenn gewisse Themen regelmässig wiederkehren, ist doch die räumliche, akustische, taktile und visuelle Wahrnehmung des Holzes stets auf die jeweilige Bauaufgabe zugeschnitten. Im Folgenden soll anhand verschiedener Projekte von Burkhalter Sumi ein Aspekt hervorgehoben werden, dem sie seit je besondere Aufmerksamkeit widmen: die Beschaffenheit der Oberfläche.
Bereits einer ihrer ersten Bauten, der Forstwerkhof in Turbenthal (1993), hat mit seiner feinfühligen Dialektik von Natur und Künstlichkeit für Aufsehen gesorgt (Bild 1). Er beruht auf einem Holzbausystem, das die Architekten im Auftrag des Hochbauinspektorats Zürich für vier Werkhöfe des Forstamtes entworfen hatten. Der Baukasten besteht aus drei Teilen, die je nach Topografie und betrieblichen Anforderungen zusammengesetzt werden können: einem Administrationstrakt, einer Garage und einer offenen Halle. Letztere besteht in Turbenthal hauptsächlich aus einem grossen Dach, unter dem der Waldboden als Chaussierung weiterläuft. Getragen wird es von grob entrindeten Stämmen in bester Laugier-Tradition; allerdings sind sie nicht in den Boden gerammt, sondern stecken, dem zeitgenössischen Stand der Technik entsprechend, in Stahlschuhen. In Kontrast dazu steht die präzise, rot gestrichene Ausfachung aus horizontalen Brettern, ein diskretes Bekenntnis zur textilen Wand Gottfried Sempers. Beim Dach durchstossen die Unterspannungen der stählernen Träger die abstrakt wirkende, ebenfalls rote Holzuntersicht. Diverse Schattierungen dieses Rots tauchen in späteren Projekten von Burkhalter Sumi wieder auf. Der Erweiterungsbau des Hotels Zürichberg in Zürich (1995, Bild 2), der Pavillon Wildpark Langenberg in Langnau am Albis (1998), das Laubenhaus in Laufenburg (1996, Bild 3) oder die Wohnhäuser an der Wehrenbachhalde in Zürich (2004, Bild 4) sind nur einige Beispiele für das Wiederkehren einer Farbe, die zuweilen als Markenzeichen der Beiden betrachtet wird. Dabei beruht sie auf einer langen Tradition; das Ochsenblutrot historischer Fachwerkhäuser hat sich über die Jahrhunderte so weit zur Konvention etabliert, dass ausgerechnet dieser künstliche Anstrich als «natürlich» empfunden wird.
Täuschungen und Verfremdungen
Doch Burkhalter Sumi beschränken sich keineswegs auf Bekanntes. Ihre Frage nach der adäquaten Oberflächenbehandlung des Holzes ist immer auch eine Frage nach dessen hybridem Charakter als Natur- und Kunstprodukt: Dass Holz in aller Regel einen Witterungsschutz braucht, hat zwar mit seiner natürlichen Beschaffenheit zu tun, doch die vom Anstrich gebildete äusserste Haut ist immer eine künstliche. Die direkt am Zürichsee gelegene Wohnüberbauung Ziegelwies in Altendorf (2002, Bild 5) ist in einem matten Grün gestrichen, das einerseits Assoziationen an Bootshäuser weckt, anderseits in einem Spannungsverhältnis zur umgebenden Vegetation steht. Leuchtend grün dagegen sind die Holzstützen, die die Terrasse des Restaurants «Rigiblick» in Zürich (2006, Bild 6) tragen: Gerade in unmittelbarer Nachbarschaft zum Wald erscheinen sie besonders artifiziell.
Einen speziellen Verfremdungseffekt erproben Burkhalter Sumi mit metallfarbigen Anstrichen, mit denen sie seit einigen Jahren – nicht nur in Zusammenhang mit Holz – experimentieren (vgl. TEC21 44/2003, Dossier Farbe). Ein frühes Beispiel ist die selbsttragende Ständerholzfassade des Expo-Pavillons Onoma in Yverdon-les-Bains (2001, Bild 7): Die gefaltete, glänzende Oberfläche ist mit einer umgekehrten Drehkartei, einem Akkordeon oder einem plissierten Seidenstoff verglichen worden. Die Deckenstirnen der Wohnüberbauung Ziegelwies, die Fensterumrahmungen des Holzpavillons beim Stockalperpalast in Brig (2002, Bild 8) reflektieren das Licht; je nach Sonnenstand treten sie in den Vordergrund oder lösen sich optisch auf. Beim Doppelwohnhaus in Küsnacht (2002, Bild 11) kommt eine weitere Steigerung des Verfremdungseffektes hinzu: Das ganz in Silber gehaltene Gebäude evoziert jenen silbrig schimmernden Grauton, den unbehandelte Holzfassaden mit der Zeit annehmen; die Oberflächenbehandlung erweist sich als Verwandte eines durch Witterungseinflüsse herbeigeführten Urzustands. Ein bemerkenswertes Pendant bildet ein Einfamilienhaus in Erlenbach (2005, Bild 12): Die feingliedrige Holzlattung der Fassade wirkt naturbelassen, ist aber als Schutz gegen Alterungsprozesse mit einem durchsichtigen Nano-Anstrich behandelt und entpuppt sich damit als Hightech-Produkt.
Innenräume
Im innenarchitektonischen Bereich schliesslich lösen sich die Grenzen zwischen Natur und Künstlichkeit vollends auf. Gerade im Innenausbau bieten sich Holzwerkstoffe als vergleichsweise günstige, homogene und einfach zu bearbeitende Materialien an. Nicht zuletzt aus Kostengründen herrschen furnierte Spanplatten oder gespritztes MDF vor, während Naturholz allenfalls als Parkett zum Einsatz kommt. Die Gestaltungsfreiheit, die zeitgenössische Holzbearbetungstechniken mit sich bringt, nutzen Burkhalter Sumi, um atmosphärische Wirkungen zu generieren. Das Restaurant und Bar «Werd» in Zürich (2007, Bild 10) leuchtet in Grün und Rot; im Gegensatz dazu lassen schwarze und platinfarbene Einbauten in einem soeben bezogenen Loft in Zürich (Bild 9) die Raffinesse des bürgerlichen Wohnens in moderner Form wieder auferstehen. Zelebriert wird nicht das Material, sondern die Raumstimmungen, die dank seiner diversen Aggregatzustände erzeugt werden können. «Letztlich geht es um den stilsicheren Umgang mit Oberflächen», bemerkt Christian Sumi – und bezieht sich ungeachtet aller modernen Polemiken auf Gottfried Semper. TEC21, Mo., 2008.03.10
Anmerkungen
[1] Vitruv: Zehn Bücher über Architektur. Wiesbaden 2004, S. 52
[2] Marc-Antoine Laugier: Essai sur l’architecture. Erste Veröffentlichung 1753 (anonym)
[3] Gottfried Semper: Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten. 1860/1863, Einleitung, §1 bzw. §62
[4] Le Corbusier: Vers une architecture. Paris 1995, S. 16
[5] Henry-Russell Hitchcock, Philip Johnson: Der Internationale Stil. 1932, hrsg. von Ulrich Conrads, Braunschweig-Wiesbaden 1985
10. März 2008 Judit Solt
Intuitiv Bemessen
Auffallend, trotzdem schlicht und zurückhaltend in den Dorfkern von Bonaduz integriert zeigt sich der neue Holzbau von Walter Bieler. An diesem Projekt soll seine Tätigkeit in Zusammenhang mit Holzkonstruktionen, für die er Ende 2007 von holz21, dem Förderprogramm des Bundes für Umwelt (Bafu), gewürdigt wurde, aufgezeigt werden. Im Vordergrund stehen die geschichtlichen Meilensteine der Holzentwicklung und die intuitive Arbeitsweise, die Bielers Ingenieurleistung prägen.
Der in Bonaduz aufgewachsene Holzbauingenieur Walter Bieler war beim Neubau des Pfarreizentrums in seinem Heimatdorf nicht nur für die Tragkonstruktion verantwortlich, er nahm erstmals alle Funktionen der am Bau beteiligten Fachplaner wahr. Die Lust, in alle Fachbereiche hineinzuschauen, verführte ihn zu dieser ganzheitlichen Arbeit. Rationale Argumente hätten dagegen gesprochen, so Bieler, weder aus finanzieller noch aus fachlicher Sicht hätte er diese Herausforderung annehmen dürfen. Normalerweise integriert Bieler nicht alle Funktionen in einer Person, sondern schätzt die konstruktive Arbeit im Team. Architekten suchen bereits zu Beginn der Planung seine Erfahrung und seine Ideen zu konzeptionellen Tragwerksentwürfen. Die Statik losgelöst von der Architektur zu planen sei nüchtern, meint Bieler, das Tragwerk mit Konzept und als integralen Bestandteil der Architektur zu entwerfen sei viel bereichernder. Seine Freude an und sein Respekt vor der Architektur fördern die Teamarbeit – waren aber auch mit ein Grund, warum er das Pfarreizentrum im Alleingang verwirklicht hat. Es steht nun anstelle des alten Stalls auf dem Areal der Kirchgemeinde im Dorfkern von Bonaduz. Drei Hauptelemente in einfacher und präziser Form aus Holz bilden den Neubau: Vom Steg als Eingangspforte gelangt man ins Erschliessungsgebäude und von dort ins Hauptgebäude mit einem grosszügigen Saal, dem Sitzungszimmer und dem Kulturarchiv. Die Aussenwandverkleidung aller drei Objekte ist aus Holz (Lamellen und Schindeln) und grenzt sich mit ihren warmen Farben von den umliegenden Holz- und Steinhäusern ab. Das Haupthaus übernimmt die Fluchtlinie der angrenzenden Häuser und führt so die Identität stiftende Baukultur des Dorfs fort.
Der Zugang
Das Tragwerk des Stegs ist als einfacher Balken konzipiert. Ein massiver, blockverleimter Brettschichtholzträger von 44 cm Höhe und 178 cm Breite überbrückt flachkant eine Spannweite von 10.70 m. Die Auflager befinden sich auf der Südwand des Erschliessungsgebäudes und auf dem Passerellenportal, das den Zugang vom Kirchenplatz bildet. Das Portal ist ein steifer Rahmen aus verschweisstem, feuerverzinktem Flachstahl und übernimmt die horizontale Aussteifung in Querrichtung des Stegs, ohne massiv zu wirken. Sprossen (69 /112 mm) aus Lärchenholz hängen im Abstand von 12.8 mm vom Biegebalken herunter (Länge 3.15 bis 3.50 m) und tragen als Zugstangen die horizontal angeschlossene, begehbare Fläche. Als vertikale Sprossenwände schliessen sie den Gehweg in einen Korridor ein, ermöglichen aber den Blick in die Umgebung. Blosses Rechnen erbrachte für diese leichte Holzkonstruktion keinen Steifigkeitsnachweis – die Bemessungen lieferten zu hohe Schwingungen. Bielers Gespür, seine Intuition und die jahrelange Erfahrung mit Holzbauten machten es trotzdem möglich. Jede einzelne, englisch versetzt gestossene Planke des Gehweges (Verschleissschicht) trägt zur horizontalen Aussteifung bei, sodass zwar Schwingungen spürbar sind, doch in einem tolerierbaren Mass. In solchen kleinen Projekten werden Feinheiten, die in grossen Bauten verloren gehen, zur ingenieurmässigen Herausforderung. Die Suche nach Einfachheit unter gleichzeitiger Gewährleistung der Stabilität führt zu einer Gratwanderung. Erst mit dem über Jahre aufgebauten Erfahrungsschatz und dem grösser werdenden Selbstbewusstsein nahm sich Bieler die Freiheit und auch den Mut, im Rahmen der Tragwerksplanung dem Gespür für den Kräftefluss bei der Bemessung, aber auch der Architektur eine so wesentliche Rolle beizumessen. «In jungen Jahren traute man sich das noch nicht zu», so der 60-jährige Walter Bieler.
Das Verflechten
Die Verbindungen der einzelnen Holztragelemente am Steg zeigen eine Qualität auf, die für Bielers Bauten kennzeichnend ist. Sowohl aus technischer als auch aus architektonischer Sicht legt er Wert auf das Erscheinungsbild von Verbindungsdetails. Am Steg stossen die Sprossen aus den Seitenwänden und dem Gehbereich nicht satt aneinander – die Verbindungsstellen sind luftumspült, sodass potenzielle Nassstellen trocknen können. Damit erreicht der Planer Dauerhaftigkeit und erfüllt einen wesentlichen Aspekt holzgerechten Entwerfens. Anhaltende Feuchtigkeit würde zu Fäulnis führen und damit das Tragwerk verrotten lassen, denn trotz allen Holzwerkstoffen und neuen Technologien bleibt Holz ein natürlicher Baustoff und damit biologisch abbaubar. Gerade die Weiterentwicklung der Verbindungstechnik hat dem Holzbau neuen Aufschwung gegeben. Galt Holz im 19. Jahrhundert vor allem bei Brücken noch als Hightechmaterial (Holzbrücken überspannten 50–60 m, während die Spannweite von Steinbogenbrücken max. 20 m betrug), machten ihm Stahl und Beton zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Platz streitig. Erst in den 1960er-Jahren entdeckte man den einheimischen Rohstoff wieder. Antriebe kamen aus der Forschung zu Holzverbindungstechniken an der ETH Zürich sowie vom Bund, der mit einem Impulsprogramm (1986 bis 1991) unter anderem den von Amerika importierten Elementbau unterstützte. Der heimische Roh- und Baustoff sollte besser genutzt werden, denn vom Zuwachs von 8 bis 10 Mio. m3/Jahr in der Schweiz wurden damals nur 3.5 bis 4 Mio. genutzt. Zwar wurden 2006 bereits 5.7 Mio. m3 Wald geschlagen, doch heute noch überaltert der Wald Jahr für Jahr, und grosse Mengen Holz verrotten ungenutzt.
Der Durchbruch
Zusammen mit der weiterentwickelten Verbindungstechnik kamen die Holzwerkstoffeigenschaften besser zum Tragen. Holz kann beispielsweise genauso viel Druckspannung im Querschnitt aufnehmen wie Beton (16 N/mm2 für Brettschichtholzträger), ist dafür aber leich-ter (spezifisches Gewicht Holz: 500–800 kg/m3, Stahlbeton: 2500 kg/m3, Stahl: 7900 kg/m3). Ausserdem weist das Material eine höhere Oberflächentemperatur auf als Stahl und Beton, was die Kondensation verringert. Letzteres ist mit ein Grund, warum gerade bei Eishallen Ingenieurtragwerke aus Holz mit jenen aus Beton und Stahl konkurrieren können. Bieler erstellte 1979 zusammen mit Krähenbühl Architekten die Davoser Eishalle (Bild 4) mit einem spektakulären Holztragwerk, das eine Fläche von 88 × 88 m stützenfrei überspannt (max. Höhe des Hauptträgers: 1.96 m). Zweifelten die Bauherren vor Erstellen dieses Klassikers bezüglich Tragstruktur noch daran, dass mit einer Holzkonstruktion eine grössere Spannweite als 15 m überbrückt werden kann, verflogen diese Bedenken danach rasch. Zwar unterschätzt man das Potenzial des Baustoffs Holz immer noch, doch mit jeder Realisation eines kühnen, modernen und eindrücklichen Holztragwerks wird die Akzeptanz von Holz als leistungsfähiges Material im Ingenieurbau gesteigert. Im ökologischen Zusammenhang fand der Holzbau ebenfalls seinen Platz in der Baubranche, unterstützt durch den psychologisch guten Zugang des Menschen zu diesem Baustoff. Im Pfarreizentrum Bonaduz wurden Hölzer aus dem Bündnerland und aus dem Gebiet um St. Gallen verarbeitet. Bieler unterstützt diese einheimische Baustoffnutzung – unter Vor-behalt. Langfristig könne dieses oft zur Forderung gewordene Argument eine einschränkende Wirkung haben. Ein allzu starker Selbstschutz, bei dem Beteiligte sich auf den handwerklich verbauten Baustoff versteifen und industriell hergestellten Fertigprodukten keinen Zugang mehr gewähren, könne in eine Sackgasse führen. Neuen Lösungen und Entwicklungen, neuen Techniken und Formen müsse man unbedingt Raum lassen und offen gegenübertreten. Nur so könnten die Weiterentwicklung voranschreiten und Synergien zwischen Statik und Konstruktion geschaffen werden: Kreuzweise verleimte Massivplatten bieten z.B. neue Möglichkeiten für das Zusammensetzspiel mit Holzelementen.
Die Formgebung
Der Steg am Pfarreizentrum Bonaduz erhält durch die gewählte Tragstruktur ein Dach, das die tragenden Bauteile vor direkter Witterung schützt. Im Holzbrückenbau wurde diese oft kostenintensive Art von Schutz über Jahrzehnte angewandt, bis Walter Bieler eine Alternative entwickelte. Bei der Laaderbrücke in Nesslau (SG, Bild 5) konstruierte er im Jahre 1996 eine dichte Fahrbahn, die die darunter liegende Tragkonstruktion vor direkter Witterung schützt: eine tragfähige Fahrbahnplatte aus Furnierschichtholz, darüber eine wasserdichte Kunststoffabdichtung, abgedeckt mit Bitumenbelag. Auf chemischen Schutz verzichtet er dabei vollständig, da er der Meinung ist, dass der wertvollste Schutz konstruktiv sei. Trotz dieser Pionierarbeit kehrt Bieler scheinbar zur alten Konstruktionsweise zurück. «In jedem Projekt suche ich die optimale Form und wende die passende Technik an», erklärt er, «so kam diese (eher historische) Formgebung für den Steg in Bonaduz zustande.» Sie minimiert den Terraineinschnitt und maximiert die Öffnung zwischen Böschung und Steg – ein offener, lichtdurchfluteter Gartenbereich breitet sich unter dem Steg hindurch aus.
Die Einschränkung
«Der Baustoff Holz diszipliniert den Konstrukteur», erwähnt Walter Bieler. Grundsätzlich ist Holz eine Stabstatik und keine Flächenstatik, was einen in der Konstruktionsfreiheit einschränkt. Das Tragwerk ist geprägt von zusammengefügten Stäben, wodurch der Kräftefluss erkennbar wird. Die Freude an Holztragwerken werde aber dennoch nicht getrübt. Im Gegenteil, «es tut gut, Grenzen zu haben und in gewisser Weise eingeschränkt zu sein». Der gewonnenen Freiheit durch die Liberalisierung der Brandschutzrichtlinien im Holzbau (Schweizerische Brandschutzvorschriften der Vereinigung der kantonalen Feuerversicherungen VKF, Ausgabe 2003, gültig seit 2005) setzt Bieler ebenfalls Grenzen. Mehrgeschossige Bauten sind zwar möglich, doch müsse ein 7-geschossiges Haus nicht a priori in Holz gebaut werden. Denn Holz hat, wie jeder andere Baustoff auch, seine Schwächen (z.B. Schall). Gefördert werden solle vielmehr die Mischbauweise. Bieler schöpft darum die sich bietenden werkstoffspezifischen Möglichkeiten aus und weist jedem Material sein technisch und architektonisch optimales Einsatzgebiet zu – entsprechend auch im Pfarreizentrum. Die zwei auf den alten Grundmauern errichteten, gegenüber dem ursprünglichen Stall um 60 cm erhöhten Häuser sind komplett als Holzrahmenbau aus Fichte erstellt. Tragende Wände aus Rahmenelementen mit Vorsatzschalung und Dächer aus Kastenelementen, die bis zu 10 m Spannweite überbrücken, leiten die anfallenden Lasten in die neuen Betonfundamente ab (Frosttiefe 80 cm). Einzig die Decke über dem Kulturarchiv, der Öffentlichkeit zugänglich und im alten Heustall gebaut, wurde aus brandtechnischen Gründen aus Beton erstellt. Die Steine der ursprünglichen, während des Umbaus eingestürzten Grundmauern wurden an gleicher Stelle wieder aufgeschichtet. Auf die neue, wesentlich höhere Raumhöhe aufgemauert, sind sie im Sitzungszimmer im Erdgeschoss (alter Kuhstall) ersichtlich und dienen der Lastabtragung, übernehmen aber ebenso eine ästhetische Funktion. Alle Innenräume sind von warmen Le-Corbusier-Farben (französischer Goldocker, Melser Schiefer, Pompeijanisch Rot etc.) nach einem Farbkonzept von kt. C0L0R (Katrin Trautwein) geprägt und die Holzverkleidung millimetergenau den Abmessungen von Fensterlaibungen und Raumecken angepasst. Dies gibt den ganz auf gesellschaftliche Anlässe ausgelegten zwei Häusern eine ruhige Atmosphäre. Grosszügige Fenster – vor allem im Festsaal des Hauptgebäudes – geben ausserdem den Blick in die umliegende Berglandschaft frei (Calanda, Feldis).
Die Unschärfe
Das Gefälle des Stegs ab dem Kirchplatz und die Forderung nach schwellenlosen, invalidengerechten Bödenübergängen ergaben das Niveau der Deckenoberkante im Obergeschoss, wobei die zwei Geschosse aber nur mit Treppen verbunden sind. Rollstuhlfahrende finden ihren Weg über die Aussenwege und die unteren beiden Eingänge. Die wegen der beschränkten Platzverhältnisse bewusst schmal ausgeführte Treppe im Erschliessungsgebäude bringt die ingenieurmässige Arbeitsweise von Bieler ein weiteres Mal zum Vorschein: Das Geländer ist als Biegeträger tragend und lässt die Treppe zusammen mit dem stufenweisen Zuschnitt an der Unterseite als Körper erscheinen. Eine rechnerische Bemessung alleine hätte zu grosse Dimensionen ergeben und die Geländerdicke zu massiv werden lassen. Das intuitive, von Erfahrung geprägte Handrechnen brachte einen eleganten Körper hervor: «Man muss die Deformationen auch einmal zu gross sein lassen – das Spiel mit der rechnerischen Durchbiegung und der Erfahrung in der Praxis bringt schliesslich die ausreichende Steifigkeit.»TEC21, Mo., 2008.03.10
10. März 2008 Clementine Hegner-van Rooden
verknüpfte Bauwerke
Pfarreizentrum Bonadutz