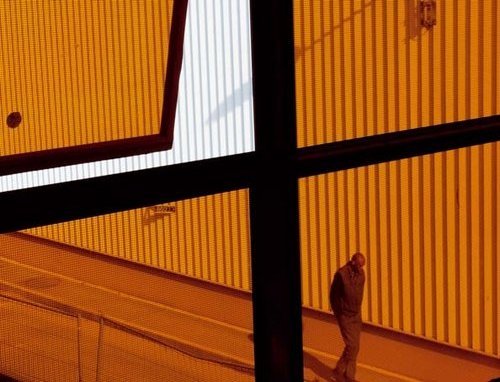Editorial
Monolithisch
Monochrom
Monoton?
Aus dem Griechischen »monos« leitet sich für das Präfix »mono« die Bedeutung »allein, einzig« ab. Erweitert man das rigide Verständnis des Wortsinns im Kontext der Architektur auf »in der Wahrnehmung vorherrschend«, kann die bewusste Beschränkung auf wenige gestalterische Elemente und Materialien sehr eigene Architekturen generieren, die ihre Kraft und Eigenständigkeit gerade aus dieser Limitierung und dem Umgang mit ihr beziehen. elp
Inhalt
Diskurs
03 Kommentar: Hamburg, die containergerechte Stadt | Claas Gefroi
06 Magazin
12 On European Architecture: The mecca of mass media | Aaron Betsky
14 Im Blickpunkt
Erinnerungen an Ettore Sottsass | Alexander von Vegesack
Schwerpunkt
16 Mono ohne -tonie
17 Zum Thema – Was märchenhafte Eintonmusik mit langsamer Architektur zu tun hat | Frank Werner
18 Tagesstätte für geistigbehinderte in Noordwijk (NL) von Architectenbureau Marlies Rohme | Anneke Bokern
26 Verwaltungsgebäude und Busgarage der RATP in Thias bei Paris (F) von ECDM Architects – Emmanuel Combarel, Dominique Marrec | Sebastian Niemann
34 Ateliertheater Bardill in Scharans (CH) von Valerio Olgiati | Hubertus Adam
40 Drei Doppelhäuser für Angehörige der US-Streitkräfte in Weiden
von weberwürschinger architekten | Matthias Castorph
48 Diözesanmuseum Kolumba in Köln von Peter Zumthor von elp
56 … in die Jahre gekommen: St. Willibrord in Waldweiler von Heinz Bienefeld | Wilfried Dechau
Empfehlungen
62 Kalender
62 Ausstellungen
Max Bill (Herford) | Hartmut Möller
Japanische Architektur 1996–2006 (Köln) | Ulf Meyer
64 Neu in …
... Aachen | Karl Kegler
... Amsterdam (NL) | Hubertus Adam
... Innsbruck (A) | Gretl Köfler
66 Bücher
Trends
68 Energie: Nachhaltigkeitszertifikat der DGNB | Martin Haas, cf
72 Ökonomie: Bauherrenpreise Dutzendweise | Gudrun Escher
77 E-Technik: Intelligenz? | rm
80 Produktberichte: Wandbaustoffe, Dämmung | rm
88 Infoticker | rm
90 Schaufenster: Möbelmesse Köln | uk
94 Schwachstellen: Spitzböden | Rainer Oswald
99 Planer / Autoren / Bildnachweis
100 Vorschau / Impressum
Detailbogen
101 Thias (F): Busgarage
104 Weiden: Doppelhäuser
105 Noordwijk (NL): Tagesstätte
Monochromer Klangkörper
Ein eher massiv anmutender Baustoff, eine eigenwillige Farbgebung und ein sehr filigranes Schmuckelement sind die herausragenden Gestaltungsmerkmale eines »Hauses« in Scharans, das eigentlich kein Haus ist. Die Replikation von Formen und Ornament führt zu einem eindrücklichen Gebäude, das vielfach les- und nutzbar ist und seine Komplexität aus der Einfachheit erhält.
Architektur ist meist das Resultat einer Vielzahl sehr unterschiedlicher entwerferischer Entscheidungen und Festlegungen auf verschiedenen Ebenen. Ergeben diese eine gewisse Balance, so mag ein leidlich akzeptables Gebäude entstehen. Indes kann es reizvoll, wenn auch ungleich schwieriger sein, die Anzahl der Themen zu verknappen, also ein Bauprojekt mit weniger, dafür umso grundlegenderen Entscheidungen zu realisieren. Valerio Olgiati wählt seit jeher nicht den einfacheren Weg: Seine Gebäude zeigen paradigmatisch, wie sich durch die Konzentration auf wesentliche Themen ein Entwurfsprozess radikalisieren lässt. Ziel dabei ist keineswegs die Ökonomie der Mittel, sondern die Steigerung des Ausdrucks. Das Schulhaus in Paspels, mit dem Olgiati sich als einer der wichtigsten Exponenten der Schweizer Gegenwartsarchitektur etablierte, zeigt sich als strenger Solitär aus Beton, der durch das Nachzeichnen der Hangsituation subtil dynamisiert wird. Beim Gelben Haus in Flims reduzierte der Architekt das spätklassizistische Bauwerk auf sein materielles Substrat – der weiße Farbanstrich lässt das Volumen von Weitem wie eine minimalistische Plastik erscheinen, während er von Nahem die Versehrungen der Gebäudehaut offenbart und die Baustruktur zum Ornament werden lässt. Das Privathaus in Wollerau schließlich stellt sich als ein überdimensionaler Pavillon aus Weißbeton dar, der schwer und leicht zugleich wirkt.
Sein jüngstes Projekt konnte Olgiati in Scharans realisieren, einer Gemeinde im Domleschg. Dieser Abschnitt des Hinterrheins befindet sich südwestlich von Chur – steil aufragende Berghänge begrenzen den Talboden zwischen Domat/Ems im Norden und Thusis im Süden. Östlich und leicht oberhalb des Flusslaufs gelegen ist Scharans mit seinen 800 Einwohnern ¬eine noch weitgehend historisch geprägte Ortschaft. Die alte Bebauungsstruktur mit ihren Stein- und wettergegerbten Holzhäusern gruppiert und verdichtet sich um einige kleine Plätze im Zentrum, während sie an den Rändern des Dorfs in eine Streusiedlung übergeht.
Konzentration auf Restriktionen
Mitten im Ort, an einem dieser kleinen Plätze, wohnt seit zwölf Jahren der prominente Schweizer Liedermacher und Schriftsteller Linard Bardill. In Chur 1956 geboren, wählte er den kleinen, aber aufgrund der Nähe zur Autobahn keinesfalls abgelegenen Ort, um zwischen und nach seinen häufigen Tourneen in Ruhe arbeiten und sich erholen zu können. Scharans ist für Bardill Rückzugsort, zugleich aber auch der Platz, an dem er probt, experimentiert und organisiert. Auf Dauer war dafür das lediglich 14 Quadratmeter messende Arbeitszimmer in seinem alten Wohnhaus zu klein. Der Zufall wollte es, dass auf der anderen Seite des Platzes ein alter hölzerner Stall zum Verkauf stand; der Künstler erwarb ihn, obwohl er zunächst nicht wusste, wie er die neue Liegenschaft nutzen sollte. Anfangs war für ihn vieles denkbar, ein mehrgeschossiger Turmbau, den die Gemeinde ohnehin nicht bewilligt hätte, ebenso wie die Umnutzung der bestehenden Stallstruktur. Doch letztere Idee schloss Valerio Olgiati, mit dem Bardill inzwischen Kontakt aufgenommen hatte, kategorisch aus: Ein klassischer Umbau, bei dem sich die neue Struktur unsichtbar in der alten Hülle verbirgt, hätte den Architekten schlicht nicht interessiert. Olgiatis Strategie der radikalen Konzentration auf wenige Themen ist ein Beweis dafür, wie Restriktionen zu solch einer Reibung führen, dass Funken zu sprühen beginnen. Die für die Kernzone des Ortes bestehenden Bauvorschriften fordern, dass der Ersatzbau für ein bestehendes Gebäude dieses volumetrisch nachbildet. Damit die charakteristische Körnung des vorhandenen Ensembles visuell prägend bleibt, ist weder eine Vergrößerung noch eine Verkleinerung des umbauten Raums zulässig.
Olgiati erfüllte diese Auflage – doch er erfüllte sie so, dass man von einer Strategie der subtilen Ironie sprechen muss. Das Volumen des früheren Stalls exakt nachzeichnend, errichtete er ein Mauergeviert aus rotbraun durchgefärbtem Ortbeton. Die Hangseite und die Fassade zum Dorfplatz sind als Giebelfronten ausgebildet, die Querseiten im Norden und Süden als klare Wandgevierte. Der einstige Stall bestand aus dem leicht trapezoiden Haupthaus sowie einem Anbau im Norden, der die Dachlinie fortsetzte und damit ein Schleppdach entstehen ließ. Olgiati adaptierte auch diese räumliche Konfiguration, doch er verzichtete auf die Ausbildung der Baunaht: Der monolithische Mauerkranz vereinheitlicht nun die gesamte Struktur. Der beinahe monumentale Charakter wird noch verstärkt durch die geringe Anzahl der Öffnungen. Eine kleine Tür, die man von einer über eine Treppe erschlossenen Gartenterrasse aus erreicht, führt von der Südseite aus in das Innere. Die wichtigste Öffnung jedoch ist eine große, rechteckige Aussparung in der Schaufassade zum Dorfplatz. Diese wendet sich nicht nur dem öffentlichen Raum zu, sondern offenbart in umgekehrter Blickrichtung auch die Konzeption des Neubaus. Was von außen aus monolithisch und festgefügt für alle Ewigkeiten wirkt, ist eigentlich kein Haus, sondern ein großer Hohl-, Hof- oder gar Klangraum. Die Giebelfronten ragen funktionslos in die Höhe, das Gebäude hat kein Dach, und wo sich eigentlich die Decke befindet, die das Wohngeschoss vom Dachboden trennt, hat Olgiati eine – natürlich ebenfalls rot durchgefärbte – Betonplatte eingezogen, die mit einem riesigen elliptischen Durchbruch versehen ist. Auf der Nordseite, also an der Stelle des vormaligen Anbaus, schließt sich – durch eine Glasfront vom Atrium getrennt – das von Bardill gewünschte Studio an.
Es ist ein fast rechteckiger Raum von sechzig Quadratmetern mit einem offenen Kamin. Er kann für verschiedene Zwecke genutzt werden, nicht zuletzt, wie die Akustikelemente an der schrägen Decke beweisen, auch als Tonstudio. Durch die Glasfront und die Aussparung in der Fassade kann Bardill auf den Piz Beverin blicken. Benötigt er mehr Zurückgezogenheit, schließt er die Fassadenöffnung. Dann verschwindet das Dorf, und das Atrium mit seiner zentralen Rasenfläche wird zum Hortus Conclusus.
Atelier und Bühne
Für 1,7 Millionen. Schweizer Franken hat Bardill ein Studio mit einer nutzbaren Fläche von gerade einmal sechzig Quadratmetern erhalten – und ein Atrium, das einen demgegenüber überdimensionierten Außenraum darstellt. Das mag zunächst absurd wirken, erklärt sich jedoch durch die Konzeption des Gebäudes, das Bardill »Ateliertheater« nennt. Es ist mithin die Kombination eines eher intimen Ateliers mit der Funktion eines öffentlichen Theaters. Das Atrium stellt den Ort dar, an dem Außen und Innen, öffentlich und privat zusammentreffen, und so mag man sich hier mal vorkommen wie in einer kalifornischen Villa und mal wie in einer archaischen Versammlungsstätte. Hier kann musiziert werden, und je nach Veranstaltung stehen die Besucher im Atrium selbst – oder auf dem Vorplatz im Dorf. Dann funktioniert die Hauptfassade wie ein großes Bühnentor.
Bardills Ateliertheater kann ebenso als intimes Studio verstanden werden wie als öffentlicher Kulturbau. Diese Ambivalenz ist Konzept, und Olgiati hat dafür eine kongeniale architektonische Lösung gefunden. Mit der Härte, Größe und Einfachheit seines Volumens adaptiert er die klassischen Kriterien monumentalen Bauens. Doch die Wucht und Monotonie, welche das monolithische All-over des Betons bedeuten könnte, wird durch drei entwerferische Festlegungen gemildert und differenziert. Die erste Fixierung betrifft das räumliche Konzept des Atriums ohne Haus und der Giebelwände ohne Dach. Die zweite zielt auf eine Milderung der Monumentalität durch die Farbigkeit des Materials: Durch Pigmente und zusätzlich beigegebenes Steinmehl erzielte Olgiati einen kräftigen, erdhaften Farbton, welcher das Volumen in die Farbigkeit der Umgebung zu integrieren vermag.
Entscheidend zur Wirkung des Gebäudes tragen schließlich die relief¬artigen Ornamente bei, welche die Betonoberflächen überziehen. Ein Ornament auf einer Truhe, die Bardill erworben hatte, diente als Inspiration für die Rosetten, die in drei verschiedenen Größen in die Schalung geschnitzt wurden. Bewusst wählte Olgiati ein handwerkliches Verfahren, verzichtete also auf Pixelraster und computergesteuerte Fräsen. Wichtig war ihm dabei vor allem, dass der Rosette keine übertragene Bedeutung innewohnt. Sie ist kein Symbol, sondern reiner Schmuck ohne semantische Dimension. Und sie wurde zudem am Bau so verwendet, dass sie – anders als bei historischer Verwendung von Ornamenten – keine Bauglieder oder tektonische Strukturen auszeichnet. Demgemäß findet sie sich innen gleichermaßen wie außen, an Wänden ebenso wie an Decken und selbst an Kellertreppen oder jenen Wandpartien, die später durch Erdanschüttung abgedeckt wurden. Bei der Schalung achtete man darauf, dass Wiederholungen nicht sichtbar wurden, dass die Rosetten ständig ihre Ausrichtung ändern und sich nicht optisch zu übergreifenden Mustern zusammenfügen. Gleichsam aleatorisch verstreut, unterstützen sie die homogene Konzeption des monochromen und monolithischen Gebäudes und relativieren dabei seinen monumentalen Gestus.db, So., 2008.03.02
02. März 2008 Hubertus Adam
verknüpfte Bauwerke
Atelier Bardill
Vom Fügen und Feilen
»Vielleicht«, sagt Peter Zumthor über seine Architektur, »sollte man lieber nicht von Stil sprechen, sondern von einer bestimmten Herangehensweise, von einer spezifischen Gewissenhaftigkeit bei der Lösung der Aufgaben.« [1]. Mit dieser Gewissenhaftigkeit hat Zumthor 1997 den Wettbewerb für das Diözesanmuseum für sich entschieden. Dessen schwierige Aufgabe lautete, für die zu groß gewordene Sammlung des erzbischöflichen Kunstmuseums auf dem Ruinenfeld der ehemaligen Pfarrkirche St. Kolumba ein neues Haus zu errichten. Dabei stellten sowohl das geschichtsträchtige Grundstück als auch der Anspruch der Museumsleitung, mit dem Neubau auf der Grundlage eines erweiterten Kunstbegriffes eine zukünftige Form musealen Selbstverständnisses zu realisieren, eine Herausforderung dar.Die spätgotische Emporenbasilika St. Kolumba, einst größte Pfarrkirche Kölns, war im Krieg bis auf wenige Grundmauern zerstört worden. Inmitten der Trümmer hatte sich damals in einem Pfeiler eine spätgotische Madonna erhalten, die für die Kölner zum Symbol des Neubeginns wurde. Ihr erbaute Gottfried Böhm die 1950 geweihte Kapelle »Madonna in den Trümmern«, einen kleinen einschiffigen Bau, auf den ehemaligen Turmmauern, dem er einen lichtdurchfluteten oktogonalen Chor mit einem Zeltdach anschloss. Einige Jahre später ergänzte er sie um eine Sakramentskapelle. Bei archäologischen Grabungen um das Oktogon in den siebziger Jahren wurden dann neben römischen Siedlungsresten auch Fragmente eines aus karolingischer Zeit datierten, einschiffigen Vorgängerbaus, der in den folgenden Jahrhunderten mehrfach erweitert und schließlich durch die fünfschiffige Basilika ersetzt worden war, freigelegt.Die Kapelle, so die Wettbewerbsvorgabe, sollte erhalten und in den Neubau integriert werden, die Bodendenkmale des Grabungsfeldes mit einem Witterungsschutz versehen werden. Zumthor entwickelte das neue Gebäude konsequent auf den Mauerfundamenten der alten Pfarrkirche, übernahm deren Grundriss, überbaute damit auch die zur Kolumbastraße gehende Front der Böhmkapelle und schloss daran nahtlos im Winkel einen Nordflügel an. Lediglich die aufgehenden Mauern der alten Sakristei, in der die bei den Ausgrabungen zu Tage gekommenen Gebeine beigesetzt sind, ließ er unangetastet. In das Grabungsfeld stellte er 14 schlanke, zwölf Meter hohe Betonstützen ein, die den Verlauf des ehemaligen, leicht trapezförmig verschobenen Mittelschiffs nachzeichnen, und lagerte auf diesen sowie weiteren im alten Mauerwerk platzierten Stützen die die Kapelle und Ruinenstätte überfangende Mörteldecke auf. Darauf ordnete er den Großteil der Ausstellungsräume an. Im unterkellerten Nordflügel brachte er die Depots unter.
Blockhafte Kleinteiligkeit
Der Neubau beansprucht und dominiert den Stadtraum entlang der Kolumba- und Brückenstraße mit seinem Volumen, tritt aber gleichzeitig durch seine homogene Materialwahl in das Straßenbild zurück. Um Neues und Altes miteinander zu verbinden, entschied sich Zumthor für einen schmalen, hellen, eigens in Dänemark gefertigten Ziegel in einem warmen Weißgrauton, der mit breiten Lagerfugen gesetzt wurde und mit dem mittelalterlichen Bestand aus Ziegeln, Tuff und Basalten korrespondiert. Dieser erlaubte sowohl den behutsamen Anschluss an die Bestandsmauern als auch das großflächige, durchlässige, doppelschalige »Filtermauerwerk«, mit dem er das Grabungsfeld umfing, um dessen Außenklima zu erhalten. Glatt hochgemauert umhüllt der kleinteilige Stein das blockhafte dreigeschossige Gebäudevolumen, aus dem sich drei Türme erheben und das aus der Ferne ein wenig wie eine Trutzburg anmutet. Der flächigen Fassade wie vorgehängt, sind in den oberen Geschossen fünf große Fensteröffnungen angeordnet.
Steg zur Umkehr und gefangene Madonna
War das Foyer des im Nordflügel gelegenen Eingangs im Wettbewerbsentwurf noch als eine sich zur Straße öffnende Halle ausgewiesen, hat es sich im Laufe der vielen Überarbeitungen ins Gebäude zurückgezogen. Man betritt das Museum durch eine fast schaufensterartige Öffnung vor einer zurückgesetzten Wand, entlang der der Weg ins Innere führt und ist nach der Materialhomogenität des Äußeren fast ein wenig überwältigt von der Vielfalt der Innenausstattung; den großflächigen Muschelkalkplatten des Bodens, den unterschiedlichen Hölzern – ein Tresen aus Eukalyptusholz, Bücherregale in Roseneiche, eine in Birnbaum ausgekleidete Garderobe. Vom Foyer öffnet sich der Blick in den von einer rötlichen Stampfbetonwand eingefassten, mit Bäumen bepflanzten Gartenhof. Aus dem Foyer kann man durch einen schweren ledernen Vorhang in das Dämmerlicht des 900 Quadratmeter großen, hinter dem von außen rätselhaften Filtermauerwerk verborgenen Ausgrabungsbereich treten. Entlang eines gezackt über das Gelände gelegten roten Stegs aus Padoukholz wird der Besucher vorbei an den Ruinen und Böhms Kapelle durch die halbdunkle, von flirrend einfallendem Tageslicht und einigen Hängeleuchten erhellte Halle in die offene Sakristei geleitet, wo Richard Serras Skulptur »The Drowned and the Saved« über die Gebeine wacht. Der Weg führt zurück über den Steg – und vielleicht erst beim zweiten Durchqueren und aus dieser Perspektive erschließt sich der Raum ein wenig, erahnt man eine Ordnung in der Stellung der Betonstützen und erkennt den Aufbau des zweischaligen Mauerwerks mit seinen ausfachenden Stahlrahmen. Es scheint, als sei die Sogwirkung des intensiv roten Steges gezielt darauf angelegt, nach einem ersten, schnellen Durchqueren den Besucher zum Perspektivenwechsel aufzufordern. Dass mit dem Ruinen auch die Marienkapelle »eingehaust« wurde, hat nicht nur bei Böhm anfänglich Entrüstung hervorgerufen, sondern viele Kölner, die sie als einen Ruhepunkt im Einkaufserleben der nahe gelegenen Hohestraße sehen, in Unmut versetzt. Ihr Verschwinden aus dem Stadtbild schmerzt sie dabei ebenso wie die Erfahrung, dass die nun über einen tiefen Einschnitt in der Fassade von der Brückenstraße aus zugängliche Kapelle ihre lichte Leichtigkeit verloren hat, der Fensterzyklus der tanzenden Engel von Ludwig Gries künftig nur durch gleichmäßiges, nachträglich installiertes Licht aus der halbdunklen Halle angeleuchtet werden wird. Doch lässt sich dies als konsequente Umsetzung des Weiterbauens sehen. Ebenso wie die früheren Ausgrabungsstufen ist auch die Marienkapelle Zeitzeugnis einer anderen Epoche. So ist es folgerichtig, dass sie wie alle anderen Bauphasen auch, eingehüllt wird vom Mauerwerksverband.
Ausblicke, Kabinette, Türme und Dialoge
Die Ausstellungsräume für die sehr divergente Sammlung aus sakraler Kunst der Jahrhunderte und weltlicher beginnen kleinteilig im fensterlosen ersten Obergeschoss des Nordflügels, zu dem ein schmaler Treppenschacht hinaufführt. Der fugenlose helle Terrazzoboden ist gegen die mit einem warmen graubeigen Lehmputz versehenen Wände einen Spalt breit abgesetzt, die Mörteldecken korrespondieren mit ihnen in einem leicht gelblichen Grau. Rebecca Horns »Blindenstab«, Warhol und mittelalterlicher Schmerzensmann sollen hier – möglichst gemeinsam, so der Kuratorenwunsch – mit dem Betrachter in den Dialog treten. Erklärende Tafeln sucht man vergebens, ein kleines, am Eingang erhältliches Heftchen weist in allen Ausstellungsräumen die Kunstwerke aus. Gegen eine »Plakatierung« der Wände mit Informationen hatte sich Zumthor vehement ausgesprochen, man kann ihm nur zustimmen, denn von deren samtig-erdiger Glätte hätten sie sich zu prominent abgesetzt.Ein niedriges Kabinett, das um eine vier Zentimeter hohe Stufe versetzt, gleichsam aus der Wand ausgehöhlt zu sein scheint – so nahtlos und farblich angeglichen gehen Mörtelboden, Wand und Decke hier ineinander über – bildet eine Art Ouvertüre des im zweiten Obergeschoss bestimmenden Themas von Platz, »Kabinett-Häusern« und Türmen. Am Ende der Raumfolge, direkt über Böhms Kapellenhalle gelegen, verschließen schwere schwarze Samtportieren den Blick in das ebenfalls mit schwarzem Samt ausgekleidete Armarium, aus dessen Dunkel der fast aufdringlich angestrahlte Kirchenschatz sein Geheimnis preisgibt. Der Weg ins Licht des zweiten Obergeschosses führt über eine Himmelsleiter, über die der weißgraue Terrazzobelag, von den Wänden abgesetzt, fugenlos hinaufzugleiten scheint. An ihrem Ende öffnet sich erstmals ein raumhohes Fenster und gibt den Blick auf den Dom frei. Im eigentlichen Ausstellungsbereich über dem Gräberfeld zeichnet der Terrazzo platzartig den Verlauf des darunter liegenden Stützenrasters nach. An seinen abgesetzten Kanten gehen, einzelnen Häuserfluchten ähnlich, die Wände der Kabinette auf. Zwischen deren Fluchten öffnen sich zwei helle seitliche Plätze, die über breite, geschosshohe Fenster belichtet werden und – fast in Weiterführung des innen wahrnehmbaren Stadtthemas – Blicke auf Köln rahmen. Und an Bilderrahmen erinnern sie mit ihrer der Fassade vorgehängten Konstruktion auch von außen. Spätestens hier kann der Betrachter sich der fast aufdrängenden mehrschichtigen Lesbarkeit des Gebäudes nicht mehr entziehen. Im Verhältnis zur Raumhöhe sehr niedrige Einschnitte in die Wände führen in drei dunkel gehaltenene Eingangskabinette, an die sich helle, turmartige Räume anschließen. Hier fällt Licht aus hoch liegenden satinierten Seitenfenstern ein und unterstützt so die Sogwirkung des Raumes. Sucht man in diesem komplexen Gefüge nach Schwachpunkten, wird man im Lesesaal fündig, der vom Boden über die Wände bis hin zur Decke mit Mahagoni-Holzpaneelen in großflächiger Maserung ausgekleidet, und damit so dominant auf sich selbst und den geschosshoch gerahmten Blick auf die Stadt konzentriert ist, dass die von Zumthor speziell für diesen Raum entworfenen Sitzmöbel mit ihren fast expressionistischen Rundungen als das »Wenige zuviel« seine Ruhe stören.Inmitten dieser spannungsreichen, dabei in sich ruhenden Räumen tritt sakrale Kunst vieler Jahrhunderte mit moderner weltlicher Kunst in den Dialog und lädt den Besucher ein, daran teilzuhaben. Um diesem Platz zu geben, haben sich die Kuratoren auf zurückhaltend wenige Exponate ihrer Sammlung beschränkt und bauen darauf, dass ihr Konzept der Gegenüberstellung dem Besucher ein intensives Erleben ermöglicht und ihn wiederkommen lässt, um immer neue Gespräche in – so das Versprechen am Eröffnungstag – häufig wechselnden »Kunstgruppierungen« zu führen.Eine gelegentlich an Kolumba geäußerte Kritik lautet, Zumthor habe ein Gefäß geschaffen, in dem profane Kunst in ihrer Gegenüberstellung mit sakraler eine dieser immanente, höhere Bedeutungsebene erhalte. Damit stellt man aber eher die Mündigkeit der Besucher in Frage und überschätzt selbst die Fähigkeiten eines Peter Zumthor; deutet seine Errungenschaft in Scheitern um. Denn die Bauaufgabe lautete, einen Raum zu schaffen, der spirituelles Erleben erlaube; für den Rest ist der Betrachter verantwortlich.Fast zehn Jahre Planungs- und Bauzeit und runde 43 Millionen Euro statt der ursprünglich veranschlagten 36 Millionen hat diese gewissenhafte Lösung der Aufgabe gekostet, davon wurden fünf Millionen aus den Geldern der Denkmalpflege finanziert.
Wiederholungen und Interpretationen
Eine eindeutige Einordnung des Gebäudes fällt schwer. Es ist im eigentlichen Sinne archaisch in seiner Wirkung. Mit einer fast archetypisch zu nennenden Bilder- und Erlebniswelt spricht es tief verwurzelte Wahrnehmungsebenen an, während es formal ureigentlich in der Moderne verwurzelt ist. Es »lebt« von der verfremdenden Wiederholung bekannter Motive (Höhle, Marktplatz, Turm, Schatzkammer, Himmelsleiter) ebenso wie von der gleich- und regelmäßigen Anordnung der Materialien. Dabei lädt es zu einem Spurenlesen nach Motiven früherer Zumthor-Bauten ein. Die Schichtung der Ziegel erinnert in ihrer kantigen Abgeschlossenheit an die Therme von Vals, wo die schmalen Natursteinplatten den Eindruck der Massivität hervorrufen. Genau wie dort wird diese Masse gerade dort erlebbar, wo Zumthor die Öffnungen in die Tiefe der Wand setzt, in Vals bei den Panoramafenstern, in Köln im Eingangsbereich und dem Foyer zum Gartenhof. Der fugenlose Terrazzoboden – im Kunsthaus Bregenz dunkel – verbindet die »öffentlichen« Bereiche der Ausstellung über die Geschosse hinweg. Das Treppenhaus selbst wirkt wie ein direktes Zitat des Bregenzer – und ist doch in der Wiederholung ganz anders. Heller Terrazzo und Lehmputz vermitteln eine weiche Klarheit des Raumes, dem im Bregenzer Treppenaufgang die puristisch-klare Scharfkantigkeit des Betons entgegensteht. Und noch ein – augenzwinkerndes (?) Zitat lässt sich ausmachen: Die halbhohe Stampfbetonwand des Hofes, die den Beton der Wachendorfer Bruder Klaus Kapelle »zitiert«, hier aber statt bergender Hülle zum trennenden farbigen Kontrastelement wird und sich dabei gleichzeitig auch als Zitat der frühen römischen Siedlungen an diesem Ort lesen lässt.Die »ahnungsschwingende« Mehrdeutbarkeit, verbunden mit einer sehr klaren Formensprache, macht die Qualität von Kolumba aus. In ihr zeigt sich der lange Entwurfsprozess, das Ringen um die Selbstverständlichkeit der Form. Damit lädt das Gebäude zu einer vielschichtigen Interpretierbarkeit ein. Und ein wenig liegt darin auch seine Gefahr. »Auratisch« ist eines der Attribute, das in diesem Zusammenhang häufig genannt wurde. Zumthor selbst hat es einmal anders ausgedrückt: »Von Bauwerken, die an ihrem Ort eine besondere Präsenz entwickeln, habe ich oft den Eindruck, sie stünden unter einer inneren Spannung, die über den Ort hinausweist. Sie begründen ihren konkreten Ort, indem sie von der Welt zeugen. Das aus der Welt kommende ist in ihnen eine Verbindung eingegangen mit dem Lokalen.« [2].
Tragwerk
Die Konstruktion des gesamten Gebäudes beruht auf einem Stahltragwerk in Verbindung mit massivem Mauerwerk. Die Sicherung der Ruine und die aufwendige Gründung im archäologischen Bestand sowie das Aufmauern auf den Mauerresten der fünfschiffigen Pfarrkirche stellten eine besondere Herausforderung dar. Die 14 das obere Ausstellungsgeschoss tragenden Stützen mussten im Grabungsfeld platziert werden, ohne die Grabungsbefunde zu gefährden. In die Strebepfeiler der ehemaligen Pfarrkirche konnten weitere Stützen eingebracht und im Erdreich verankert werden. Diese tragen durch ein Fächerwerk gleichzeitig das aufgehende Filtermauerwerk ab.
Mauerwerk
Das offene Filtermauerwerk über dem Grabungsfeld schützt die Ruinen vor direktem Außeneinfluss, ohne sie vom Außenklima abzuschirmen. So können sowohl sie als auch die Bodendenkmale in einem kontrollierten Umfeld konserviert werden. Das zweischalige Mauerwerk wurde in einem festen Verbund mit den Hintermauerziegeln ausgeführt. Die Vorsatzschale aus dem sogenannten Kolumba-Stein ist zwar selbsttragend, ihre Biegesteifigkeit erhält sie jedoch nur im Verbund.
Energiekonzept:
Die Klimatisierung des Gebäudes basiert auf einem Zusammenspiel von Bauteilaktivierung und einer Geothermieanlage. Die in Massivbauweise errichteten Ziegelwände mit einer Dicke von 60 Zentimetern sowie die Betondecken sind von einem Leitungssystem durchzogen, das ganzjährig Wasser mit einer durchschnittlichen Temperatur von 18 bis 20 Grad durch die Wände und Böden transportiert. Die träge Masse wird dadurch gleichmäßig temperiert, so dass der Energiebedarf für die Heizung und Kühlung aufgrund der gleichen Bauteil- und Raumtemperatur minimiert werden konnte. Dazu wurden 16 Bohrungen in eine Tiefe von 70 Metern ausgeführt, um die dort herrschende Wassertemperatur im Winter zu Beheizung, im Sommer zu Kühlung des Gebäudes heranzuziehen. Die Zuluft wird aus dem Raum des Grabungsfeldes angesaugt und strömt über die Leuchtenauslässe in der Mörteldecke herein, die Abluft wird über die Fuge im Bodenrand großflächig abgesaugt.db, So., 2008.03.02
Literaturverzeichnis:
[1] Ausstellungskatalog Kunsthaus Bregenz: Peter Zumthor Bauten und Projekte 1986–2007, S. 3
[2] Peter Zumthor: Von den Leidenschaften zu den Dingen, in: Architektur Aktuell, 178/1995, S. 88–96
02. März 2008 Elisabeth Plessen
verknüpfte Bauwerke
Kolumba - Kunstmuseum des Erzbistums Köln
RAL 7024
Für ein neues Buszentrum im Süden von Paris fanden die Architekten eine große, konzeptuelle Geste und ließen den Baukörper gleichsam aus dem Boden herauswachsen. In den dunkelgrauen, mit Noppen überzogenen Monolithen schnitten sie große Öffnungen, an denen farbige Glasflächen zum Vorschein kommen. Diese kontrastierte Farbgebung setzt sich im Inneren fort und wird letztlich maßgeblich für das Entwurfskonzept.
Die RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) ist der Verbund für den öffentlichen Nahverkehr in Paris, sie transportiert jährlich fast drei Milliarden Personen in ihren Bussen, Regional-, Straßen- und U-Bahnen. Ihre Mitarbeiter sind traditionell sehr gut organisiert und nehmen über diverse Eisenbahnergewerkschaften großen Einfluss auf den Verkehrsverbund. Wenn, wie zuletzt im November 2007, die Zeichen auf Streik stehen, bewegt sich in Paris fast nichts mehr.
Strukturell drückt sich die gewerkschaftliche Macht in starken Mitbestimmungsrechten aus, weshalb sämtliche Projekte in sehr vielen Gremien sehr detailliert besprochen und abgestimmt werden müssen. Dies gilt natürlich auch für die Bauvorhaben der RATP, wie dem Buszentrum in Thiais. Das neue Gebäude sollte auf dem bestehenden Standort im Süden von Paris die verschiedenen Funktionen von Verwaltung und Verkehrsleitung aufnehmen. Weil der Bauherr sich nicht in der Lage sah, im Voraus ein genaues Raumprogramm zu formulieren, wählte er per Auswahlverfahren die Architekten Emmanuel Combarel und Dominique Marrec (ECDM, Paris) aus, um zunächst einen den Nutzerwünschen entsprechenden Grundriss zu entwickeln.
In wöchentlichen Besprechungen mit den zahllosen Vertretern und Beratern des Bauherrn kristallisierte sich so unter Federführung der Architekten eine räumliche Organisation der notwendigen Büro-, Besprechungs-, Umkleide- und Aufenthaltsräume auf einer quadratischen Grundfläche mit einer Kantenlänge von 35 Metern und zwei Geschossen heraus. Die Kompaktheit des Plans zeugt vom Willen, die verschiedenen Bereiche miteinander zu vernetzen und der maßgenaue, individuelle Zuschnitt der Büros verdeutlicht eine genau durchdachte Funktionalität. Letztere führte wohl auch dazu, dass das Gebäude über ein komplexes Erschließungssystem mit nicht weniger als fünf Ein- und Ausgängen verfügt.
Legostein-Skulptur
Während der Grundriss in enger Zusammenarbeit mit dem Bauherrn entstand, zeugt dessen Übersetzung in ein architektonisches Konzept vom Willen der Architekten, dem Buszentrum eine qualitätvolle Gestalt zu verleihen und es in seinen suburbanen Kontext einzufügen. Dieser ist von anonymen Gewerbebauten, Einkaufszentren und Autobahnen geprägt, die sich zu einer monotonen Betonlandschaft aneinanderfügen. Und anstatt ein weiteres Objekt neben den bestehenden, riesigen Hangar zum Parken und Warten der Busse zu stellen, arbeiteten Combarel und Marrec den Charakter des Ortes heraus und formten daraus ihr Gebäude: Das Buszentrum scheint aus dem Boden emporzuwachsen, indem sich die dunkle Oberfläche des Parkplatzes in Fassade und Dach des Buszentrums fortsetzt. Die Übergänge zwischen Horizontalen und Vertikalen sind dabei gewölbt, so dass der Eindruck entsteht, der Asphalt lege sich wie eine Haut über den Baukörper. Eine dichte, an Legosteine oder Anti-Rutsch-Böden erinnernde Noppenstruktur verstärkt den Eindruck der von den Architekten gewünschten Kontinuität und belebt die anthrazitfarbenen Flächen. Um die bunkerhafte Geschlossenheit des Baukörpers aufzubrechen und Licht in sein Inneres zu bringen, schneiden die Architekten »wie mit dem Skalpell« große, rechtwinklige Öffnungen hinein, an denen glatte, farbige Flächen aus verspiegeltem Glas zum Vorschein kommen.
Für die Präsentation ihres Konzeptes ließen die Architekten einen Kurzfilm animieren, in dem das Gebäude als Kulisse für den alltäglichen Betrieb des Buszentrums diente. So in den Hintergrund gestellt, wurde die architektonische Geste auch nicht zum eigentlichen Objekt der Diskussionen über das Projekt. Nachdem der Film die verschiedenen Ebenen der Entscheidungsträger durchlaufen hatte, wurde dem Projekt in der für die RATP rekordverdächtigen Zeit von nur drei Wochen zugestimmt.
Zur Ausführung des dunkelgrauen Monolithen wählten Emmanuel Combarel und Dominique Marrec vorgefertigte Fassadenteile aus hochfestem, faserbewehrtem Beton. Diese sind nur drei Zentimeter stark und teilweise doppelt gekrümmt. Sie sind mit Noppen besetzt, die über einen Durchmesser von 24 Millimetern verfügen und 7 Millimeter aus der Oberfläche hervortreten. Das Noppenraster gibt stringent die Maße für das ganze Gebäude vor und ist selbst auf den runden Randflächen genaustens fortgeführt. Um die Herstellung der Spezialbetonelemente zu ökonomisieren, wurden die Fassaden so entworfen, dass ihre Noppenstruktur aus nur fünf Formteilen hergestellt werden konnten. Jede der Kautschuk-Matrizen wurde nach und nach klein geschnitten und konnte so, in verschiedenen Formen, mehrfach für die Herstellung der unterschiedlichen Fassadensegmente verwendet werden. Die so vorgefertigten Elemente wurden der herkömmlichen Betonstruktur des Gebäudes vorgesetzt und fungieren gleichzeitig als Bodenbelag sowie als Verkleidung für Wand und Attika. Dass die Wärmedämmung auf der Innenseite der Betonscheiben der Außenwände angebracht ist gehört in Frankreich (leider) immer noch zu den Standardlösungen und vereinfacht die Problematik der Fassadendetails auf eine normgerechte Abdichtung der Fertigteile und ihrer Fugen.
Dunkelgraue Innenräume
Alle sichtbaren Außenflächen der Fassade sind aus Betonfertigteilen gebildet. Über den verglasten Bereichen der Einschnitte, ließen die Architekten gar genoppte Betonleisten auf der Attika anbringen, um ihr konzeptuelles Versprechen des »Monolithischen« bis ins letzte sichtbare Detail einzulösen. Da jedoch selbst die Rundung über den Materialwechsel zwischen Parkplatz (Asphalt) und Fassade (Beton) nicht hinwegtäuschen kann, gewinnt der Baukörper diesen Eindruck letztlich eher durch die Farbe (RAL 7024), mit welcher seine Oberflächen lasiert wurden. Während der Beton nur als äußere Haut sichtbar ist, setzt sich die dunkelgraue Farbe im Inneren des Gebäudes fort: Wände und Böden sind in Anthrazit gehalten und die Räume nur punktuell, ihrer Nutzung entsprechend ausgeleuchtet. Das Zusammenspiel mit den lebhaften Farbtönen, die schon in den Glasfassaden auftreten, setzt in der Gestaltung der Innenräume gezielt Akzente. Die Farben von Türen, Möbel und Vitrinen sorgen so für eine visuelle Ordnung der verschiedenen Bereiche und dienen der Orientierung im ansonsten eher unhierarchischen Innenleben.
Entgegen des verschlossenen Eindrucks, den das Gebäude von außen vermittelt, öffnen sich im Inneren ständig Ausblicke auf den Betriebshof, und fast alle Räume sind durch Blickbezüge mit dem Außenbereich in Verbindung gesetzt. Die Anzahl der sich bietenden Perspektiven wird zudem durch eine Verspiegelung der in das Gebäudevolumen eingeschnittenen Glasflächen vervielfacht. Diesen Effekt erreichen die Architekten durch in engem Raster hinter die Verglasung aufgebrachte silberne Punkte. Die zudem quadratisch unterteilten Glasfassaden, stellen eine ironische Interpretation der typischen Achtziger-Jahre-Fassade der umgebenden Gewerbebauten dar.
Mit dem Buszentrum ist ein Baukörper entstanden, der sich gleichsam maßstabs- und zeitlos in seinen Kontext einfügt. Ohne Hochmut gegenüber den benachbarten »Schuhkartons« und ohne den Anspruch, sich besonders davon abzuheben, gelingt es Combarel und Marrec den Ort aufzuladen, indem sie ihn auf seine eigentliche Funktion, die des Busparkplatzes, reduzieren. Das Konzept, das als sehr große Geste der Architekten für einen kleinen zweigeschossigen Zweckbau kritisiert werden kann, schafft es trotz allem, das Gebäude visuell, ja fast wörtlich am Ort zu »verankern«. Und die zunächst scheinbar voneinander unabhängigen Fassaden und der Grundriss finden über die präzise gesetzten Einschnitte zueinander. Deren lebhafte Farbigkeit entspringt nicht etwa der aktuellen Mode, sondern wird zum entscheidenden Baustein im Konzept des Projektes. Einerseits betonen sie die einheitliche, dunkelgraue Gebäudehülle und andererseits verzahnen sie Innen- und Außenräume zu einem Ganzen.
Die Fassaden geben dem Buszentrum einen trügerischen, stillen Anschein, doch nicht umsonst bezeichnen es die Architekten lieber als »Kontrollturm« denn als gewöhnlichen Bürobau: Sämtliche Buslinien im Süden und Osten des Ballungsraumes Paris werden von hier aus gesteuert, und wenn am frühen Morgen etwa 800 Busfahrer den Betrieb aufnehmen werden die Flure selbst zum Schauplatz des Großstadtverkehrs. Im Übrigen ist auch der Grundriss im Inneren des grauen Monolithen noch nicht ganz zur Ruhe gekommen. Schon während der Bauzeit mussten die Architekten laufend Änderungswünsche des Bauherrn einarbeiten und selbst nach der Inbetriebnahme entwickelt die RATP ihr Raumprogramm beständig weiter.db, So., 2008.03.02
02. März 2008 Sebastian Niemann
verknüpfte Bauwerke
Verwaltungsgebäude und Busgarage der RATP