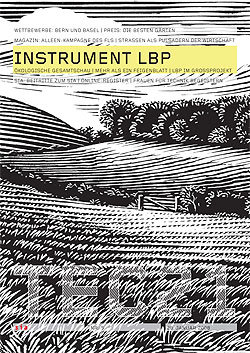Editorial
«Instrument LBP»? Das mag für den einen oder anderen Leser ein etwas rätselhafter Hefttitel sein. Die Abkürzung LBP steht für «landschaftspflegerische Begleitplanung», ein Begriff, der mühelos den Rahmen unserer Titelüberschrift sprengt. Was verbirgt sich hinter dieser umständlichen Wortschöpfung?
Wenn gebaut wird, ist immer auch die Landschaft betroffen mit ihren ökologischen Funktionen, ihrem ästhetischen, kulturellen und emotionalen Wert. Wird dieser Aspekt beim Bauprozess von vornherein mit berücksichtigt, bleibt oft ein grosser Handlungsspielraum, um die Landschaft so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, sie im Gegenteil möglicherweise sogar aufzuwerten. Dieses Ziel verfolgt die landschaftspfl egerische Begleitplanung, bei der im Idealfall Landschaftsfachleute ein Bauprojekt von der ersten strategischen Planung, dem Variantenstudium, der Projektierung und Ausführung bis hin zur Nutzung, Pflege und Erfolgskontrolle begleiten. Der Begriff «landschaftspflegerische Begleitplanung» stammt aus Deutschland und wurde im Jahr 2001 mit einer SIA-Dokumentation in der Schweiz eingeführt. Sie ist damit ein noch relativ junges und nicht allzu breit bekanntes Instrument, das bisher auch erst in wenigen Kantonen regelmässig angewendet wird. Hinzu kommt, dass es im Baubereich noch eine ganze Reihe anderer Instrumente gibt, die sich mit dem Aspekt Umwelt befassen. Dies führt auch bei Fachleuten zu Begriffsverwirrung und letztlich dazu, dass sich diese Instrumente gegenseitig behindern. Joachim Kleiner, Professor für Landschaftsgestaltung an der Hochschule für Technik in Rapperswil und einer der Autoren der erwähnten SIA-Dokumentation, erläuterte im Gespräch mit TEC21, wie sich die verschiedenen Instrumente voneinander abgrenzen lassen, was die Aufgaben und Ziele der LBP sind und welchen Stellenwert sie heute hat. Worauf es ankommt, damit eine LBP in der Praxis ihr Ziel wirklich erreicht und nicht zu einer blossen Begrünung des Bauwerks verkommt, erläutert in unserem zweiten Beitrag der Landschaftsarchitekt Joachim Wartner. Zentral ist zum einen, dass die Landschaftsfachleute frühzeitig einbezogen werden, wenn der Gestaltungsspielraum am grössten ist. Ein anderer wichtiger Punkt ist die Sicherung von Pfl ege und Unterhalt sowie die Erfolgskontrolle der realisierten Massnahmen nach Bauabschluss, wofür es bisher oft an personellen und finanziellen Ressourcen mangelt.
Ganz konkret wird es dann in unserem dritten Beitrag, der die landschaftspfl egerische Begleitplanung im Projekt AlpTransit Gotthard vorstellt: Wie ist die LBP personell organisiert, und wie liefen die Planung, Umsetzung und Abnahme konkreter Massnahmen ab?
Die Durchführung einer LBP sei in der Schweiz, im Gegensatz zu den Wettbewerben im Städtebau, noch nicht zur Kultur geworden, konstatierte Joachim Kleiner im Interview. Vielleicht leistet dieses Heft einen Beitrag dazu, dass sich landschaftsgerechtes Planen und Bauen in der Schweiz stärker durchsetzt.
Claudia Carle, Daniela Dietsche
Inhalt
WETTBEWERBE
Breitenrainplatz, Bern: Frauen planten mit | Eine neue Promenade für Basel | Die besten Gärten
MAGAZIN
Erfolgreiche Alleen-Kampagne des FLS | Strassen als Pulsadern der Wirtschaft | Miniatur-Oasen | Minergie: Neuerungen ab 2008 | Syntax der Landschaft
ÖKOLOGISCHE GESAMTSCHAU
Claudia Carle, Daniela Dietsche
Ein Gespräch mit Joachim Kleiner, Professor für Landschaftsgestaltung an der Hochschule für Technik in Rapperswil, zu Aufgaben, Abgrenzung und Stellenwert der LBP.
MEHR ALS EIN FEIGENBLATT
Joachim Wartner
In der Praxis hat die LBP häufig eine schweren Stand. Was braucht es, damit der Faktor Landschaft in Planung und Ausführung als gleichberechtigter Projektbestandteil behandelt wird?
LBP IM GROSSPROJEKT
Corinne Brown-Müller, Bernard Griesser, Michel Jeisy, Alex Regli, Beat Indergand
Die Neat wird während der Planungs- und Ausführungsphase von Ökologen und Landschaftsgestaltern begleitet, um Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der schutzwürdigen Lebensräume zu vermeiden.
SIA
Beitritte im 4. Quartal | Natur 08: Neue Horizonte für Holz | Betreuer der Berufsgruppen | Register neu online | Frauen für Technik begeistern | Kurse SIA-Service
PRODUKTE
IMPRESSUM
VERANSTALTUNGEN
Ökologische Gesamtschau
Bauen ist immer auch ein Eingriff in die ökologischen und ästhetischen Charakteristika der Landschaft. Damit dieser Aspekt neben den technischen und funktionalen Anforderungen an ein Bauwerk nicht auf der Strecke bleibt, wurde das Instrument der Landschaftspfl egerischen Begleitplanung geschaffen. Ein Gespräch mit Joachim Kleiner, Professor für Landschaftsgestaltung an der Hochschule für Technik in Rapperswil.
TEC21: Könnten Sie erläutern, was die Aufgabe der Landschaftspfl egerischen Begleitplanung (LBP) ist?
Joachim Kleiner: Die LBP versteht sich als begleitender Beitrag zu einem Bauprojekt, sei es aus dem Hoch- oder dem Tiefbau, und behandelt die Themen Natur und Landschaft. Mit der LBP versucht man, eine ökologische und ästhetische Gesamtschau und Optimierung des Projekts zu erreichen. Idealerweise begleitet sie dieses durch alle Projektierungs- und Bauphasen. Das Wesentliche ist der frühe Beizug des Landschaftsplaners, damit man rechtzeitig die richtigen Entscheidungen fällen kann. Es gibt viele Beispiele von Strassenplanungen mit langer Projektierungsgeschichte, bei denen die gewählte Linienführung zur Zerschneidung von Lebensräumen führte und daher später teure Wildbrücken erstellt wurden. Hätte man im Rahmen einer LBP die Landschaft als Ganzes betrachtet, hätte man vielleicht eine Linienführung gefunden, bei der keine Wildbrücke nötig gewesen wäre.
TEC21: Im Zusammenhang mit Bauprojekten existieren im Bereich Umwelt und Ökologie viele verschiedene Begriffe. Wie kann die LBP gegenüber anderen Instrumenten, zum Beispiel der Umweltbaubegleitung (UBB) oder der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), abgegrenzt werden?
Joachim Kleiner: Die Frage zeigt ganz gut, wo das Problem liegt: Die verschiedenen Instrumente und deren Bezeichnungen führen auch bei vielen Fachleuten oder Auftraggebern zu Verwirrung. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass man mit der LBP versucht, schon bei der Variantendiskussion oder der Standortwahl in die Planung einzusteigen, während sich beispielsweise die UBB auf den eigentlichen Bauprozess konzentriert. Ein weiterer Unterschied ist, dass die LBP inhaltlich schmäler ist. Sie beschäftigt sich mit Natur und Landschaft, die eine qualitative Diskussion erfordern. Bei der UBB geht es dagegen um quantifi zierbare Aspekte wie Erschütterungen, Lärm, Staub et cetera und um das Einhalten der entsprechenden Grenzwerte. Die UVP betrachtet ebenfalls die gesamte Breite der Umweltaspekte. Sie ist aber in erster Linie eine Bewertung dessen, was projektiert wurde, und macht gegebenenfalls Aufl agen. Die UVP ist ab einer bestimmten Projektgrösse vom Umweltschutzgesetz vorgeschrieben. Grundsätzlich müssen sich aber auch kleinere Projekte nach denselben gesetzlichen Vorschriften richten wie UVP-pfl ichtige Projekte. Die LBP ist wie die Umweltbaubegleitung oder die ökologische Baubegleitung nicht gesetzlich verankert. Alle diese Instrumente haben bisher keinen normativen Charakter. Darinunterscheidet sich die Schweiz von Deutschland, wo die LBP – zumindest bei Strassenprojekten – gesetzlich vorgeschrieben ist.
TEC21: Wie lange gibt es die LBP in der Schweiz schon?
Joachim Kleiner: Dieser Begriff kommt aus Deutschland und wurde mit einer SIA-Dokumentation1 aus dem Jahr 2001 in der Schweiz eingeführt. Aber trotz des gleichen Begriffs ist die LBP in der Schweiz und in Deutschland inhaltlich nicht dasselbe. Wir legen Wert darauf, dass sich die LBP für sämtliche Landschaftseingriffe eignet, während sie in Deutschland nur beim Bau von Verkehrswegen angewendet wird.
TEC21: Wer entscheidet, ob eine LBP durchgeführt wird?
Joachim Kleiner: Die Verantwortung dafür liegt beim Auftraggeber. Bisher wird die LBP erst vereinzelt angewandt. Das liegt sicher auch an den vielen verschiedenen Instrumenten. Sie behindern sich gegenseitig, obwohl sie mit verschiedenen Schwerpunkten dasselbe Ziel verfolgen. Im Grossteil der Fälle, in denen heute LBP durchgeführt werden, sind Kantone, Gemeinden oder der Bund die Auftraggeber. Einige Deutschschweizer Kantone – vor allem der Kanton Aargau, aber auch Solothurn und Zürich– verlangen heute eine LBP. Oft fordert sie auch das Bundesamt für Umwelt.
TEC21: Bei welchem Anteil an Bauprojekten wird heute eine LBP durchgeführt? Joachim Kleiner: Das ist eine interessante Frage, aber da müsste man zuerst eine Recherche machen. Meines Wissens ist der Anteil bei Strassenbauprojekten im Kanton Aargau sehr hoch, in Zürich, Solothurn und Bern immerhin wahrnehmbar.
TEC21: Kommen wir nochmals zurück zu den Aufgaben der LBP. Sie sagten, es gehe um Natur und Landschaft, um eine ökologische und ästhetische Gesamtschau des Projekts.
Joachim Kleiner: Ja, Zielsetzung ist eine gesamtheitliche Betrachtung der Landschaft. Dazu gehört das Lesen und Begreifen der Ausgangslandschaft und von deren Charakteristika. Diese Charakteristika können ökologische oder gestaltgebende sein. Es geht dabei sowohl um Fauna und Flora als auch um die Sicht des Menschen, der die Landschaft wahrnimmt. Wenn dies geschehen ist, überlegt man sich, wie die Landschaft nach dem Eingriff aussieht.
TEC21: Und Ziel der LBP ist es dann, dass das neue Bauwerk diese Landschaft möglichst wenig verändert?
Joachim Kleiner: Oft ist es so, dass man einen möglichst unauffälligen Eingriff möchte. Das ist wie bei einer Tiefgarage, einem Tunnel oder einer Überdeckung – aus den Augen, aus dem Sinn. Wir können es uns fi nanziell leisten. Es gibt aber auch Eingriffe, die nicht unauffällig gestaltet werden können, diese müssen dann gut gemacht werden. Die Sunibergbrücke bei Klosters beispielsweise ist überhaupt nicht unauffällig, aber sie ist gut. Und sie tut der Landschaft gut. Der integrative Ansatz mag an vielen Orten richtig sein. Man legt zum Beispiel die Strasse etwas tiefer, damit die Ebene nicht zerschnitten wird. Aber an manchen Orten müssen wir die Strassen auch zeigen und mit dem Eingriff eine neue Landschaft entwickeln. In diesen Fällen ist gestalterische Kreativität gefragt. Unauffälligkeit führt nicht immer zur besten Lösung.
TEC21: Welchen Anteil der Kosten verursacht die LBP an den Gesamtbaukosten?
Joachim Kleiner: Grundsätzlich entstehen die Kosten nicht durch die LBP, von den Planungskosten einmal abgesehen. Die Kosten entstehen durch die gesetzlichen Auflagen.Das Umweltschutzgesetz und das Natur- und Heimatschutzgesetz schreiben vor, dass bei einem Eingriff für Ersatz oder Ausgleich ökologisch wertvoller Landschaftselemente gesorgt werden muss. Meiner Meinung nach sparen wir durch den frühzeitigen Einbezug der LBP Kosten: Flick- oder Reparaturlösungen sind immer teurer.
TEC21: Nach aussen entsteht oft der Eindruck, dass nur wegen einer Käferkolonie oder ein paar Feldhasen teure Lösungen in Kauf genommen werden müssen.
Joachim Kleiner: Das ist richtig, der Eindruck entsteht und wird leider zu wenig korrigiert. Wir reden hier von marginalen Beträgen, die durch diese Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen entstehen. Wenn ein neuer Amphibienstandort 100000 Franken kostet, ist das für eine Autobahn nicht viel. So viel kostet auch eine grosse Verkehrstafel. Wir bewegen uns da im Bereich des Kunstprozents. Es geht um die ethische Frage, wie viel uns Natur und Landschaft wert sind. Abgesehen davon hat das wie gesagt nichts mit LBP zu tun, sondern mit den gesetzlichen Vorschriften.
TEC21: Wo endet die LBP zeitlich? Und wie wird die langfristige Pfl ege fi nanziert?
Joachim Kleiner: Für Umgebungsarbeiten dauert die sogenannte Anwuchspfl ege zwei Jahre. In der Dokumentation gehen wir weiter als die normalen Garantiephasen: Wir sind der Meinung, dass es eine Erfolgskontrolle braucht. Hier gibt es ein Problem im System. Wenn ein Kanton eine Strasse baut, dann hat er ein Bauprojekt mit einer Finanzierung für die Realisierungszeit mit anschliessender Garantiezeit. Irgendwann wird die Rechnung abgeschlossen – dann ist die Landschaft aber noch nicht fertig. Also ist es ganz wichtig, sogenannte Pfl egekonzepte zu entwickeln, die an den Betreiber übergehen. Wenn man das Verursacherprinzip zu Ende denkt und das Problem korrekt lösen möchte, müsste man für die Finanzierung Geld auf die Seite legen. Bisher war so viel Geld vorhanden, dass sich immer eine öffentliche Kasse gefunden hat, um später anfallende Kosten zu decken. Mit der zunehmenden Kostenwahrheit, die bei der öffentlichen Hand gefordert ist, und mit diesen ganzen Spardiskussionen wird das ein Problem. Seit 20 Jahren werden Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen gefordert, da kommen Flächen zusammen, die etwas kosten.
TEC21: Wo sehen Sie zukünftigen Verbesserungsbedarf bei der LBP?
Joachim Kleiner: Das habe ich mich auch gefragt. Wir haben die Dokumentation geschrieben, und teilweise funktioniert das Instrument LBP jetzt. Aber eigentlich müsste man für einen grösseren Bekanntheitsgrad sorgen. Die LBP ist, im Vergleich zu Städtebau und Architektur, noch nicht zur Kultur geworden. Die Schweiz hat eine Kultur des Wettbewerbs entwickelt und damit eine gute Architekturqualität bekommen. Viele wichtige Bauten werden heute mit einem Wettbewerb gelöst. Bei der Landschaft ist das noch nicht so. Ich kann mir vorstellen, dass man bei grossen Projekten in eine ähnliche Richtung gehen muss. Meine Hoffnung ist, dass sich eine neue Kultur entwickelt, die die LBP als selbstverständlich ansieht. Die SBB haben etliche Brückenwettbewerbe für Teams bestehend aus Landschaftsarchitekten und Bauingenieuren ausgeschrieben. Ich fi nde, das ist ein guter Ansatz. Die Infrastruktur in der Schweiz wird weiter ausgebaut. Es wird darum gehen, die Landschaft attraktiv zu erhalten. Die Landschaft ist ein Standortfaktor, nicht nur für den Tourismus, sondern für die Lebensqualität grundsätzlich. Landschaftseingriffe können vieles kaputt machen, wenn sie nicht gut gemacht werden.
[ Joachim Kleiner, Professor für Landschaftsgestaltung, Hochschule für Technik in Rapperswil. Interview: Claudia Carle, Daniela Dietsche ]TEC21, Mo., 2008.01.28
28. Januar 2008 Claudia Carle, Daniela Dietsche
Mehr als ein Feigenblatt
In der Praxis hat die Landschaftspfl egerische Begleitplanung (LBP) häufig einen schweren Stand und umfasst oft nicht viel mehr als die Begrünung des Bauwerks. Doch was braucht es, damit der Faktor Landschaft in Planung und Ausführung als gleichberechtigter Projektbestandteil behandelt wird?
Die LBP ist als Planungsinstrument Teil der Projektierung eines Vorhabens. Je nach Projektart ist der Landschaftsarchitekt dabei federführend (z. B. bei Sportanlagen, Abbauund Rekultivierungsprojekten im Materialabbau, kleineren Fliessgewässern), oder er ist als begleitender FachpIaner im Planungs- oder Projektierungsteam vertreten, so in der Regel bei Bauten der Verkehrsinfrastruktur oder der Energieübertragung. Das Ziel bleibt unabhängig von der Rolle dasselbe: ein Bauwerk oder eine Nutzungsart ökologisch, funktional und gestalterisch optimal in Landschafts- und Siedlungsräume einzubinden. Ausgehend von einem umfassenden Landschaftsbegriff (vgl. Kasten) setzt sich die LBP auch mit den Qualitäten privater und öffentlicher Freiräume in der Siedlung und mit Aspekten der Ortsbildentwicklung auseinander, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Gestaltung von Lärmschutzbauten.
Dieser umfassende Ansatz in der Aufgabenstellung der LBP führt zu einer wichtigen Koordinationsrolle. Die LBP ist prädestiniert, schnittstellenübergreifend zu denken und gesamthafte Lösungen zu entwickeln. Dabei geht es um räumliche Schnittstellen (z. B. offene Landschaft – Baugebiet, Bauwerk – umgebendes Gelände), um fachliche Schnittstellen (zu Verkehrsplaner, Bauingenieur, Akustiker, Architekt, Geologe etc.), um funktionale Schnittstellen (Ökologie, Bodenhaushalt, Wasserhaushalt, Erholung, Kulturgüterschutz) und um administrative Schnittstellen (politische Grenzen, Projektgrenzen bei Aufteilung in Lose, Zuständigkeit verschiedener Fachstellen im Bereich Natur und Landschaft).
Frühzeitig einbeziehen
Wo verläuft die neue Strasse, die neue Hochspannungsleitung? Wo wird der Hochwasserschutzdamm des neuen Retentionsraumes platziert? In der Phase der strategischen Planung oder einer Planungsstudie mit Varianten besteht der grösste Handlungsspielraum, Konfl ikte frühzeitig zu erkennen und potenzielle Beeinträchtigungen für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zu vermeiden. Die Landschaftsverträglichkeit bei Standortentscheiden wird oft nur unzureichend geprüft und meist, ohne Landschaftsfachleute einzubeziehen. Bauliche Nutzungen ausserhalb des Siedlungsgebietes werden auf der Stufe der kantonalen oder regionalen Richtplanung festgelegt, wo andere Nutzungs- und Schutzinteressen meist grösseres Gewicht erhalten. Hinzu kommt in vielen Kantonen eine schwache Verankerung der Landschaftsentwicklung in der räumlichen Planung. Falls eine Standortentscheidung zu einem erheblichen Eingriff in einem landschaftlich hochwertigen Raum führt, wird in den meisten Fällen eine LBP verlangt, was impliziert, eine LBP könne jedes Projekt landschaftsverträglich machen. Dass dies nicht der Fall ist, liegt auf der Hand, aber die LBP kann ein Projekt an einem festgelegten Standort so optimieren, dass die Verträglichkeit mit der Landschaft und den ökologischen Eigenschaften entscheidend verbessert wird. In manchen Fällen kann sogar in Verbindung mit Massnahmen gemäss Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) Art.18b Abs.2 (siehe Kasten) eine ökologische und gestalterische Aufwertung der Gesamtsituation erzielt werden. Hierfür werden bereits in der ersten Planungsstufe die Weichen gestellt.
Schadensverhütung beginnt bei den Grundlagen
Weitere Voraussetzung für eine wirksame Strategie des «Vermeidens» ist eine sorgfältige Grundlagenerhebung. So muss zum Beispiel das lagegenaue Einmessen von Gehölzbe-ständen und Strukturelementen wie Trockenmauern Teil der ersten Vermessungsarbeiten durch den Projektingenieur sein. Dies erspart Nachmessungen und vor allem böse Überraschungen, wenn plötzlich ein gemäss Projektplan zu erhaltender Einzelbaum den notwendigen Geländeanpassungen entlang der neuen Strasse im Weg steht. Gleichzeitig sieht auch der projektierende Ingenieur die landschaftlichen Elemente von Beginn an auf seinem Grundlagenplan.
Eine projektbezogene, umfassende Bestandesaufnahme und Bewertung landschaftlicher und ökologischer Parameter, auch und gerade bei kleinen Eingriffsvorhaben, ist unverzichtbar. Der zu betrachtende Perimeter ist dabei abhängig vom zu erwartenden Einwirkungsbereich und kann für die einzelnen Schutzgüter Flora, Fauna/Lebensräume, Landschaft und Gewässer sehr unterschiedlich sein. Der Untersuchungsraum sollte grosszügig gewählt werden, denn dies lässt funktionale Zusammenhänge erkennen und schliesst gegebenenfalls den Einwirkbereich von Sekundärmassnahmen wie Anpassungen des Flurwegnetzes, Leitungen, Anlagen zur Abwasserbeseitigung ein, die oft erst in einer fortgeschrittenen Projektphase erarbeitet werden.
Sicher braucht es nicht für jedes kleine Projekt umfassende Geländeerhebungen, aber in der Regel liefern vorhandene Natur- und Landschaftsschutzinventare nur unvollständige und zum Teil veraltete Informationen. Betreffend Landschaftsbild sind projekt bezogene Erhebungen und Bewertungen der betroffenen Landschaft auf alle Fälle erforderlich, zumal wenn es um die Evaluation eines geeigneten Standorts geht. Bei der Bestandesaufnahme stellt sich für den beigezogenen Landschaftsarchitekten das Aufwandproblem, mit der Folge, dass in Konkurrenzsituationen hier oftmals wider besseres Wissen gespart wird. Eine angemessene Bestandeserhebung und Landschaftsbildanalyse kostet anfangs Geld und braucht Zeit, teilweise sogar bestimmte Zeiträume eines Jahres, um Vegetations- und Faunadaten zu erheben, unter Umständen auch mit beigezogenen Spezialisten. Daher auch hier ein Appell an die Projektträger: Je früher bei der Projektentwicklung an diese Erfordernisse gedacht wird, desto weniger «stören» diese den Projektablauf in zeitlicher und fi nanzieller Hinsicht. Das früh investierte Geld zahlt sich aus, weil nachträgliche Erhebungen oder aufwändige Projektänderungen reduziert werden.
Kann ein revitalisierter Bach die Hecke ersetzen?
Ist der Standort eines Vorhabens bestimmt, besteht die Aufgabe der LBP vor allem darin, das Gebäude oder die Anlage unter ökologischen und gestalterischen Gesichtspunkten zu optimieren. Die zwingend einzuhaltende Reihenfolge des planerischen Ansatzes lautet: zuerst alle Möglichkeiten ausschöpfen, unvermeidbare Beeinträchtigungen vermindern und einen bestmöglichen Schutz der Lebensräume, beispielsweise durch Absperrungen während der Bauphase, gewährleisten. Erst in einem weiteren Schritt geht es darum, die verbleibenden Beeinträchtigungen von schutzwürdigen Landschaften und Lebensräumen gemäss NHG durch Massnahmen zu kompensieren. Es wird dabei unterschieden zwischen Wiederherstellen und Ersetzen, und auch hier besteht eine Rangfolge: Erste Priorität hat die Wiederherstellung von zerstörten Lebensräumen an Ort und Stelle, zum Beispiel im Bereich von Flächen, die während der Bauphase benötigt wurden. Dabei ist zu beachten, dass eine funktionale Gleichwertigkeit gegeben ist und keine Beeinträchtigungen verbleiben. Diese Forderung ist in der Praxis nicht leicht umzusetzen: Eine nach der Bauzeit wiederhergestellte Hecke liegt jetzt am Rand der neuen Strasse. Die Gleichwertigkeit liegt nicht vor, da Zerschneidungseffekte die Vernetzungsfunktion herabsetzen und die Hecke beispielsweise für Vögel aufgrund der Vogelschlaggefahr weniger geeignet ist. Ist eine Wiederherstellung nicht oder nicht ausreichend möglich, werden Ersatzmassnahmen ergriffen. Für diese muss ebenfalls die funktionale und räumliche Bindung zum Ausgangslebensraum beachtet werden, es kann jedoch in begründetem und angemessenem Umfang davon abgewichen werden (z. B. Bachausdolung als Ersatz für eine Feldhecke), falls damit eine bessere ökologische und landschaftliche Gesamtwirkung erzielt wird. Entscheidend ist hier die erreichbare Qualität des Ersatzlebensraumes bezüglich Schutzwert und Integration in die Landschaft. Der zeitliche Faktor bleibt in den meisten Fällen unberücksichtigt. So kann eine junge Baumpfl anzung die ökologische und landschaftliche Gleichwertigkeit mit dem entfernten Altbestand erst nach etwa zwei bis drei Jahrzehnten erreichen. Die Bemessung der Art und des Umfangs der zu treffenden Kompensationsmassnahmen stellt ein grundsätzliches fachliches Problem dar, für das es verschiedene methodische Ansätze gibt,2 welche aber in der Praxis sehr unterschiedlich angewandt werden. Es ist festzustellen, dass bei der Festlegung der zutreffenden Massnahmen mangels wissenschaftlich ausreichend fundierter, nachprüfbarer und gleichzeitig praxistauglicher Methoden ein erheblicher Ermessensspielraum für die Fachplaner und die Bewilligungsbehörden besteht. Dies führt einerseits zu einer gewissen Ungleichbehandlung von Eingriffsvorhaben und zu einer oft nicht ausreichenden Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft. Andererseits sind dadurch Spielräume vorhanden für fl exible und umsetzungsorientierte Massnahmenkonzepte, was angesichts der langen Planungszeiträume von Vorteil ist.
Bei Eingriffen, die mit erheblichen Veränderungen des Landschaftsbildes einhergehen, ist neben der Kompensation der ökologischen Beeinträchtigungen die gleichzeitige Auseinandersetzung mit dem Erscheinungsbild des Bauwerks und den neuen Terrainformen die zentrale Aufgabe der LBP. Zu Wiederherstellung und Ersatz tritt hier die bewusste Gestaltung des Bauwerks und des umgebenden Geländes. Die Haltung bei der Landschaftsgestaltung ist abhängig von der jeweiligen Situation und reicht von Verstecken über Einfügen bis zu Kontrastieren und kann auch eine umfassende Neugestaltung der Landschaft notwendig machen. Die daraus resultierenden Eingliederungs- oder Gestaltungsmassnahmen fl ankieren die ökologischen Massnahmen, im Idealfall berücksichtigen sie beide Funktionen integral. Die Gestaltung des Bauwerks selber bleibt jedoch unabhängig davon eine zentrale Aufgabe.
Sichern als Massnahmen
Die enge Zusammenarbeit zwischen Landschaftsarchitekt und Projektingenieur bzw. Architekt ist in allen Phasen erforderlich. Im interdisziplinären Planungsprozess ist beim Projekt frühzeitig und bis zum Ausführungsprojekt zu überprüfen, ob vorgeschlagene Massnahmen wie Pfl anzungen überhaupt machbar sind (Abstände, Leitungen etc.). Landschaftspfl egerische Massnahmen benötigen in der Regel dauerhaft fachgerechte Pfl ege, um die beabsichtigte ökologische oder gestalterische Funktion sicherzustellen (Zufahrt zu einem Wiesenstandort, Klärung der Zuständigkeit für den Unterhalt). Daher sind Pfl egeund Unterhaltsaspekte ebenfalls schon früh einzubeziehen, mit den Betroffenen zu besprechen und zu sichern. Alle Massnahmen der landschaftspfl egerischen Begleitplanungmüssen als gleichberechtigte Projektbestandteile einfl iessen. So ist beispielsweise die Pfl anzung eines Baumes so ernst zu nehmen wie eine Entwässerungsleitung oder eine Feuerwehrzufahrt, das heisst, im Bauprojekt darzustellen, zu genehmigen und zwingend zu realisieren. Für sämtliche Massnahmen muss spätestens zum Zeitpunkt des Bewilligungsprojektes klar sein, wie diese rechtlich gesichert werden, und es müssen entsprechende Vereinbarungen mit den Grundeigentümern vorliegen. Da ökologische Ersatzmassnahmen meist ausserhalb des engeren Projektperimeters liegen, besteht die Gefahr, dass sie im Landerwerbsplan vergessen werden – mit fatalen Folgen.
In der Realisierungsphase sollten Landschaftsfachleute damit beauftragt werden, die fachgerechte Ausführung der Begrünungsarbeiten und der ökologischen Massnahmen zu überwachen sowie die Gestaltung zu begleiten. Dies ist gerade bei kleineren und mittleren Eingriffen zu wenig der Fall, mit der Folge, dass landschaftspfl egerische Massnahmen nur ungenügend umgesetzt werden – ein Problem, das durch mangelnde Vollzugsaufsicht der Behörden verschärft wird.
Doch was geschieht mit den landschaftspfl egerischen Massnahmen nach der Schlussabnahme? Vorausgesetzt, es sind alle Massnahmen gemäss bewilligtem Projekt gebaut bzw. umgesetzt worden, so bleibt immer noch die Frage: Erreichen die realisierten Massnahmen die mit ihnen bezweckten ökologischen und gestalterischen Zielsetzungen? Und in welchem Zeitraum? Die hierfür erforderlichen, an naturschutzfachlichen und landschaftsgestalterischen Zielen ausgerichteten Unterhalts- und Pfl egepläne sowie die Erfolgskontrolle sind bislang in nur wenigen Projekten verankert. In Projekten, die nicht UVPpfl ichtig sind und keiner obligatorischen Umweltbaubegleitung (UBB) unterstehen, ist diesbezüglich ein grosses Manko festzustellen. Hier fehlen in der Regel fi nanzielle und personelle Ressourcen. Ein weiteres Problem ergibt sich, falls die Erfolgskontrolle zeigt, dass die Zielerreichung der Massnahme mangelhaft ist. Nachbesserungen wären in diesem Fall angezeigt; aber wer bezahlt diese? Ein erster Schritt wäre sicher, dass die Pfl icht des Verursachers zur Erfolgskontrolle und zur Umsetzung allenfalls notwendiger nachträglicher Massnahmen Teil der Bewilligungsaufl agen wird.
[ Joachim Wartner, Dipl.-Ing. TUB Landschaftsarchitekt BSLA / SIA ]TEC21, Mo., 2008.01.28
28. Januar 2008 Joachim Wartner