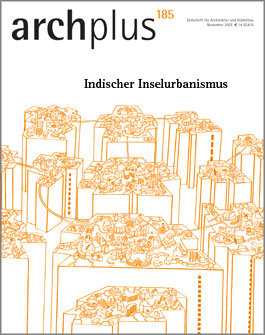Editorial
„I’m coming from where you’re going – and it’s not worth going there.“ In einer Parabel verpackt, berichtet Charles Correa in seinem Buch „The New Landscape“ von dem gegenseitigen Unverständnis, das zwischen den westlichen Hippies und wohlhabenden Indern im Indien der 1960er bis 70er Jahre herrschte. Die einen, die den materiellen Reichtum des Westens hinter sich gelassen und nun zerlumpt und barfüßig auf den Straßen Indiens nach einem tieferen Sinn des Lebens suchten, und die anderen, die ihren neu erworbenen Wohlstand stolz und ostentativ auslebten, fühlten sich durch den Anblick des jeweils anderen direkt angegriffen. Denn mit ihrem Lebensstil signalisierten sie einander, dass weder der Fortschritt noch das vermeintlich Authentische eines vormodernen Lebens „der Mühe wert ist“, also Erfüllung verspreche. „Ich komme daher, wo du hingehst – und es ist der Mühe nicht wert.“ Mit dieser knappen Formel bringt Correa, ein Altmeister der indischen Architektur, die Ambivalenz von Modernisierungsprozessen auf den Punkt.
In dieser Parabel begegnen sich Modernisierungsgewinner und -verlierer in vertauschten Rollen. Die Begegnung entmystifiziert ein Indienbild, das seit dem Ende des 18. Jahrhunderts im Westen, vor allem im deutschsprachigen Raum vorherrschte, in welchem Indien immer wieder als geistige Projektionsfläche gedient hatte. Der Indien-Mythos, der von der Romantik bis zum Aussteigertum der Hippie-Kultur reichte, speiste sich aus einem mutmaßlich ganzheitlichen Lebensmodell, welches das aufgeklärte Europa im alten Indien wiederentdeckt zu haben glaubte. Zugleich fungierte das Ideal Indien gewissermaßen als Kritik am Rationalismus der eigenen aufgeklärten Kultur und dem damit einhergehenden Verlust an Spiritualität. In diesem Sinne haben fast alle wichtigen Denker und Dichter der deutschen Romantik (u.a. Goethe, Novalis, die Brüder Schlegel, Schopenhauer) die altindische Kultur und deren Schriften rezipiert. Die Beschäftigung mit einem idealisierten antiken Indien diente, wie die indische Kulturwissenschaftlerin Miksha Sinha darlegt, auch der Vergewisserung und der Konstruktion der eigenen kulturellen Identität. Diese „asiatische Renaissance“, die mit einer „Asiatisierung“ des Denkens einhergeht, wie Peter Sloterdijk dies zugespitzt formuliert, bietet nach Sloterdijk und Sinha den Schlüssel für ein postkoloniales, multiperspektivisches Verständnis von Kultur und Identität, das heute wichtiger ist denn je.
Auch Architekten haben wiederholt im Geiste dieser Rezeptionsgeschichte die indische Architektur als Referenz angeführt. Adolf Behne entdeckte in seinen Volksbildungsvorträgen für die Sozialdemokratie im Jahre 1915 zwischen der indischen Architektur und der Gotik eine Seelenverwandtschaft. Für Bruno Taut und Hans Poelzig versprach der Osten gar die Rettung der als geistig verarmt empfundenen, westlichen Kunst. Aber selbst der Mystik unverdächtige Architekten wie Walter Gropius und Adolf Meyer ließen sich von der Orient-Euphorie anstecken und sahen in der indischen Architektur und Skulptur „ein Ziel“.
Was aber sagt uns Indien heute? Der Modernisierungsprozess, der das Land seit der Unabhängigkeit vor genau 60 Jahren erfasste, lüftete spätestens mit Beginn der verschärften Globalisierung und der Liberalisierung der Wirtschaftspolitik Anfang der 1990er Jahre den mystischen Schleier, nur um im Westen einem anderen Indienbild Platz zu machen: Aus der spirituellen „Weisheit“ des „gesuchten Landes“ (Hegel) ist ein global konkurrierendes „Wissen“ (IT) einer Wirtschaftsmacht geworden. Reinhold Martin und Kadambari Baxi weisen in ihrem Buch „Multi-National City“, aus dem wir Auszüge in Erstübersetzung bringen, die folgerichtige Entwicklung Indiens zu einem IT-Standort nach, eine Entwicklung, die im Zusammenhang mit der Modernisierung des Landes gesehen werden muss. Statt die jüngsten Auswüchse der Globalisierung, die lediglich eine weitere Stufe des Modernisierungsprozesses darstellt, als ahistorisch zu mystifizieren, wie es viele Kritiker häufig tun, zeichnen die beiden Autoren in einem virtuosen Bogen die Geschichte der indischen Moderne nach: die Aufbruchsstimmung der Nachunabhängigkeitszeit, von der Le Corbusiers Chandigarh und viele andere öffentliche Bauten und Projekte künden, die Identitätssuche der 1970er und 80er Jahre und die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Liberalisierung der 1990er Jahre (S. 56 ff.).
„Das gute Leben ist insulär“
Im Gegensatz zu dieser teleologischen Sichtweise betont Gyan Prakash, Historiker und Mitglied der bekannten Subaltern Studies Group, dass die sozio-räumliche Organisation der Stadt sich ahistorisch verhält. Ahistorisch in der Bedeutung, dass die urbane Entwicklung sich nicht unbedingt linearer im Sinne einer historischen Evolution à la Hegel vollzieht. Die Stadt als der Ort, an dem Modernisierungsprozesse in verschärfter Form ablaufen, sei kein Stadium im Übergang von Tradition zu Moderne, sie bringt keine Erlösung oder Verbesserung für alle, sie ist modern und vormodern zugleich. In ihr finden gegensätzliche Entwicklungen gleichzeitig statt, existieren unterschiedliche Entwicklungsstadien nebeneinander, ohne dass sie auf ein gemeinsames geschichtliches Ziel hinauslaufen (S. 28 f.). Darin folgt Prakash der Argumentation von Michel Foucault, der in seinem Essay „Andere Räume“ feststellt, dass die Zeit der teleologischen Erfüllung der Geschichte in einem linearen Fortschritt vorbei sei: „Wir sind in der Epoche des Simultanen, wir sind in der Epoche der Juxtaposition, ... des Nebeneinander, des Auseinander. Wir sind, glaube ich, in einem Moment, wo sich die Welt weniger als ein großes, sich durch die Zeit entwickelndes Leben erfährt, sondern eher als ein Netz, das seine Punkte verknüpft und sein Gewirr durchkreuzt.“ In dieser Beschreibung spiegelt sich die städtische Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts wider. Es ist eine Wirklichkeit, die von Zeitsprüngen durchlöchert ist: einerseits sprießen unaufhörlich neue Inseln des Wohlstands und des High-Techs hervor, andererseits existieren große Flächen und Bevölkerungsgruppen in prekärer Unterentwicklung und Armut. Diese extreme sozio-räumliche Diskrepanz ist Kennzeichen der urbanen Entwicklung Indiens, die wir in diesem Heft mit der These des Indischen Inselurbanismus zusammenfassen.
„Das gute Leben ist insulär“, schreibt Gautam Bhatia in seinem Beitrag (S. 89 ff.). Dieses Bonmot könnte stellvertretend für die gesamte räumliche Entfaltung heutiger Städte stehen. Von der Schaffung eines modernistischen homogenen Raums mit dem Ziel, gleiche Lebensbedingungen für alle herzustellen, haben die verantwortlichen Kräfte längst abgesehen: die Wirtschaft mit ihren Sonderwirtschaftszonen und den IT-Parks, die Gesellschaft mit den Wohlstandsenklaven des Mittelstands, den Gated Communities und Shoppingmalls, die Politik mit dem Fokus auf die Bereitstellung guter Investitionsbedingungen für private Investoren. Das Ergebnis ist eine Form des Inselurbanismus, wie er heutzutage zwar überall auf der Welt anzutreffen ist, in Indien jedoch ungekannte Ausmaße annimmt. In archplus 183 Situativer Urbanismus lieferten Urban Catalyst eine Definition für das Phänomen: „Räumlich manifestiert sich dieser „Unternehmerische Städtebau“ in einem „Inselurbanismus“: Investitionsrelevante Standorte werden als enklavenartige „Projekte“ bis ins letzte Detail geplant, die dazwischen liegenden Territorien verschwinden aus dem öffentlichen Bewusstsein.“ Dass die dadurch entstehenden urbanen Brachräume auch eine neue Freiheit für alternative Akteure bedeutet, wie Urban Catalyst feststellt, ist für den Westen neu. In Indien hingegen bilden gerade diese ambivalenten städtischen Zwischenräume die Existenzgrundlage von Millionen marginaliserter Stadtbewohner. Sie rücken sofort in diese Räume nach und besetzen und verteidigen ihre in Besitz genommenen Nischen, seien sie noch so prekär, da deren engmaschige Vernetzung mit der Stadt ihre einzige Überlebenschance darstellt (Philipp Rode, S. 86 f.). Die Enklaven des Wohlstands sind aufs Engste mit der flächendeckenden prekären Wohnsituation des Großteils der Bevölkerung verwoben. Der informelle Sektor mit seinem schier unerschöpflichen Reservoir von Niedriglohnarbeitern versorgt die neue Mittelklasse mit den notwendigen Dienstleistungen, ohne die sie gar nicht lebensfähig wäre. Diese symbiotische Beziehung, wenn man es so euphemistisch ausdrücken will, beschreibt Kiran Nagarkar in seinem Portrait von Mumbai als ein Merkmal der Lebensqualität dieser ansonsten dysfunktionalen Megastadt (S. 24 ff.). Unabhängig von einer moralischen Bewertung kommt eine kritische Stadtplanung nicht umhin, genau dort anzusetzen und zu untersuchen, wie sich dieser Zustand auf den Raum und dessen Nutzung auswirkt. Denn „was die Wohnviertel der Mittelschicht von den Slums trennt, ist nicht Zeit, sondern Raum; nicht bloß der physische Raum, sondern auch der Raum der Macht.“ (Prakash)
Der Rückzug des Staates
Während sich der Modernisierungsdiskurs der indischen Staatsgründung noch um den Gegensatz zwischen Stadt und Land entzündete, hat der Staat, wie es scheint, das Ziel einer gleichmäßigen Entwicklung inzwischen vollends aufgegeben. In 60 Jahren Unabhängigkeit vermochte der Staat nicht, das drängende Problem der städtischen Armut und einer angemessenen Wohn- und Infrastrukturversorgung zu lösen. Fast alle großmaßstäblichen Lösungsversuche haben stattdessen neue Probleme nach sich gezogen. So führen Sanierungsprojekte häufig dazu, dass die Menschen ihre wirtschaftliche Grundlage verlieren, sei es, dass sie aus der Stadt hinaus in abgelegenen Wohnsilos vertrieben werden und ihre Dienstleistungen nicht mehr oder nur unter erschwerten Bedingungen anbieten können. Sei es, dass in den zugewiesenen Wohnungen keine Möglichkeit und Räumlichkeit besteht, ihr Handwerk auszuüben und ortsnah an Kunden zu verkaufen. Dieses Unvermögen des Staates hat dazu geführt, dass die Menschen auf Selbsthilfe angewiesen sind und sich ein regelrechter Wirtschaftszweig von Nichtregierungsorganisationen (NGOs)herausgebildet hat, die sich als Intermediäre um jeden Aspekt des Lebens kümmern. Allerdings weiß man häufig nicht mehr, welche Agenda die vielen NGOs vertreten oder für wen sie kämpfen. Diese zivilgesellschaftlichen Prozesse des Interessensausgleichs werden zunehmend funktionalisiert und manipulativ eingesetzt, so dass vielfach private Investoren und der Staat eigene NGOs für bestimmte Zwecke gründen, beispielsweise um Slumbewohner zum Auszug aus ihren Slums zu bewegen und damit lukrative Entwicklungsflächen zu räumen. Mike Davis nennt dies NGO-Liberalismus (S. 70 ff.).
Gleichwohl funktioniert der demokratische Prozess in Indien erstaunlich gut, denn die Slumbewohner machen ausdrücklich Gebrauch von ihrem Wahlrecht. Dadurch sind sie eine nicht zu vernachlässigende politische Größe, allerdings konterkariert die so genannte „Vote Bank Politics“, sprich die einheitliche Stimmabgabe von ganzen Gruppen, ein effektives Durchsetzen eigener Interessen und verzerrt zudem regelmäßig die komplexe politische Realität vor Ort. „Die Betroffenen, die da opponieren, wissen bisweilen nicht einmal von ihrem Widerstand“, heißt es bei Solomon Benjamin und Bhuvaneshwari Raman, die in ihrem Beitrag für einen offensiven „okkupativen Urbanismus“ und eine „Politics of Stealth“ eintreten (S. 97 f.). Eindeutige Zuordnungen erweisen sich als unzureichend; es scheint, als könne man für fast jede Aussage gleich das Gegenbeispiel finden: NGOs als Vertreter der Armen oder als Manipulateure, die Slumbewohner als die Marginalisierten oder als Kleinunternehmer, als Stimmenpotenzial und Entwickler (CRIT, S. 84 f.). Die Verwaltung als unfähiger Wasserkopf oder als Refugium kollektiver Interessen. Vor der Prämisse, dass Planer zunehmend im Ungewissen agieren, sowohl was die Grundlagen als auch die Ansprechpartner betrifft, erscheinen die subversiven Strategien, die Solomon und Raman beschreiben, als fluide Aneignungsstrategien, die das Funktionieren des Gesamtorganismus gewährleisten. Die Besetzung öffentlicher Räume ist – entgegen westlicher Vorstellung – eine Folge, die sich aus dem Nutzungs- und Eigentumsverständnis ergibt, und nicht nur dem generellen Mangel an Raum geschuldet. Diese Form der Inbesitznahme trägt nicht nur zur – chaotischen oder bisweilen pittoresken – „Lebendigkeit“ der indischen Stadt bei, sondern produziert auch eine notwendige Toleranz.
Das Paradox der indischen Urbanisierung
Im Hinblick auf die überlastete, teilweise dysfunktionale Infrastruktur der indischen Metropolen, müsste das städtische System längst zusammengebrochen sein. Dass es weiterhin funktioniert, hängt unter anderem an der Eigeninitiative der Bewohner, die in vielen indischen Städten, vor allem in den Slums, eigene Versorgungssysteme entwickelt haben, die – trotz aller Missstände – erstaunlich gut funktionieren. Beispiele dafür sind das System der Dabba Wallas, die täglich mehrere Hunderttausend Essensrationen in der Stadt ausliefern, das informell organisierte Recyclingsystem in Mumbai oder informelle Kanalisationsleitungen in Slums. Martin Fuchs beschreibt in seinem Artikel eindrücklich das soziale Netzwerk und die Mechanismen der Selbstregierung, die in Dharavi, dem größten Slum Mumbais, existieren (S. 77).
Wie aber wird der Staat mit seinen Aufgaben in Zukunft zurechtkommen, wenn die Urbanisierung weiter voranschreitet? Denn zur Zeit, und da täuschen die indischen Megastädte in der Bilanz, liegt Indien mit einem Urbanisierungsgrad von 30 Prozent weit hinter der weltweiten Entwicklung zurück, die gerade die 50-Prozentmarke überschritten hat. Dass einige wenige Metropolen fast die gesamte Last der städtischen Entwicklung eines Landes tragen müssen, ist das „Paradox der indischen Urbanisierung“ (Ravi Ahuja, S. 38 ff.). Dieses ungleichmäßige Wachstum wird zu einer weiteren Verschärfung der bestehenden Probleme führen. Kann die Zivilgesellschaft sie alleine bewältigen? Welche Mechanismen der Planung, der Verwaltung und des Interessensausgleichs gibt es, um dieser Herausforderung zu begegnen? Die Konferenz Urban Age India, die im November 2007 in Mumbai stattfinden wird, wird sich mit der zentralen Frage, wie die größte Demokratie der Welt mit der fortschreitenden Urbanisierung und der dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung umgeht, befassen müssen. Urban Age – Das Zeitalter der Städte ist eine Konferenzreihe, welche die Alfred Herrhausen Gesellschaft in Zusammenarbeit mit dem Cities Programme an der London School of Economics and Political Science (LSE) ins Leben gerufen hat, um die Implikationen des weltweiten städtischen Wachstums mit allen Verantwortlichen aus Politik, Planung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zu diskutieren. Die Alfred Herrhausen Gesellschaft ermöglichte mit ihrer Unterstützung die umfangreiche Recherche und die Publikation von archplus 185. Ein besonderer Dank gilt Wolfgang Nowak (Sprecher der Geschäftsführung) und Ute Weiland sowie Jessica Barthel und Priya Shankar. Für die inhaltliche Zusammenarbeit danken wir dem Urban-Age-Team der LSE, insbesondere Ricky Burdett, Philipp Rode und Pamela Puchalski.
www.alfred-herrhausen-gesellschaft.de
www.urban-age.net
Anh-Linh Ngo, Kristina Herresthal, Anne Kockelkorn, Martin Luce