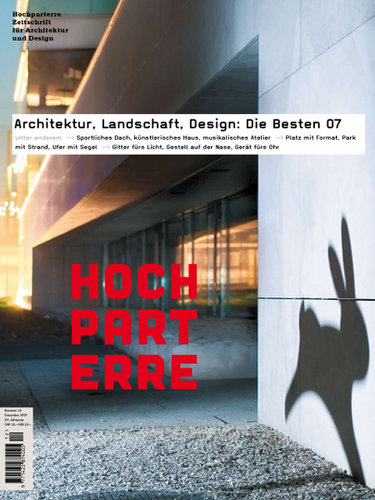Editorial
Die Besten 07
Dezember ist Bestenzeit. Wieder haben drei Juries die Besten 07 in Architektur, Landschaft und Design ausgezeichnet. Hochparterre schenkt jedem Preis eine Reportage und den Anerkennungen eine kleine Kritik. Der Kulturplatz des Schweizer Fernsehens wird seine Sendung vom 12. Dezember 2007 um 22.55 Uhr auf SF 1 den Besten widmen und im Museum für Gestaltung Zürich findet am 11. Dezember um 18.30 Uhr die Hasenfeier mit der Hasenrede statt. Alle sind eingeladen. Die Präsentation der Besten 07 im Foyer des Museums dauert bis zum 13. Januar 08. Die Besten sind ein Wettbewerb mit Pulverdampf und Augenzwinkern – ernsthaft aber geht es im Architekturwettbewerb zu und her. In der aktuellen Ausgabe von hochparterre.wettbewerbe dokumentiert Ivo Bösch:
--› Gästehaus der ETH Zürich mit Atelierbesuch bei ‹ilg santer›
--› Alterswohnungen in Adliswil
--› Wohnen in Zürich-Schwamendingen
--› Neubau Messehallen Allmend, Luzern
--› 100 Jahre Thurgauer Heimatschutz und der Erfolgswettbewerb: Trafostation Andhausen
--› Zuschlagstoff: Projekt verkauft
In drei Wochen ist Neujahr. Für Hochparterre beginnt ein besonders Jahr – wir werden zwanzig Jahre alt. Begonnen haben wir mit allerhand Spektakel im Schoss des Verlags Curti Medien mit Geld und Zuspruch von Beat Curti – heute sind wir eine respektable Firma mit gut zwanzig Leuten, gehören uns selbst und erfinden Stück um Stück rund um die Zeitschrift Hochparterre. Sie werden allerhand vernehmen in unserem zwanzigsten Jahr – und alle werden eingeladen zu einem grossen Fest im November. Und wie es Brauch und Sitte ist, erhalten die Abonnentinnen und Abonnenten auch mit diesem Heft Zugaben: Das eine über einen Wettbewerb der Hochschule für Technik Rapperswil ‹Jugend plant Freiraum›, das andere über die ‹Wohnzukunft in Zürich›. Köbi Gantenbein
Inhalt
06 Funde
09 Stadtwanderer: TRIBA Basel
11 Jakobsnotizen: Wind um jeden Preis
13 Stadt und Spiele: Blitzblank und kein Stau
14 Impressum
Die Besten
18 Architektur gold: Stadion Letzigrund Zürich
24 Architektur silber: Haus Müller Gritsch Lenzburg
28 Architektur bronze: Atelier Bardill Scharans
30 Landschaft gold: Max-Bill-Platz Zürich-Oerlikon
36 Landschaft silber: Glattpark Opfikon
42 Landschaft bronze: Ufergestaltung Yverdon
44 Design gold: Leuchtenserie aus Stäben
50 Design silber: Sonnenbrillen von Hand
52 Design bronze: Hörgerät als Schmuck
Anerkennungen
56 Architektur: Casa Solari in Gandria, Heim für Alzheimerkranke in Onex, Schulstiftung Steckborn, Casa dell’Accademia Mendrisio. Landschaft: Fontanapark in Chur, Tessinerplatz Zürich, Wohnsiedlung Grünauring in Zürich, Zoo Zürich. Design: Ski von Zai, Sessel von Wogg, Leuchte von Christophe Marchand, Kabinenmotorrad von Paraves
62 Die Nominierten im Überblick
Die Jury
64 Drei Sitzungen für neun Hasen
Bücher
68 Die besten Bücher, ausgewählt von den Preisträgerinnen: Romane von Mankell und Eco, Fachbücher über Brillen und Landschaftsökologie und Vogts Auslage
An der Barkante
71 Mit Severin Müller, Trophäenschnitzer, in der Kronenhalle
Man höre und staune
Das Leichtathletik- und Fussballstadion Letzigrund ist nicht nur eine elegante Architekturskulptur und eine Meisterleistung der Ingenieure, sondern auch ein Klangort: Der Klangspezialist Andres Bosshard hat sich während eines Fussballspiels umgehört und kommentiert die akustische und visuelle Direktheit und Transparenz.
Was ist das Sportzentrum Letzigrund für ein Klangort?
Während einem Fussballspiel ist das Stadion ein intensiver Klangort, ich würde sogar sagen ein Ruf- und Gesangsort. Er unterscheidet sich von anderen Stadträumen durch seine Offenheit. Tagsüber ist er sogar öffentlich zugänglich und bekommt damit eine Art Parkcharakter. Er hat ein klar definiertes Aussen: Auf der ums Stadion herum geführten Zugangsterrasse sind die Geräusche der Stadt präsent. Dann geht man durch eine tunnelartige Betonschleuse, der einzige Ort, der bei mir akustische Verwirrung
hinterliess. Höhepunkt aber ist die Arena selbst. Sie ist offen. Das Stadion ist akustisch gesehen eine spannende Mischform zwischen innen und aussen. Es verleiht dem Quartier eine eigene akustische Identität und ist einer der wichtigen Stadtklang-Brennpunkte von Zürich.
Die Form des Stadions ist aufgrund der Leichtathletikanlagen und der Sehwinkel der Zuschauer entstanden. Wie reflektiert die gewählte Geometrie Schall und Klang?
Das Oval ist die beste Form, um akustisch überhaupt nicht zu erscheinen, noch besser als die Kreisform. Man hört im Letzigrund förmlich, dass die Ecken fehlen, sie würden einen akustischen Fokus bilden. Akustisch gesehen hat der Torwart wahrscheinlich am meisten Sound, er steht im Brennpunkt der Kurven. Schön ist, dass man den offenen Raum auch akustisch spürt. Denn die Seitenwände sind so weit auseinander, dass sie bei der Dämpfung des Klangs keine Rolle mehr spielen. Hingegen ist der Raum auf der Nordseite des Stadions, dort wo die beiden Trainings-Spielfelder an die Nachbarhäuser grenzen, viel mehr akustischer Innenraum als das Stadion selbst. Wenn man so will, ist die Akustik umgestülpt: aussen der Innenraum, innen der Aussenraum.
Welche Wirkung hat die räumliche Offenheit auf die Akustik?
Das Stadion unterscheidet sich von anderen Stadien, in denen der Baukörper die Stimmen der Zuschauer zurückspiegelt und eine soziale Sphäre bildet. Im Letzigrund entsteht – nicht nur akustisch – kein Massengefühl und trotzdem entsteht keine Leere. Eine schöne Balance zwischen Offen- und Geschlossenheit.
Welche Rolle spielen Akustik und Klang für die Stimmung in einem Stadion?
Die akustische Orientierung ist eine Grundlage für Kommunikation und für Gemeinschaft. Für die Emotionen der Zuschauer ist die Akustik deshalb ein zentrales Element. In einem Stadion will sich der Zuschauer von den Emotions-Wellen, die das Spiel auslöst, mittragen lassen.
Was ist das Sportzentrum Letzigrund für ein Klangort?
Während einem Fussballspiel ist das Stadion ein intensiver Klangort, ich würde sogar sagen ein Ruf- und Gesangsort. Er unterscheidet sich von anderen Stadträumen durch seine Offenheit. Tagsüber ist er sogar öffentlich zugänglich und bekommt damit eine Art Parkcharakter. Er hat ein klar definiertes Aussen: Auf der ums Stadion herum geführten Zugangsterrasse sind die Geräusche der Stadt präsent. Dann geht man durch eine tunnelartige Betonschleuse, der einzige Ort, der bei mir akustische Verwirrung hinterliess. Höhepunkt aber ist die Arena selbst. Sie ist offen. Das Stadion ist akustisch gesehen eine spannende Mischform zwischen innen und aussen. Es verleiht dem Quartier eine eigene akustische Identität und ist einer der wichtigen Stadtklang-Brennpunkte von Zürich.
Die Form des Stadions ist aufgrund der Leichtathletikanlagen und der Sehwinkel der Zuschauer entstanden. Wie reflektiert die gewählte Geometrie Schall und Klang?
Das Oval ist die beste Form, um akustisch überhaupt nicht zu erscheinen, noch besser als die Kreisform. Man hört im Letzigrund förmlich, dass die Ecken fehlen, sie würden einen akustischen Fokus bilden. Akustisch gesehen hat der Torwart wahrscheinlich am meisten Sound, er steht im Brennpunkt der Kurven. Schön ist, dass man den offenen Raum auch akustisch spürt. Denn die Seitenwände sind so weit auseinander, dass sie bei der Dämpfung des Klangs keine Rolle mehr spielen. Hingegen ist der Raum auf der Nordseite des Stadions, dort wo die beiden Trainings-Spielfelder an die Nachbarhäuser grenzen, viel mehr akustischer Innenraum als das Stadion selbst. Wenn man so will, ist die Akustik umgestülpt: aussen der Innenraum, innen der Aussenraum.
Welche Wirkung hat die räumliche Offenheit auf die Akustik?
Das Stadion unterscheidet sich von anderen Stadien, in denen der Baukörper die Stimmen der Zuschauer zurückspiegelt und eine soziale Sphäre bildet. Im Letzigrund entsteht – nicht nur akustisch – kein Massengefühl und trotzdem entsteht keine Leere. Eine schöne Balance zwischen Offen- und Geschlossenheit.
Welche Rolle spielen Akustik und Klang für die Stimmung in einem Stadion?
Die akustische Orientierung ist eine Grundlage für Kommunikation und für Gemeinschaft. Für die Emotionen der Zuschauer ist die Akustik deshalb ein zentrales Element. In einem Stadion will sich der Zuschauer von den Emotions-Wellen, die das Spiel auslöst, mittragen lassen.
Weil das Letzigrund in erster Linie eine Leichtathletik-Arena ist, sind die Fussballfans nicht glücklich über die Akustik. Was raten sie Ihnen?
Es stimmt, die Fans müssen sich mehr anstrengen als im alten Stadion, denn es ist viel schwieriger, im neuen Stadion Stimmung zu erzeugen. Doch ich würde ihnen empfehlen, ein paar Klangexperimente durchzuführen, um die Wirkung ihrer Chöre zu optimieren. Von einer baulichen Optimierung, beispielsweise mit Plexiglas-Platten rund um die obersten Ränge, halte ich wenig: Man könnte die Akustik damit zwar verbessern, aber wenn die Fans von sich aus eine freche Antwort auf das neue Letzigrund finden, ist das doch viel spannender. Denn das Stadion ist auch akustisch gesehen ein offenes Spielfeld.
Wie beschreiben Sie den Klang des Stadions?
Das Dach und die schrägen Stützen geben dem Stadion ein eigenständiges Klangprofil. Nur hier klingt Zürich so. Man spürt die Materialien, die man sieht: Den Rasen, die Holzdecke, die Stahlstützen, die Kunststoffstühle, die Betonkonstruktion – auch von der Stadt habe ich einen schönen Klangeindruck. Besonders gefällt mir, dass der Massengesang aus den Fankurven während eines Fussballspiels nicht akustisch verstärkt und doch sehr präsent ist. Diese Art der unverstärkten Gesangseinlagen ist der Pop- und Rockmusik abhanden gekommen. Kämen die Chöre aus Lautsprechern, wären sie banal.
In welchem Verhältnis steht die akustische mit der visuellen Direktheit?
Wir haben wenig Hörerfahrung mit so grossen Baukörpern, die derart gedämpft sind. Die akustische Dämpfung im Dach verstärkt den Eindruck des Schwebens. Das Dach gibt dem Raum also auch akustisch eine Weite. Nicht nur wegen der Architektur, sondern auch weil der Raum den Klang nicht so reflektiert, wie wir uns das gewöhnt sind – ich denke hier an die schrägen Stahlstützen –, entsteht der Eindruck der Weite. Sie entspricht dem, was ich sehe. Einige Irritationen entstehen bei den Materialien und der Technik: Ich kann die Durchsagen und die Musik nicht klar den Lautsprechern zuordnen und wir können aufgrund der akustischen Reflexionen nicht sagen, ob die Untersicht der Decke wirklich mit Holz verkleidet ist. Die Gestaltung fordert das Ohr heraus.
Wie steht es um die akustische und visuelle Transparenz?
Sie manifestiert sich beim umstrittenen Stahlzaun rund ums Stadion. Auch ich war am Anfang skeptisch. Ich fand die eng aneinandergereihten Stahllatten zu schroff und hart. Doch der Zaun entspricht der visuellen Durchlässigkeit des Stadions und lässt einen beim vorbeifahren mithören, was im Innern läuft. Insofern vermittelt das Letzigrund innen wie aussen die aktuelle Stimmung. Diese hohe Kommunikationsfähigkeit sollte ein öffentlicher Raum in der Stadt haben.
Bei der Planung des Stadions hat man in erster Linie darauf geachtet, dass möglichst wenig Lärm nach aussen dringt. Wie wird dieses Ziel eingelöst?
Das riesige Dach schluckt zwar viel Schall, das Stadion wäre aber noch weniger im umliegenden Stadtraum zu hören, wenn man auch noch die Fassade des Stadions gegen die Stadt hin schallisoliert und damit auch den Aussen-Resonanzraum gedämpft hätte.
Kann man differenzieren, was im Stadion Letzigrund Klang ist und was Lärm?
Die Gesänge der Fankurven kommen direkt und aktiv auf mich zu. Die Chöre haben eine Qualität, ich würde sie sogar als Musik oder zumindest als aktiven Stadtklang bezeichnen. Sobald sie aber nach aussen dringen und der Kontext verloren geht, werden sie zu Lärm. Unbeabsichtigter Klang, dem ich mich nicht entziehen kann, wird zu Lärm. Als Klangabfall würde auch ich die Musik, die Kommentare des Stadion-DJs und die Werbejingles bezeichnen, mit denen die Zuschauer vor und nach dem Spiel berieselt werden. Aber das gehört heute scheinbar zum Ritual einer Sportveranstaltung. Was aber nicht heisst, dass man nicht besser und intelligenter mit diesem Klang-abfall hätte spielen können: Wenn beispielsweise die Musik sich langsam bewegen und damit den Raum ein bisschen nachzeichnen würde, würde das der architektonischen Eleganz des Stadions entsprechen. Derzeit hat der Klangabfall mit dem Raum nichts zu tun, es herrscht Warenhausbeschallung.
Sie haben Erfahrung mit Klanginstallationen an städtischen Brennpunkten. Was hätten sie anders gemacht, wenn Sie am Brennpunkt Stadion mitgeplant hätten?
Man muss zwischen dem ‹Instrument›, also dem Stadion, und wie man darauf spielt unterscheiden. Ich finde die Akustik und den Raum des ‹Instruments› toll. Die elektro-akustische Anlage hingegen empfinde ich als nicht zeitgemäss, es gibt Lautsprecher, die besser klingen. Beim Rasen hat man auch nicht auf Qualität verzichtet, wieso beim Klang? Ich denke, man hätte mit der Musikanlage gestalterischer umgehen können – man kann mit Klang sehr wohl soziale Räume mitgestalten. Das erlauben die Lautsprecher nicht und es wird hier nicht getan.
Das Künstlerpaar Relax hat als eine der Kunst-und-Bau-Arbeiten eine Klanginstallation fürs Stadion konzipiert: Gelächter und Weinen drehen ihre Runden im Oval. Ist ein Stadion der richtige Ort für diese Art Kunstinstallation?
Ja, ich glaube schon. Das Letzigrund ist sehr wohl ein Ort für Kunst und Kultur im Stadtraum, hier liegt sehr viel Potenzial brach. Doch die Kunst-und-Bau-Arbeit von Relax hört nicht zu, ist nicht interaktiv. Deshalb sind die Fanchöre im Vergleich frischer und frecher – elementare Emotionen bringen sie direkter.
Kommentar der Jury:
Überzeugt hat die Jury vor allem, dass das Stadion Letzigrund nicht nur eine elegante Architekturskulptur ist, sondern auch ein städtebauliches Projekt. Das eingegrabene Spielfeld macht der Zugang auf Strassenniveau möglich, eine Voraussetzung für die sanfte Einbettung ins Quartier. Die Arena besteht aus nur wenigen Elementen: die Mulde mit dem Spielfeld, die Erschliessungsrampe, die auf Strassenhöhe beginnt, zwei Geschosse ansteigt und wieder sinkt, und das schwebende Dach. Es ruht auf dem Ingenieursmeisterstück, den ‹tanzenden Stützen›. Das Oval ist öffentlicher Sportplatz, Austragungsort des internationalen Leichtathletik Meetings, Konzertarena und Fussballstadion.hochparterre, Mi., 2007.12.19
19. Dezember 2007 Roderick Hönig
verknüpfte Bauwerke
Stadion Letzigrund
Am Strand von Opfikon
Sandburgen bauen und Streckenschwimmen. Beach-Volleyball und Skaten auf der fünf Meter hohen Rampe. Am offenen Feuer Würste und Steaks braten oder einfach nur unter Platanen einen Schwatz halten. Der Opfikerpark zwischen Zürich und dem Flughafen bietet alles.
So hat noch keine Schweizer Gemeinde ein entstehendes Quartier den Investoren übergeben: Mit einem funktionierenden ‹Herz›, einem Park mit Sportanlagen, Räumen für Begegnungen und Sandstrand. Der Opfikerpark war fertig, als die ersten Mieter in die neu erstellten Wohnungen einzogen: Umgebung vor Hochbauten.
Opfikon, Zürichs Nachbarstadt im Glattal, hat gehandelt, als in den Neunzigerjahren klar wurde, dass das Oberhauserriet nach rund 50 Jahren Planungsdiskussionen – oft war die Rede von der «teuersten Wiese Europas» – nun überbaut wird. Der Ort war ziemlich unwirtlich. Eine ehemalige Sumpffläche, für die Landwirtschaft drainiert, lag offen hinterm Fernsehstudio und den Bürobauten Leutschenbachs. Am Nordrand die sechsspurige Autobahn, im Osten die Kläranlage und der Ausbildungsplatz für den Zivilschutz, flankiert von der begradigten und kanalisierten Glatt – kaum eine Spur von Natur.
2001 wurde ein Wettbewerb für eine regionale Parkanlage ausgeschrieben, die zum Zentrum des künftigen Stadtquartiers werden soll. ‹Agglos Traum› hiess das Siegerprojekt von Gabriele G. Kiefer aus Berlin, einer der zur Zeit führenden deutschen Landschaftsarchitektinnen. Sie hat hier ihr Credo umgesetzt: «Wenn es um die Entwicklung in der Peripherie geht, muss Landschaftsarchitektur ein Stück Urbanität schaffen.» So ist aus dem freien Feld in Opfikon ein klar strukturiertes Gebiet geworden. – In der Schweiz sei eine konsequente Ausführung einer solchen Planung deutlich einfacher umzusetzen als in Deutschland, «wo auch bei der Planung immer alle dreinreden», zieht Gabriele G. Kiefer zufrieden Bilanz.
Aushub als Lärmschutz
Die Akzeptanz des Parks bei den Nutzern ist hoch. Schon im ersten Sommer waren hier nicht nur die neu zugezogenen Quartierbewohner anzutreffen, sondern auch Leute aus der Umgebung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fernsehstudios und der Bürokomplexe rundum nutzen den 400 Meter langen See zum Streckenschwimmen. Andere kommen zum Joggen oder einfach nur zum Ausruhen. Die Jugend hat die Sportplätze in Beschlag genommen und die fünf Meter hohe Steilrampe am Autobahn-Lärmschutzwall wird mit allem befahren, was Räder hat. Hauptattraktivität des Parks ist der See mit seiner urbanen Klarheit, überspannt von drei Brücken und den zwei unterschiedlich gestalteten Ufern – hier Sandstrand, dort Schilf. Damit dem See das Wasser nicht ausläuft, mussten zuerst die alten Drainagerohre ausgegraben und der Grund abgedichtet werden. Nur noch in ihrem obersten Teil sichtbare, massive Betonmauern – bis zu sieben Meter hoch – stehen am Ufer. Über die Höhe der Mauerbrüstungen gabs einige Diskussionen. Gabriele Kiefer erinnert sich, wie sich Haftungs- und Gestaltungsfragen in die Quere kamen: «Während es an natürlichen Seen selbstverständlich ist, dass Ufermauern keine Absturzsicherung Kunstprodukt.» Die Kanzelbrüstungen, die darauf montierten massiven Rohre, aber auch der nur sanft abfallende Sandstrand sind solche Sicherheitselemente, die zusammen mit der Beratungsstelle für Unfallverhütung entwickelt wurden. In der Mitte ist der See allerdings schwimmtauglich – immerhin drei Meter tief.
Und auf Ökologie wurde geachtet. Der Seegrund wurde mit dem Ton aus dem vorhandenen Aushubmaterial abgedichtet, der insgesamt zehn Meter hohe Autobahn-Lärmschutzwall wurde ebenfalls aus diesem Material aufgeschüttet und ist als Magerpflanzen-Gebiet angelegt. Die Steine am Schilfufer des Sees lagen ebenfalls vor Ort im Boden. «Nur den Sandstrand haben wir mit zugeführtem Material verfeinert», so Projektleiter Patrick Altermatt, Partner im Zürcher Landschaftsarchitekturbüro Hager, das das Projekt vor Ort leitete.
Regulierter Wasserstand
In den Schilfgürteln wachsen Seerosen und Iris und hier nisten Enten und Vögel und das Schilf reinigt das Wasser. Es wird vom Westwind durch die Wurzeln gedrückt, dahinter abgesogen und ans Nordende des Sees gepumpt. Von dort fliesst es durch eine Sandschicht wieder zurück. Der Schilfgürtel, der die Nährstoffe aus dem Wasser aufnimmt, wird künftig im Sommer teilweise gemäht. Sollte die Algenbildung zu intensiv werden, kommt – wie in den Uferpartien der grossen Seen – das Saugboot zum Einsatz. Der Wasserstand im neuen See schwankt bis zu 50 Zentimeter. Gespiesen wird er unter anderem vom Meteorwasser der Überbauung. Sinkt der Pegel zu tief, wird nachgepumpt, steigt er zu hoch, sorgt ein Überlauf für den Abfluss in die Glatt. Dort, in Flussnähe, wurden die Wald-Restparzellen durch typische Flussufer-Gehölze ergänzt. Die Kanzeln am See und die nördliche Promenade sind mit geschnittenen Platanen bepflanzt, die rasch ein geschlossenes Dach bilden werden.
«Der Park kann mit den Bedürfnissen wachsen», erläutert Patrick Altermatt. Es können nicht nur mehr Bänke aufgestellt oder Feuerstellen eingerichtet werden. Die nicht mehr genutzten Teile der Kläranlage mit den runden Absetzbecken sollen später Teil der Anlage werden. Die Betonmauer über der Rampe am Nordabschluss kann für eine später zu bauende Velo- und Fussgängerbrücke über die Autobahn geöffnet werden. Insgesamt wird der Nutzungsdruck noch markant steigen, denn in der Umgebung werden in wenigen Jahren rund 10 000 Menschen arbeiten und wohnen, was Gabriele G. Kiefer allerdings wundert, «in die-ser peripheren Lage und bei so viel Fluglärm».
Schweizer vorsichtiger
Der grosszügige Opfikerpark war im Wettbewerbsprojekt noch vielfältiger. Der Kostendruck zwang zu einigen Abstrichen. Die 23 beteiligten Grundeigentümer haben zwar den Boden gratis abgetreten, doch die Perimeter-Beiträge reichten nicht aus, das Projekt voll zu finanzieren. Wäre das ursprüngliche Wettbewerbsprojekt umgesetzt worden, hätte das rund 24 Mio. Franken gekostet. Schliesslich standen 10 Millionen von Grundeigentümern und 7,5 Millionen aus der Stadtkasse Opfikon zur Verfügung. Schritt für Schritt soll die Anlage dennoch weiter ausgebaut werden. Die Rede ist von einem Kiosk- und WC-Bau bei der Haltestelle ‹Fernsehstudio› der Glattalbahn.
Entstanden ist der Park im grossen Team mit Bau- und Wasserbauingenieuren, mit Licht- und Elektroplanern. Gabriele G. Kiefer arbeitete ihrerseits mit dem Zürcher Landschaftsarchitekturbüro Hager zusammen, für das sie selbst zuvor in Berlin eine Bauleitung übernommen hatte. Obwohl man sich lange kennt, waren für die Zusammenarbeit mit so vielen Beteiligten ein paar Übersetzungshilfen nötig. Gabriele G. Kiefer: «Trotz scheinbar gleicher Sprache verstanden wir manchmal Unterschiedliches. Mitunter hab ich vor allem die Herren vom Amt wohl auch etwas überfahren, denn bei uns sind die Diskussionen kontrovers und heftig – bei euch in der Schweiz ist alles viel vorsichtiger, langsamer.» An eine solche kurze Auseinandersetzung mit einem Bauleiter erinnern sich die Beteiligten «Erklären sie mir, wie ich das machen soll», ergänzte aber umgehend: «Ich machs dann sowieso anders».
Kommentar der Jury:
Der Opfikerpark liegt in einem ehemaligen Sumpfgebiet, das sich in einen urbanen Stadtteil wandelt. Der Park beeindruckt durch seine Grösse, die für die Schweiz ein Novum ist, und seine schlichte Gestaltung. Die lang gestreckte Wasserfläche bildet eine Zäsur zwi--schen den Wohnüberbauungen und dem freien Raum der Wiese dahinter. Dank der frühzeitigen Realisierung des Opfikerparks reagierte die entstehende Stadt auf den Freiraum, um möglichst vielen Wohnungen den Bezug zum Wasser zu geben. Kontrovers diskutiert wurden die Lage und die Gestaltung der Brücken: Sie sind relativ massiv, zerschneiden die Perspektive und brechen dessen Grosszügigkeit.hochparterre, Mi., 2007.12.19
19. Dezember 2007 René Hornung
Italianità auf der Nase
Diese Sonnenbrillen sind gut gestartet. Sie verbinden Stil und Funktion: Ihr Bügel lässt sich wie eine Haarklammer biegen und macht die Brille flach; praktisch zum Verstauen. Trotzdem lässt sich stets etwas verbessern und für die nötige Aufmerksamkeit muss gesorgt werden.
Im Januar ging der Zweipersonenbetrieb an den Start. Strada del Sole sind die Industrial Designerin Sandra Kaufmann und der Optikermeister Markus Dudli (HP 8/07). Ihre erste Kollektion umfasst sieben Sonnenbrillen in verschiedenen Ausführungen. Aufsehen erregt sie, weil sie dank Bügel aus geschlitztem Federstahl enorm flach zusammengelegt werden kann: Mit einem Klick schmiegen sich die Bügel an die gewölbte Kurve der Brillengläser, die sich so in jede Gesässtasche schieben lassen. Was hat sich im letzten halben Jahr getan? Die Markteinführung ist gelungen, Strada del Sole wird wahrgenommen, auch international. Der Auftritt stimmt, der Name verfängt und sachte beginnen die beiden Unternehmer darüber nachzudenken, was Strada del Sole als Label sonst noch bieten kann – ausser dem Kaffee, den sie aus Lust an der Italianità in silbern verpackten Beuteln verkaufen.
Doch den Brillen gehört ihre erste Leidenschaft. Dass die Kollektion Strada del Sole 001 – 007 ankommt, bestätigen ihnen die Einkäufer, die sie an zwei internationalen Messen trafen. Im Januar waren sie an der Opti München, im Oktober an der Silmo Paris, an der ihre Brillen in der Kategorie ‹Montures innovation technologique› für ihre technologische Neuerung an der Fassung nominiert waren. Frisch wirkt der Stand, den Bob Klenk für die Messe-auf-tritte gestaltete: eine blendend weisse Konstruktion, bevölkert von weissen Sori Yanagi-Hockern, auf der hellen Wand hebt sich das Logo ab. Auf dem Empfangstisch blitzt die Kaffeemaschine, dahinter arbeitet der Barista. Die Idee: süditalienische Mittagssonne, so hell, dass sich die Kunden schnell die Sonnenbrillen aufsetzen, die in Präsentationskartons bereit liegen.
Zurücklehnen können sich die beiden nicht. Die Modelle 008 – 014 sind am Start. Sonnenbrillen sind ein saisonales Geschäft, alle halbe Jahre braucht es Neuheiten. Für Strada del Sole dienen die neuen Modelle auch dazu, die Kollektion zu überprüfen, auf Anregungen von Optikern und Kundinnen einzugehen. Für Industrial Designerin Sandra Kaufmann ist das normal: Ein Produkt kann stets optimiert werden. Dabei geht es ihr um funktionale Verbesserungen. So rückte sie die Ansatzstelle der Nasenpads etwas hoch, wodurch man den Sitz der Brille auf der Nase richten kann. In diese Pads werden Silikonprofile geschoben, die man je nach Brei-te der Nase dünner oder dicker wählt. Eine Silikon-einlage erhielten auch die beiden Bügel-enden, damit die Brille besser sitzt.
Das Material und dessen Bearbeitung haben Sandra Kaufmann und Markus Dudli auch überprüft. Verwendet wird immer noch Federstahl. Aber sie haben den Lieferanten und den Härtegrad gewechselt. Ausserdem behandeln sie die Oberflächen anders: Statt geschliffen werden diese nun inwendig sandgestrahlt, womit bis hin zu den Scharnieren eine homogene Fläche erreicht wird und keine Lötflecken mehr sichtbar sind. Mit dem zusätzlichen Vorteil, dass so die Oberfläche resistenter gegen Schweiss wird; so lösen sie ein Hauptproblem bei Brillenfassungen.
Der Optiker rät
Formal haben sich die Modelle 001 – 007 bewährt. Doch der eine oder andere Typ fehlte, etwa die sportliche Brille für das breite Gesicht. Der Vergleich zeigt: 008 – 014 treten entschiedener auf – sowohl die klassischen Brillentypen, als auch die extremen Formen. Die Pilotenbrille lässt die Erinnerung an klassische Ray Bans hinter sich und wirkt zeitgemässer; die schmalen Formen werden noch schmaler, der toughen Geschäftsfrau ins Gesicht geschnitten. Was Sandra Kaufmann von den Optikern hörte, die die Modelle verkaufen, freut jede Designerin: Der klappbare Bügel und die Klammer, mit der die Gläser in der Fassung gehalten werden, wurden zwar als zeitgemäss, die Formen der Brillenfassung jedoch als eher konservativ beurteilt. Sie nimmt es als Aufruf, formal mehr zu wagen, das Sortiment mit extravaganten Modellen zu ergänzen.
Die Kollektion soll nicht vergrössert, sondern laufend aktualisiert werden. Dabei tauschen Sandra Kaufmann und Markus Dudli schwächere Modelle mit besseren aus, tüfteln an der Farbe des Glases. Auch das Material steht zur Debatte: Nach Paris nahmen sie vier Brillen in Rotgold mit. Die sind gut angekommen, obwohl Gold in diesem Segment als unmögliche Wahl gilt. Sicher ist nur: Für die Metallkollektion behalten sie den Bügel mit dem Klick bei. Wie wird die nächste Kollektion aussehen? Sandra Kaufmann denkt an eine Brille aus Kunststoff, welche die Formensprache von Strada del Sole aufnimmt.
Und wann kommt die Korrekturbrille? Die Nachfrage ist da. Doch Strada del Sole will langsam wachsen. Der Markt für Korrekturbrillen ist viel grösser, da müssten sie rund zehn Mal mehr Brillen produzieren. Ausserdem trägt man im Unterschied zur Sonnenbrille eine Korrekturbrille im Schnitt vier Jahre, 14 Stunden täglich. Also soll erst die Sonnenbrille perfekt sein, bevor sie sich an die anspruchsvolle Korrekturbrille wagen wollen.
Vereinfachtes Produzieren
Doch es geht auch darum, das Geschäftsrisiko im Griff zu halten. Denn mit der Erweiterung der Kollektion hat sich die Bestellmenge vergrössert. Sandra Kaufmann und Markus Dudli produzieren selbst und finanzieren die Produktion vor. Von den Optikern verlangen sie eine handelsübliche Mindestabnahme von fünfzehn Stück. Obwohl sie Arbeit für zwei Mitarbeiter hätten, stecken sie noch in der Aufbauphase, können sich das nicht leisten.
Die gesamte Produktionszeit einer Brille von der Materialbestellung bis zur Konfektion beträgt bis zu drei Monaten. Das liegt an den verschiedenen Schweizer Zulieferfirmen und daran, dass sie den Schnappbügel – Herzstück der Brille – immer noch selbst herstellen. Doch das wird beim derzeitigen Volumen problematisch, der Gedanke, die Produktion auszulagern, vielleicht nach Japan, drängt sich auf. Liegt es da nicht nahe, grösser zu werden, Kapital aufzunehmen? Der Gang zur Bank ersparen sie sich, im Wissen darum, dass in Handwerk, wie sie sagen, kaum investiert wird. Und Investoren, die sich an der Firma beteiligen, möchten sie keine, denn die Beispiele von Designern, die ihre Firma vergrösserten und am Schluss auf der Strasse standen, schrecken sie ab. Lieber unabhängig bleiben. Sandra Kaufmann und Markus Dudli, die je genau hälftig beteiligt sind, mögen den kurzen Dienstweg. Gibt es Probleme, wird so lange diskutiert, bis die Lösung gefunden ist. Sandra Kaufmann kümmert sich um Design, Markus Dudli um Vertrieb und beide um Produktion und Marketing. Immerhin, mit Bob Klenk und Reto Gehrig, dem Ausstellungsgestalter und dem Grafiker, die Logo, Webauftritt und Kundeninformationen gestalten, haben sie sich zusätzliche Köpfe ins Boot geholt. So tüfteln sie daran, wie die Produktion vereinfacht, wie Verkauf und Vertrieb verbessert werden können. Denn beiden ist klar: Ohne die Erfindung Schnappbügel hätten sie weniger Aufwand, aber auch weniger Kunden.
Sonnenbrillen 001 – 007 und 008 – 014
Strada del Sole ist ein junges Brillenlabel aus Zürich, das mit einer äusserst flachen Sonnenbrille diesen Frühling auf den Markt kam.
--› Design und Hersteller: Strada del Sole, Zürich
--› Preis: ab CHF 350.–
Kommentar der Jury:
Wer mit Sonnenbrillen sein Geschäft machen will, muss sich zwischen Gucci, Prada und Polaroid auf einem label-gesättigten Markt bewähren. Kommt dazu, dass Strada del Sole, hinter dem die Industrial Designerin Sandra Kaufmann und der Optikermeister Markus Dudli stecken, in der Schweiz produziert. Gefragt war eine Idee, die diese Kollektion von den vielen hundert bestehenden Kollektionen unterscheidet. Sandra Kaufmann und Markus Dudli setzen auf den funktionalen Mehrwert, der durch den flexiblen, geschlitzten Bügel aus Federstahl entsteht: Er schmiegt sich, klickt man ihn wie eine Haarspange ein, der gewölbten Kurve der Brillengläser an. Damit wird die Brille flach und lässt sich in jeder Gesässtasche gefahrlos transportieren. Die Jury freute sich an der intelligenten funktionalen Lösung, die die Brille einzigartig macht. Ebenso überzeugt ist die Jury von der feinmechanisch perfekten Fertigung und der überzeugend durchdachten Kollektion.hochparterre, Mi., 2007.12.19
19. Dezember 2007 Meret Ernst