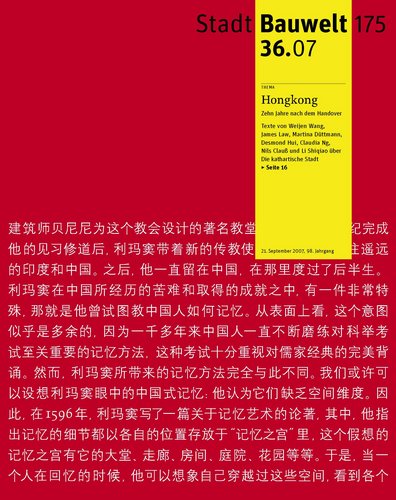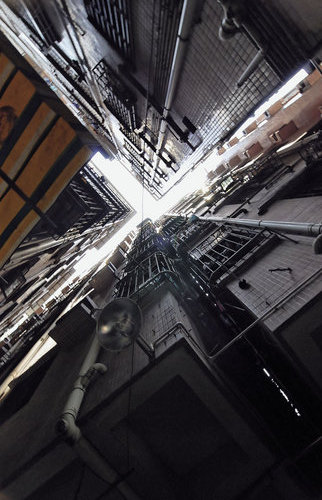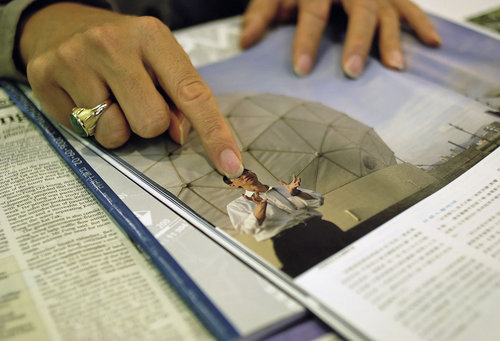Inhalt
WOCHENSCHAU
02 Serpentine Pavilion 2007 | Friederike Meyer
03 Kunst Architektur in Alt Köpenick | Brigitte Schultz
04 Giovanni Battista Piranesi. Vedute di Roma | Oliver Hell
04 Architektur und Städtebau der 20er Jahre in Leipzig | Ulrich Brinkmann
WETTBEWERBE
10 Skischanze am Holmenkollen | Friederike Meyer
13 Entscheidungen
14 Auslobungen
THEMA
16 Die kathartische Stadt | Li Shiqiao
26 Metamorphose einer städtischen Matrix. Von der Walled City zur Megastadt | Weijen Wang
32 Seit Hongkong an China zurückfiel | Martina Düttmann
42 Eine neue Identität – eine andere Architektur? | Desmond Hui
50 The Competing Skyline. Politik, Ökonomie und Identität in Hongkong nach 1997 | Weijen Wang
58 Re-Bordering Space | Claudia Ng
64 New Urban Cinema. Raum und Zeit in Wong Kar-Wais „Happy Together“ und „2046“ | Nils Clauß
74 Lovely Planet 2046 | James Law
REZENSIONEN
89 Handbuch zum Stadtrand. Gestaltungsstrategien für den suburbanen Raum | Christian Holl
89 The Landscape Urbanism Reader | Susanne Schindler
RUBRIKEN
06 Leserbriefe
06 wer wo was wann
86 Autoren
87 Kalender
90 Anzeigen