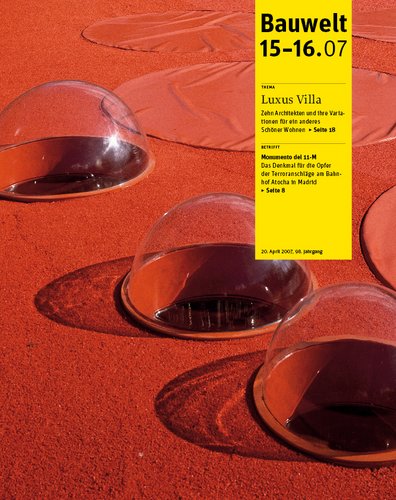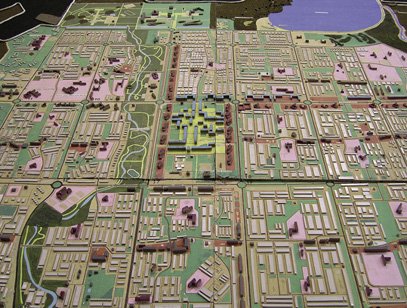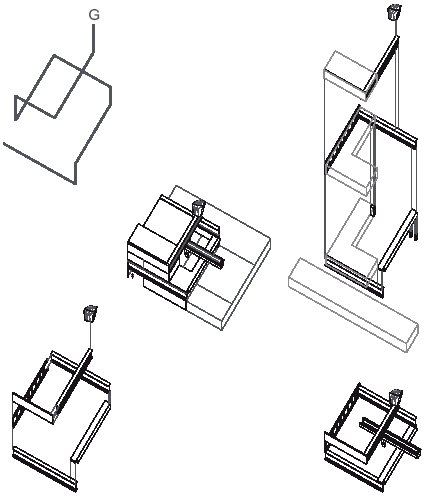Inhalt
WOCHENSCHAU
02 Paradies der Moderne? Chandigarh wird 55 | Jan Friedrich, Michael Kasiske
04 Biedermeier-Ausstellung in Wien | Friederike Meyer
05 Der „Abreißkalender“ | Gudrun Escher
05 Gebaute Bilder der Macht | Florian Heilmeyer
06 Bauten im Bild in Augsburg | Jochen Paul
06 James-Stuart-Retrospektive in London | Hubertus Adam
BETRIFFT
08 „El monumento a las víctimas del 11-M“ in Madrid | Kaye Geipel
WETTBEWERBE
12 Museumshöfe der Staatlichen Museen zu Berlin | Friederike Meyer
14 Entscheidungen
16 Auslobungen
THEMA
18 Villa Martemar in Benahavis | Kaye Geipel
26 Villa Hemeroscopium in Las Rozas
30 Silicon House in La Florida | Kaye Geipel
36 Haus T in Graz | Kaye Geipel
40 Haus H 16 auf der Alb | Christian Marquart
46 Haus in Upstate New York | Hubertus Adam
50 Desert House in Kalifornien | Michael Webb
RUBRIKEN
07 Leserbriefe
07 wer wo was wann
56 Kalender
58 Anzeigen