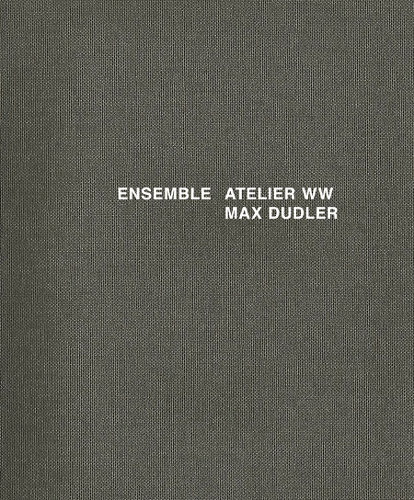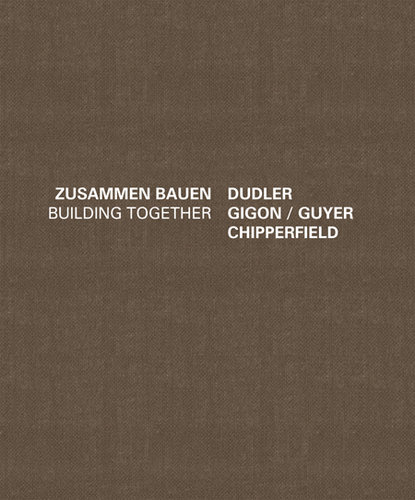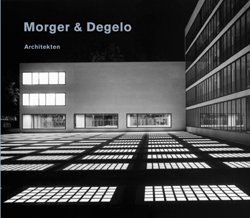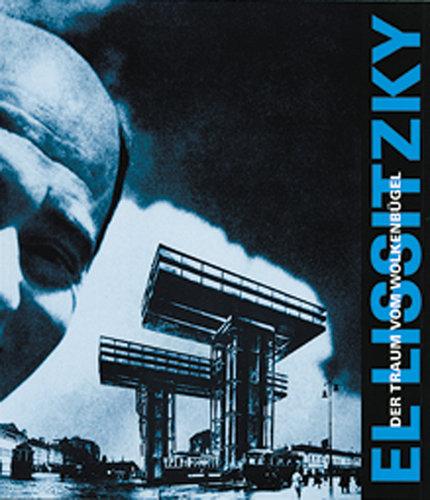Das Prozesshafte bestimmt die Arbeit der Berner Architekten Stefan Gauer, Corinne Itten und Daniel Messerli. Nachdem sie sich mit ihrem Konzept für die neuen Regionalbahnhöfe der SBB ein Langzeitprojekt gesichert hatten, konnten sie jüngst ein Einzelwerk, den transparenten Medienpavillon in Riehen bei Basel, vollenden.
Das Prozesshafte bestimmt die Arbeit der Berner Architekten Stefan Gauer, Corinne Itten und Daniel Messerli. Nachdem sie sich mit ihrem Konzept für die neuen Regionalbahnhöfe der SBB ein Langzeitprojekt gesichert hatten, konnten sie jüngst ein Einzelwerk, den transparenten Medienpavillon in Riehen bei Basel, vollenden.
Fast jeder kennt den Monolithen der Expo 02 in Murten, aber kaum jemand weiss, dass es Stefan Gauer, Corinne Itten und Daniel Messerli - kurz GIM Architekten - waren, die Jean Nouvel begeistern konnten, sich an der Expo zu beteiligen. Mit ihm zusammen hatten sie daraufhin die architektonische Gesamtleitung der Arteplage Murten inne. Von GIM Architekten stammte die Idee, die Ausstellung über ganz Murten auszudehnen und nicht nur auf einen Ort zu beschränken - mit dem Resultat, dass die kleine Stadt für viele Besucher das poetischste Ambiente der Expo bot. Im Rückblick auf ihr damaliges Engagement meint Messerli lakonisch: «Es ist etwas ganz Besonderes, ein im weitesten Sinne ‹politisches Projekt› zu realisieren. Keiner weiss genau Bescheid, aber alle mischen sich ein . . .»
Modulare Systeme
Projekte, die stark im öffentlichen Interesse stehen, sind dem Team vertraut. Jüngst wurden ihre ersten, aus einem Wettbewerb hervorgegangenen Regionalbahnhöfe realisiert, von denen dereinst mehr als 600 die Schweiz überziehen sollen. Mit dem «Facelifting Regionalverkehr» wollen die SBB den Regionalbahnhöfen ein modernes Gesicht, eine Corporate Identity verleihen und zugleich Geld sparen. GIM Architekten entwickelten das modulare Bausystem «RV05», das aus weitgehend vorgefertigten Bauteilen besteht und vom jeweiligen Architekten vor Ort den Bedürfnissen unterschiedlichster Stationen angepasst werden kann. Zu den wiederkehrenden Elementen gehören das schwebende Betondach, das einen Eindruck von der Dynamik des Reisens sowie einen Hauch funktionaler Modernität à la Mies van der Rohe vermittelt, und die paraventartigen, in Blau und Rot, den Farben der SBB, gehaltenen Wände. Die blauen Elemente dienen als Informationsträger mit Nottelefon und Billettautomat, die roten hingegen als Werbeflächen.
Darüber hinaus gibt es weitere von GIM entworfene Elemente wie Warteräume, Veloständer, Sitzbänke oder Informationswände. Als Zeichen mit Fernwirkung dient ein sechs oder acht Meter hoher, indirekt angestrahlter «Railbeam», der eine räumliche Lichtsituation schafft. Der erste «RV05»-Bahnhof wurde zeitgleich mit der Expo im nahe bei Murten gelegenen Muntelier-Löwenberg als Prototyp realisiert. Mittlerweile gibt es weitere Stationen. Im Jahr 2008, wenn alle Bahnhöfe realisiert sind, wird es sich zeigen, ob die neue Corporate Identity die vielfältige Identität der alten Bahnhöfe zu ersetzen vermag.
Prozesshaftes Arbeiten
Gauer, Itten und Messerli möchten aber nicht auf Bahnhofarchitektur festgelegt werden. Zu vielfältig sind die seit der Gründung ihres Büros 1992 in Bern realisierten Arbeiten. Im Zentrum steht dabei für die drei Partner, die sich an der ETH Zürich kennen lernten, das Prozesshafte. Sie betonen denn auch, der Weg zum Ergebnis sei das Wichtigste. Deswegen lieben sie komplexe Aufgaben, «bei denen man am Anfang gar nicht weiss, wo man ankommen wird». Solche Aufträge waren die Arteplage in Murten und die Regionalbahnhöfe. Aber auch bei den konventionelleren Arbeiten von GIM Architekten sind der ganzheitliche Ansatz und der kommunikative Aspekt der Architektur immer ablesbar. Etwa bei der Wohnanlage «Trilogie» in Muri-Gümligen, die sie zurzeit realisieren. Experimentiert wird hier mit einem Modell, bei welchem Wohnraum, Atelier und Dienstleistungsbereiche im gleichen Gebäude integriert sind. Räume können hier für eine bestimmte Nutzung temporär hinzugemietet werden. Gleichzeitig lösen sich die Wohnungen von den herkömmlichen Funktionstrennungen und bieten flexiblen, gut proportionierten Raum, der von Singles, Familien und Wohngemeinschaften genutzt werden, aber auch als Atelier dienen kann. Dabei werden die Häuser der Nutzung entsprechend gestaltet. Die klaren horizontalen Betonstrukturen der Stockwerkseinteilung und die fast vollständig verglasten Fassaden sprechen ein zeitloses Formenvokabular, das sich typologisch genau zwischen Wohn- und Bürohäusern bewegt.
Um neue Inhalte und die richtige Form im Sinne einer Corporate Identity geht es auch beim Technologiepark, den GIM Architekten gegenwärtig in Estavayer-le-Lac am Neuenburgersee planen. Hier soll auf insgesamt 90 000 Quadratmetern ein Zentrum für Hochtechnologie entstehen. Dafür entwarfen sie ein Gesamtschema unterschiedlicher Gebäude inmitten eines Grünraums - auf den ersten Blick durchaus mit einer Computer-Platine vergleichbar. Dank rationalisierten Bauverfahren können Firmen in kürzester Zeit die benötigten Flächen beziehen. Durch zentrale Infrastrukturen und eine flexible Erschliessung wird die Attraktivität des Standortes garantiert. Im Rahmen des Masterplanes soll das Gelände mit Gebäuden für Life Sciences, Elektronik, Materialforschung und Logistik bebaut werden. Es handelt sich also um ein futuristisches Projekt, bei dem die formalen und konstruktiven Ergebnisse erst im Planungsprozess erzielt werden. Dass die Projekte schliesslich in ihrer präzisen Einheitlichkeit dennoch aussehen, als seien sie von Beginn an genauso geplant worden, verdankt sich der teamorientierten Kreativität der Partner.
Architektur und Landschaft
Auch kleine Arbeiten können sich während des Planungsprozesses stark verändern. Beim kürzlich fertig gestellten Vortrags- und Medienpavillon in Riehen bei Basel, den J. Rudolf Geigy als Begegnungsstätte der Esther Foundation errichten liess, wünschte der Bauherr zunächst einen architektonischen Bezug zur 1896 inmitten einer herrlichen Parkanlage erbauten Villa. Während der Planung konnten die Architekten ihn jedoch vom Konzept einer eigenständigen, kontrastierenden Architektur überzeugen. So steht nun der Pavillon mit seiner zeitlosen Transparenz viel entschiedener für das Programm eines Ortes, an dem über Nachhaltigkeit diskutiert wird, als es zunächst geplant gewesen war. Besucher werden über Wasserflächen in den Pavillon geführt. Für den Bezug zur Landschaft steht eine Quarzitsteinmauer, die in den Glaskörper des Pavillons übergeht und somit Natur, Raum und Architektur physisch und metaphorisch verbindet. Die Fassaden sind nicht nur Hüllen, die den Raum abschliessen. Vielmehr definieren sie den Raum mit Einschnitten, Ausweitungen und Einzügen. Die Umgebung des Parkes spiegelt sich bald auf den opaken Gläsern, bald wird sie durch gezielt eingesetzte Öffnungen ins Innere geholt. Da zudem die Fenster grosser Fassadenteile versenkbar sind, verstärkt sich die Einbindung des Aussenraumes noch. Im Inneren akzentuieren natürliche und künstliche Lichtquellen die Abfolge von Vortragssaal, Schulungsräumen und Foyers. Kurz: Der Pavillon steht ganz im Sinne der Architekten «für Ruhe und Begegnung und unterstreicht dabei mit seiner unaufdringlichen und zeitlosen Schlichtheit die Schönheit des Ortes».
[ Stefan Gauer, Corinne Itten und Daniel Messerli stellen im Rahmen eines Vortrags ihre Arbeiten am Mittwoch, 9. Juni, um 18.30 Uhr im Architekturforum Zürich vor. ]
Neue Zürcher Zeitung, Fr., 2004.06.04
![]()