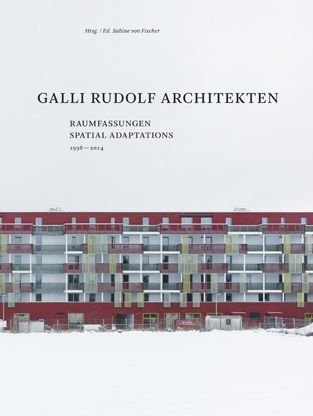Der Zürcher Kunsthistoriker erlebt als Chefkurator für Architektur und Design in New York den Aufbruch in eine neue Ära. Im Gespräch legt er dar, weshalb die Moderne ein unvollendetes Projekt sei.
Der Zürcher Kunsthistoriker erlebt als Chefkurator für Architektur und Design in New York den Aufbruch in eine neue Ära. Im Gespräch legt er dar, weshalb die Moderne ein unvollendetes Projekt sei.
In Martino Stierlis Büro begann dieses Gespräch, kurz vor der Corona-Krise. Das Museum of Modern Art (MoMA) war noch offen, aber infolge seiner Vergrösserung ein anderes als ein Jahr zuvor. In den folgenden Wochen wurde in der ganzen Welt vieles infrage gestellt, und so steht nun auch dieses Gespräch unter neuen Vorzeichen. Anfang Juni, als der MoMA-Store in Soho gerade geplündert worden ist und in New York wie im Rest der USA die seit Jahrzehnten grössten Demonstrationen gegen Rassismus stattfinden, wird es an der frischen Luft des Zürcher Limmatplatzes zu Ende geführt.
Herr Stierli, Sie haben am Museum of Modern Art dessen bisher grösste Transformation mitgestaltet. Als Sie von Zürich nach New York kamen, war die Erweiterung der Institution bereits angedacht. Wie hat diese neue Grösse das Museum verändert?
Meine ersten Jahre hier waren tatsächlich sehr stark von der Frage des Erweiterungsbaus geprägt. Wir haben diesen zum Anlass genommen, nicht nur mehr Platz für die stetig wachsende Sammlung zu schaffen, sondern auch das Museum für die Zukunft neu zu entwerfen. Wir wollten diesen Moment der Erweiterung dafür nutzen, grundsätzlich zu überdenken, wie wir moderne und zeitgenössische Kunst in all ihren Facetten und in allen an unserem Museum vertretenen Disziplinen präsentieren, damit sie für einen zeitgenössischen Diskurs relevant bleibt. Als eine jüngere Generation von Chefkuratoren waren wir uns darin einig, dass unsere Vorstellung eines Museums für das 21. Jahrhundert nicht dieselbe ist wie jene unserer Vorgänger.
Sie sehen sich als Teil eines Generationenwechsels?
Auf jeden Fall. Als ich meine Arbeit am Museum vor fünf Jahren begann, waren die meisten Chefkuratorenstellen erst kürzlich neu besetzt worden, und meine Berufung komplettierte in gewisser Weise diesen Generationenwechsel. Jeder von uns leitet eine medienspezifische Abteilung, Malerei und Skulptur, Zeichnungen und Druckgrafik, Fotografie, Film, Medien- und Performancekunst oder eben meine Abteilung Architektur und Design. Im Unterschied zu früher, als diese Sparten in modernistischer Manier als autonome Disziplinen verstanden wurden, sind wir heute mehr an einem gattungsübergreifenden Dialog interessiert. Das hat sich in der Neugestaltung der Sammlungspräsentation niedergeschlagen.
Was war Ihr Problem mit separaten Abteilungen?
Natürlich bleiben die Autonomie der Gattungen und deren spezifisches Fachwissen gerade für Architektur und Design wichtig. Die Ausdifferenzierung in medienspezifische Abteilungen hat jedoch zu einer Art Silostruktur geführt. Diese war auch auf der Ebene der Galerien sichtbar, denn jedes Departement hatte seinen eigenen Museumsbereich: Es war eigentlich ein Museum der Museen. Es war uns wichtig, dieses Verhältnis der Disziplinen untereinander grundlegend zu überdenken, weil diese Trennungen nämlich insbesondere die Kunst der Gegenwart nicht adäquat widerspiegeln. Künstler heute arbeiten nicht nur als Bildhauer oder Fotografen, sondern vermischen diese Medien und setzen sich über alte Gattungshierarchien hinweg.
Die Sammlungspräsentation des MoMA fokussierte sich bisher auf Malerei und Skulptur, das Thema Architektur und Design wurde separat gezeigt. Nun ist es im riesigen Museum verstreut, das ist anspruchsvoller.
Es ist vielleicht anspruchsvoller, aber es ist auch sinnvoller geworden, weil die Arbeiten im Kontext erscheinen: Architektur und Design entstehen ja nicht losgelöst von künstlerischen und historischen Entwicklungen, auch wenn sie natürlich nach wie vor autonome Disziplinen sind. Diesen Bezügen wollen wir gerecht werden, indem wir die Architekturgalerien in die Chronologie der Sammlungspräsentation integriert haben. Im Gegenzug tragen die Architektur- und Designgalerien in der Nachbarschaft mit Galerien der bildenden Kunst dazu bei, den historischen Kontext der Entstehung eines Werks besser zu erschliessen.
Welche Rolle spielte die Museumserweiterung bei der Umsetzung dieser Idee?
Die Erweiterung war eine Chance, den Dialog zwischen den unterschiedlichen Disziplinen der Künste stärker sichtbar zu machen. Während wir vorher eine einzige Architekturgalerie im dritten Stock besetzten, haben wir jetzt vier. Diese sind über alle drei Stockwerke der Sammlungspräsentation verteilt und innerhalb der chronologischen Struktur derselben strategisch positioniert. Hinzu kommen weitere Galerien für Design im Erdgeschoss sowie im dritten Stock. Mit diesem neuen System haben wir jetzt die Möglichkeit, mit einem viel breiteren Angebot von Galerien für Architektur und Design kleine Ausstellungen zu spezifischen Themen zu machen, die einen bestimmten historischen Moment abdecken.
Wie beweglich ist diese neue Konfiguration?
Ganz wichtig ist bei diesem neuen System, dass wir die Sammlung nicht als etwas Permanentes, Festgefahrenes oder Unabänderliches verstehen. Vielmehr haben wir für den gesamten Sammlungsbereich ein Rotationssystem eingeführt, mittels dessen sämtliche Galerien über einen gewissen Zeitraum hinweg neu installiert werden. Natürlich werden die Kronjuwelen der Sammlung weiterhin dauerhaft ausgestellt, aber eben in immer wieder neuen Kontexten. Das erlaubt uns, nicht nur eine teleologische, auf ein Argument fixierte Kunstgeschichte zu zeigen, sondern die Vielzahl von Geschichten und auch Widersprüche und Brüche aufzuzeigen. Ein solches Geschichtsverständnis erscheint uns aus heutiger Sicht viel angemessener als die längst überholten Metanarrative.
Die Architektur soll also kein Sonderfall, sondern in die Kunst- und Kulturgeschichte eingeflochten sein?
Ja und nein. Wir haben oft von einer Sowohl-als-auch-Strategie gesprochen. Nach wie vor haben wir ja unsere eigenen Galerien, in denen wir auf der Basis unserer Sammlung wechselnde Aspekte der Architekturgeschichte zeigen. Im Moment sind das etwa Installationen zur Erfindung des Wolkenkratzers, zum modernen Museumsbau oder zum Systemdenken in der Architektur der Nachkriegszeit. Allerdings sind diese jetzt eben nicht mehr in einem Sonderbereich, wo nur die ohnehin an Architektur Interessierten hingegangen sind. Stattdessen sind wir in die allgemeine Sammlungspräsentation integriert und erzeugen damit für die Architektur eine viel grössere Sichtbarkeit. Aus den Gegenüberstellungen mit der zeitgenössischen Kunst wollen wir die Museumsbesucher zum Denken anregen: Statt einer linearen Fortschrittserzählung setzen wir auf das Prinzip Montage, bei dem gerade in den mentalen Zwischenräumen Sinn erzeugt wird. Daneben gibt es andere Vorteile, dass man zum Beispiel auch synchrone Zusammenhänge besser aufzeigen kann: etwa bei Mies van der Rohe, dessen Archiv wir besitzen. Dass dieser sich in den späten zehner Jahren in Berliner Avantgardisten- und Dada-Zirkeln bewegte, hat durchaus einen Zusammenhang mit seinem architektonischen Denken.
Diesem Thema haben Sie sich in Ihrer früheren Karriere als Wissenschafter ausführlich gewidmet. Weshalb dieser Berufswechsel?
Was mich an der Herausforderung hier am Museum gereizt hat, war die Möglichkeit, grossangelegte, mehrjährige Forschungsprojekte neben wissenschaftlichen Katalogen in Form von ambitionierten Ausstellungen zu präsentieren, um damit auch ein grösseres Publikum für die Sache der Architektur zu begeistern. Ich hatte deshalb die Hoffnung, und diese hat sich auch bestätigt, dass ich die Arbeit am Museum als eine Art Fortsetzung meiner wissenschaftlichen Tätigkeit verstehen kann. Aber auf einer Plattform, die diesen Themen eine unglaubliche Sichtbarkeit gibt! Meine Position ermöglicht es mir, aktiv am zeitgenössischen Diskurs über Architektur und Design teilzunehmen und diesen mitzugestalten.
Sie waren schliesslich bereits in der Schweiz für Ausstellungen bekannt.
Das war vor allem die Schau «Las Vegas Studio» zu den Arbeiten von Robert Venturi und Denise Scott Brown, die ich mit Hilar Stadler vom Museum im Bellpark in Kriens kuratiert habe und die dann international gezeigt wurde. Des Weiteren habe ich im Rahmen von «Monditalia» an der 14. Architekturbiennale von Rem Koolhaas in Venedig eine kleine Ausstellung zu drei Villen auf Capri organisiert, in der es unter anderem um Raum und Gender ging.
Das Moderne-Verständnis des MoMA wurde stark von Mies van der Rohe geprägt. Welche anderen Tendenzen gibt es in den Sammlungsbeständen?
Es gibt auch eine lange Tradition des Zeigens von visionärer Architektur hier am Museum. Es gibt beispielsweise die Howard Gilman Collection, eine Sammlung von visionären Architekturentwürfen mit Zeichnungen von Superstudio, Archigram, OMA/Rem Koolhaas, Cedric Price und vielen anderen. Das Archiv von Mies van der Rohe ist seit den späten 1960er Jahren in der Sammlung, und vor einigen Jahren haben wir gemeinsam mit der Columbia University das Frank-Lloyd-Wright-Archiv erwerben können. Daneben haben wir gewichtige Bestände von anderen prägenden Figuren der Moderne, so etwa Le Corbusier und Louis Kahn, neben vielem anderem, auch weniger Bekanntem.
Das MoMA galt bis in die 2000er Jahre als Verfechterin eines geradezu klassischen Moderne-Verständnisses. Fürchten Sie, dass es seine Vorreiterrolle in der Themensetzung nun abgeben muss?
Das MoMA war tatsächlich lange Zeit so etwas wie der Fahnenträger der (Architektur-)Moderne, und der ist es zu einem gewissen Punkt bis heute geblieben. Inzwischen aber gibt es auf der ganzen Welt verschiedene Institutionen, die sich mit moderner Architektur aus ihrer je eigenen Perspektive beschäftigen und zu einem Meinungspluralismus beitragen. Und das ist auch gut so. Die Welt war noch um 2000 eine andere als 2020, und auch die Kunst- und Architekturgeschichte und ihre Methoden haben sich seither weiterentwickelt. Zentrale Aspekte wie die globale Kunstgeschichte, der Genderdiskurs oder die Entkolonialisierung der Institutionen haben die Sammlung und das Ausstellungsprogramm in den letzten Jahren enorm bereichert. Es ist die Aufgabe unserer Generation, die kanonischen Narrative der Vergangenheit kritisch zu prüfen und zu korrigieren. Alles andere wäre reaktionär.
Das Bemühen um Diversität wirkt aus europäischer Sicht zuweilen etwas angestrengt.
Ich denke schon, dass das Bewusstsein für die Relevanz dieser Fragen in den USA deutlicher ausgeprägt ist. Das hat natürlich mit der Geschichte des Landes und etwa der Hinterlassenschaft der Sklaverei zu tun. Wie wir an den gegenwärtigen Unruhen und der brutalen Ermordung George Floyds sehen, ist dieses Kapitel nie wirklich aufgearbeitet worden und bestimmt die Gegenwart als kollektives Trauma mit wie auch etwa die weitgehende Auslöschung und Marginalisierung der indigenen Bevölkerung. Das sind grosse und wichtige Themen in der Kunst, aber sie sind eben auch in Architektur und Städtebau präsent, wenn auch nicht immer offensichtlich.
Ist ein Museum mit einer von weissen, gutgestellten Männern zusammengetragenen Sammlung nicht falsch aufgestellt, solche Themen zu behandeln?
Nicht unbedingt: Einerseits sind die Bestände des Museums gar nicht so homogen, wie viele denken. Die grosse Überraschung war nämlich, dass diese enorm grosse Sammlung viel diverser ist, als wir das alle gedacht hätten. Darüber hinaus haben wir es uns als strategische Priorität vorgenommen, die bestehenden Lücken in der Sammlung viel aggressiver anzugehen: Dazu gehört die Untervertretung von Künstlern und Architekten afroamerikanischer Herkunft. Was diesen Aspekt anbelangt, arbeitet mein Department seit mehreren Jahren an der Ausstellung «Reconstructions», die im kommenden Frühjahr gezeigt werden soll. Auf der anderen Seite erschliessen wir durch grossangelegte Forschungsprojekte und Sonderausstellungen Aspekte der modernen Architektur, die hierzulande kaum bekannt und auch in der Sammlung bisher nicht vertreten waren. Die Ausstellung «Toward a Concrete Utopia» zur Architektur im sozialistischen Jugoslawien war so ein Fall. Ich habe für meinen Einstand hier am MoMA ganz bewusst dieses Thema gewählt, nicht nur, weil es mir erlaubte, im Sinne des bereits Gesagten kanonische Geschichtserzählungen kritisch zu revidieren, sondern auch, weil wir damit auf die gesellschaftspolitische Relevanz von Architektur hinweisen konnten und auf ihr Potenzial, aktiv soziale Veränderungen mitzugestalten. Die Ausstellung war eine Zusammenarbeit mit Vladimir Kulić, einem ausgewiesenen Experten auf diesem Gebiet und Professor an der Iowa State University. Die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft ist mir enorm wichtig.
Für Sie sind gestalterische also auch soziale Fragen?
Unbedingt. Wir leben schliesslich in einer Welt, die so viel stärker vernetzt ist, als sie das jemals zuvor war – auch wenn der Rechtspopulismus der vergangenen Jahre und die gegenwärtige Corona-Krise eine Rückbesinnung aufs Nationale mit sich gebracht haben. Schliesslich liegt in der historischen Kontextualisierung solcher Phänomene ein grosses Potenzial, die eigene Gegenwart besser zu verstehen. Nicht umsonst ist die Aufarbeitung des Kolonialismus und seiner Auswirkungen auf die künstlerische und architektonische Produktion eine der dringlichen Aufgaben unserer Zeit.
Wie kann man denn wahres Interesse von Political Correctness unterscheiden?
Vieles wird in der Tat kurzerhand als politische Korrektheit abgetan, manchmal wohl nicht ganz unberechtigt. Aber ich glaube, es wäre ein intellektueller Kurzschluss, diese globale Kunst- und Architekturgeschichte zu ignorieren. Er besteht gerade auf einem fehlenden historischen Verständnis und der Ausblendung von Machtstrukturen. Die Geschichte, wie wir sie aus den Lehrbüchern kennen, ist eben nicht die objektive Wahrheit, sondern ein soziales Konstrukt. Diesem müssen wir die anderen historischen Wahrheiten entgegenstellen, die bisher in den Lehrbüchern nicht vertreten waren. Es geht darum, den Kriterienkatalog, der überhaupt erst zur kanonischen Geschichtsschreibung geführt hat, auf seine blinden Flecken hin zu durchleuchten. Davor die Augen zu verschliessen, wäre ignorant. Ohne Zweifel haben die argen sozialen Missstände in diesem Land zu meiner Sensibilisierung für solche Fragen beigetragen. Und es ist auch der kritische, intellektuelle Diskurs in dieser Stadt, von dem ich sehr profitiere.
Sie leben nun seit fünf Jahren in Manhattan, die letzten zwei Monate waren Sie in Ihrer Wohnung sozusagen eingeschlossen. Wo erleben Sie diese Missstände?
Früher fiel es mir vor allem im Restaurant auf: Schauen Sie mal, welche Hautfarbe die Angestellten haben, die im Hintergrund die Knochenarbeit machen. In letzter Zeit waren es die Lieferanten der Amazon-Pakete, denen auch am Höhepunkt der Corona-Krise und trotz einem erheblichen Risiko nichts anderes übrig blieb, als die Mittel- und Oberschicht zuverlässig mit Lebensmitteln zu versorgen. Und dann eben in den Medien: Die regelmässig wiederkehrenden, erschreckenden Beispiele der Brutalisierung schwarzer Menschen. Es gibt in der amerikanischen Gesellschaft einen strukturellen und systemischen Rassismus. Einer kulturellen Institution wie dem MoMA kommt in einer solchen Situation eine grosse Verantwortung zu.
Sie sagten auch, dass das Museum seine Rolle darin sehe, eine Verständigung in der Gesellschaft zu ermöglichen. Wird das MoMA also, statt weiter die Vorreiterin und Fahnenträgerin zu sein, nun zur Mediatorin?
Es wäre wohl naiv, angesichts von verheerenden Kriegen, dem Holocaust und vielen weiteren Greueln die Moderne einfach weiterhin unkritisch abzufeiern. Vielmehr geht es doch darum, für die Werte der Aufklärung einzustehen, auf denen die Moderne letztlich beruht. Die grosse Erzählung der Nachkriegszeit in den westlichen Demokratien war aber, dass wir zu einer egalitären, demokratischen Gesellschaft heranwachsen, in der die Kunst gewissermassen die höchste Form des Ausdrucks individueller Freiheit darstellt. Inzwischen hat sich dieser Glaube als Illusion erwiesen, die auf Kosten vieler erkauft wurde, die von Anfang an von den Verheissungen dieser grossen Erzählung ausgeschlossen und gar nicht erst mitgemeint waren. Konsens und Zukunftsoptimismus sind uns etwas abhandengekommen.
Etwas Optimismus für die Zukunft könnten wir schon gebrauchen.
Auf jeden Fall! Als Kurator verstehe ich meine Aufgabe auch dahingehend, die Menschen daran zu erinnern, dass es alternative Gesellschaftsentwürfe gibt und dass gerade die Architektur immer wieder dazu beigetragen hat, diesen eine Form zu geben. Wir fragen uns doch: Was kann eigentlich Architektur mehr sein als das Steckenpferd von wohlhabenden Leuten, die sich tolle Villen bauen? Kann Architektur tatsächlich eine Funktion übernehmen in einem grösseren gesellschaftlichen Projekt? Kann sie die Trägerin einer Vision sein, wie wir uns unser Zusammenleben vorstellen? Solche Überlegungen bildeten den Antrieb für meine erste grosse Ausstellung hier, «Toward a Concrete Utopia», in der wir auch das Alltägliche in den Vordergrund stellten.
Darin haben Sie auch auf das bedrohte bauliche Erbe jener Zeit aufmerksam gemacht. Das wäre dann wiederum eine denkmalpflegerische Aufgabe, an der sich das Museum beteiligen könnte.
Wir greifen als Museum normalerweise nicht in aktuelle Diskussionen zur Denkmalpflege ein, auch wenn das im Ausnahmefall vorkommt. So habe ich zum Beispiel vor einiger Zeit mit einem Brief versucht, den Abbruch der Hall of Nations in New Delhi von Raj Rewal und dem Ingenieur Mahendra Raj zu verhindern. Leider vergeblich. Was wir aber tun können: Wir können unser Publikum für die baulichen und soziologischen Qualitäten von Bauten sensibilisieren. Die Jugoslawien-Ausstellung war natürlich auch der Versuch, das Publikum für den Brutalismus zu begeistern und ein Verständnis dafür zu wecken, dass mit diesen Betonbauten in vielen Fällen nicht nur baukünstlerisch wertvolle Objekte, sondern auch kluge und richtungweisende räumliche und gesellschaftliche Ideen verwirklicht wurden.
Sind Sie mit Ihrer Betrachtung dieser brutalistischen Bauten in Verbindung mit der kriegsbehafteten Geschichte Jugoslawiens nicht auf Vorbehalte gestossen?
Ausser mit dem verheerenden Bürgerkrieg der 1990er Jahre haben viele Menschen in den USA mit Jugoslawien erst einmal gar nichts verbunden. Gerade dieses fehlende Wissen und die damit verbundenen Vorurteile haben mich aber als Herausforderung gereizt. Im Nachhinein muss ich sagen: Ich war mir der Tragweite des Risikos, das ich mit einer solchen Ausstellung einging, nicht völlig bewusst. Wenn ich auf Nummer sicher hätte gehen wollen, dann hätte ich zum Beispiel eine Frank-Lloyd-Wright-Ausstellung machen können. (Die haben wir übrigens auch gemacht, nur habe ich sie nicht selbst kuratiert.) Es wäre ja durchaus möglich gewesen, dass die Ausstellung als irrelevant aufgefasst worden wäre. Sie hat dann aber eine phänomenale Rezeption erfahren und hoffentlich dazu beigetragen, eine fruchtbare Diskussion anzustossen, die weit über das engere Thema der Architektur in Jugoslawien hinausging.
Was haben Sie sich in Ihrer Rolle als Chefkurator für Architektur und Design sonst noch für Ziele gesetzt?
Als Historiker ist es mir ein Anliegen, die kanonische Architekturgeschichte kritisch zu revidieren und auf ihre methodische Stichhaltigkeit hin zu prüfen. Dabei bin ich besonders daran interessiert, den Zusammenhang von Architektur mit gesellschaftlichen und politischen Fragen anzusprechen. Was die Gegenwart anbelangt, soll das Museum aber auch eine Plattform zur Diskussion aktueller architektonischer und städtebaulicher Probleme bieten. Ich denke hier an die genannten sozialen Herausforderungen, aber auch an den Klimawandel, der selbst angesichts der Corona-Krise die grösste existenzielle Bedrohung unserer Zeit bleibt.
Sie tragen auch Ideen für weitere Ausstellungen zu aus Schweizer Sicht noch entlegeneren Weltregionen mit sich herum.
Ja, wir arbeiten derzeit an einem grossen Forschungsprojekt zur Architektur Südasiens im Zeichen der Dekolonisierung. Natürlich denken hier alle sogleich an Le Corbusier und Chandigarh. Unser Interesse gilt aber primär der ersten Generation der lokalen Architekten, die mit ihrem Werk massgeblich zum Aufbau einer neuen Gesellschaft nach dem Erlangen der Unabhängigkeit beigetragen haben. Dieses Projekt hat mich bereits mehrfach nach Indien, Pakistan, Bangladesh und Sri Lanka geführt, und wir sind mit führenden Forschenden aus der Region im Dialog. Dabei treibt uns die Frage um: Wo positioniert sich moderne Architektur zwischen einem emanzipatorischen und einem neokolonialen Projekt?
Sie sagen, dass die Moderne auch ein emanzipatorisches Projekt gewesen sei. Damit retten Sie den Namen des Museum of Modern Art in die Zukunft.
Es ist wichtig, zu sehen, dass die Moderne eine komplexe und widersprüchliche, in vieler Hinsicht auch eine traumatisierende Angelegenheit war und ist. Aber sie war eben nicht nur das. Es gibt ja viele zeitgenössische Positionen, die das weiterdenken. Ich denke zum Beispiel an Bruno Latour. Was kann die Moderne überhaupt noch sein? In einer Zeit, in der uns der Glaube an eine Entwicklung zu einer immer besseren Welt abhandengekommen ist, in der wir fast ungebremst auf eine ökologische Katastrophe zusteuern, in der wissenschaftliche Fakten kurzerhand in Abrede gestellt werden, kann es nicht einfach mit einem naiven Fortschrittsglauben weitergehen. Und doch scheint mir die Kategorie der Moderne weiterhin ein brauchbares Konstrukt, auch um sich Gedanken über die Zukunft zu machen.
Das heisst, die Moderne ist ein . . .
. . . unvollendetes Projekt, um Jürgen Habermas zu zitieren. Es ist sicher interessant, wenn ich das sage, weil ich mich ja lange mit der Postmoderne befasst habe. Ich habe die Postmoderne auch nie als Bruch mit der Moderne verstanden, sondern als eine Art weitere Ausdifferenzierung der Grundsätze der Moderne und als ein Korrektiv auf einen naiven Fortschrittsoptimismus.
Sie haben ihr halbes Leben in Zürich gewohnt, nun fünf Jahre in New York. Wie gewöhnt man sich an das metropolitane Leben hier?
Ich kannte New York durch viele Aufenthalte, aber der Einstieg war dennoch hart. Es war zum Beispiel ziemlich schwierig, zu einem vernünftigen Preis eine Wohnung zu finden. Wenn man dann erst einmal hier ist und sich eingelebt hat, bietet die Stadt neben der bekannten Hektik und dem aktiven Kulturleben aber auch überraschend viele Nischen der Ruhe, die man als Tourist kaum je zu sehen bekommt.
Wo wäre denn diese ruhige Seite von Manhattan?
Es gibt hier wirklich wunderbare, kleine Parks abseits der Touristenströme. Davon gibt es in meinem Wohnquartier Gramercy unmittelbar zwei, wo sich bestens unter Bäumen ein Buch lesen lässt. Oder ich kann auf die Dachterrasse, die das Gebäude, in dem ich wohne, zum Glück hat und die neben Ruhe auch einen umwerfenden Blick auf die Skyline zu bieten hat. Zum Jogging gehe ich an den East River, dessen Ufer in den vergangenen Jahren zu einer attraktiven öffentlichen Zone hergerichtet wurde, die wie alle städtischen Parks auch im Lockdown nicht abgesperrt wurde wie etwa die Seepromenade in Zürich – obwohl die Dichte in New York ja viel höher ist. Der Lockdown der vergangenen Wochen hat mir darüber hinaus die Gelegenheit gegeben, die Aussenbezirke der Stadt mit dem Fahrrad zu erkunden. Und dann darf man nicht vergessen, dass New York mit dem Hudson Valley oder den Stränden auf Long Island auch über sehr attraktive Naherholungsgebiete verfügt. Viele Privilegierte besitzen an diesen Orten Zweitwohnsitze und haben die Zeit des Lockdowns dort ausgeharrt.
Erleben Sie Zürich jetzt anders, wenn Sie zurückkommen?
Ja, schon. Von New York aus gesehen hat Zürich ja fast dörflichen Charme. Das Tempo und die Dichte sind doch ganz anders, und die Diskussion um den sogenannten Dichtestress finde ich schlechterdings absurd. Andrerseits weiss ich hier die Grosszügigkeit des öffentlichen Raums, das kollektive Verantwortungsbewusstsein dafür und insbesondere im Sommer die Badis sehr zu schätzen. Davon gibt es in New York leider dann doch zu wenig.
Hatten Sie in Zürich denn gar nie Dichtestress?
Nein, aber ich dachte eben auch nie: Ich lebe in einer kleinen Stadt. Wenn ich jetzt aus New York nach Zürich komme, dann ist mir das stärker bewusst. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine sehr vertraute Umgebung, wo nach wie vor viele meiner Freunde leben. Insofern komme ich immer gern nach Zürich zurück. Das kulturelle Angebot ist, insbesondere für die Grösse der Stadt, ja auch toll.
Das Zürcher Kunsthaus feiert in ein paar Monaten die Neueröffnung und vergrössert sich auch.
Das Kunsthaus ist eine mit dem MoMA nicht ganz vergleichbare Institution, es hat zum Beispiel keine Architektur- und Designabteilung und ist auch nicht nur auf die Moderne ausgerichtet. So war es interessant, zu beobachten, mit welcher Intensität darüber diskutiert wurde, wie sich der Neubau städtebaulich auf den Heimplatz auswirken würde.
Im Innern darf man nur hoffen, dass dieser Neubau dann so grosszügig wie das MoMA wirkt. Dort atmet der Raum ja geradezu.
Ich finde auch, dass unsere Erweiterung wirklich gut gelungen ist. Da möchte ich unseren Architekten Diller Scofidio + Renfro ein Kränzlein winden. Sie haben es geschafft, eine Art von Grosszügigkeit herzustellen, die wir vorher nicht hatten. Es fühlt sich alles sehr einladend und offen an, zugleich ist es mit einem gewissen architektonischen Understatement verbunden. Im transparenten Neubau entlang der 53. Strasse wird das Programm geradezu nach aussen gekehrt, unter anderem mit einer Galerie und einem Raum für Performance zur Strasse hin. Hier haben die Architekten versucht, über die Mauern der Institution hinaus in den öffentlichen Raum hinein zu wirken.
Wie schätzen Sie den Stellenwert der Schweizer Architektur im weltweiten Vergleich ein?
Die Schweizer Architektur verfügt im internationalen Kontext zu Recht über einen hervorragenden Ruf. Ich finde, dass die offizielle Schweiz da allerdings durchaus noch offensiver agieren könnte. Es gibt zum Beispiel kein nationales Museum, das sich vertieft mit moderner Architektur befasst und diese auch systematisch sammelt. Das wird hier weitgehend den – allerdings hervorragenden – Hochschulen überlassen. Ich glaube, man könnte die kulturelle Leistung der Architektur stärker öffentlich anerkennen, eben zum Beispiel durch eine museale Präsenz.
Unterstützt denn Ihr Schweizer Hintergrund auch das Prestige als Kurator?
Lustigerweise denken viele Leute aufgrund meines Vornamens, ich sei Italiener. Die Schweizer Architekturkultur ist sicher vielen ein Begriff, aber doch eher nur in Fachkreisen. Hier gibt es auf jeden Fall ein Bewusstsein für die insgesamt hohe Qualität der Schweizer Architektur und für den wichtigen Beitrag, den diese für den zeitgenössischen Diskurs leistet, nicht zuletzt durch herausragende Vertreter wie Herzog & de Meuron oder Peter Zumthor, die ja auch in den USA wegweisende Bauten verwirklicht haben.
Neue Zürcher Zeitung, Do., 2020.06.11
![]()