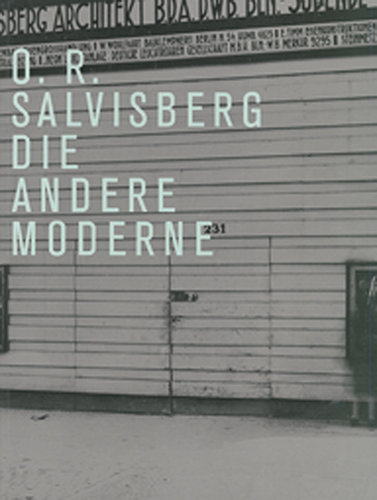Die erste umfassende Restaurierung des Parlamentsgebäudes, des wichtigsten Baus der Eidgenossenschaft , erregt in mancherlei Hinsicht Aufsehen. Neben der komplexen organisatorischen Aufgabe ist vor allem die Sorgfalt hervorzuheben, mit der die Architekten das historische Gebäude analysiert und danach restauriert und ergänzt haben. Die in den Jahrzehnten zuvor entstandenen Zufälligkeiten haben einer neuen Ordnung Platz gemacht, die die alten Strukturen reflektiert. Alt und Neu verbinden sich zu einer neuen Ganzheit.
Die erste umfassende Restaurierung des Parlamentsgebäudes, des wichtigsten Baus der Eidgenossenschaft , erregt in mancherlei Hinsicht Aufsehen. Neben der komplexen organisatorischen Aufgabe ist vor allem die Sorgfalt hervorzuheben, mit der die Architekten das historische Gebäude analysiert und danach restauriert und ergänzt haben. Die in den Jahrzehnten zuvor entstandenen Zufälligkeiten haben einer neuen Ordnung Platz gemacht, die die alten Strukturen reflektiert. Alt und Neu verbinden sich zu einer neuen Ganzheit.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts war das Gebiet innerhalb der Aareschlaufe in Bern in seinem unteren Teil vollständig überbaut, im oberen Teil indessen beherrschten weite, kaum genutzte Parzellen das Bild, namentlich an den Rändern des Plateaus. Als an der ersten Sitzung der Vereinigten Bundesversammlung im Jahr 1848 Bern als Bundeshauptstadt bestimmt wurde, war damit die Bedingung verknüpft, dass die Stadt die notwendigen Räumlichkeiten für Parlament, Regierung und Verwaltung des neuen Staats zur Verfügung stellen musste. Als Bauplatz wurde der Standort des Stadtwerkhofs an der Südflanke bestimmt, und 1852–1857 entstand hier das Bundes-Rathaus, das heutige Bundeshaus West. Es respektierte die städtebaulichen Prinzipien der mittelalterlichen Stadtanlage, in diesem Fall das Platzieren öffentlicher Bauten nicht im Zentrum, sondern an der Hangkante, sowie das Freilassen des Hanges selber.
Mit der Neuordnung im Zug der Revision der Bundesverfassung 1874 wuchsen die Raumansprüche von Parlament und Verwaltung rasch an, neue Räume wurden nötig. Zunächst erstellte der Bund 1888–1892 an der Stelle des alten Inselspitals ein neues Verwaltungsgebäude, das Bundeshaus Ost. Der Neubau rechnete bereits mit einem Gesamtkomplex eines Bundespalasts mit einem zentralen Gebäude für das Parlament.
Dieser Mittelbau, das Parlamentsgebäude, wurde nach dem Abbruch des alten Casinos 1894–1902 errichtet. Architekt Hans Wilhelm Auer konzipierte es als Nationaldenkmal, von Schweizern für die Schweizer geschaffen aus einheimischen Materialien, mit einer reichen Symbolik und getragen von vielen Kunstwerken. Modernste Haustechnik wurde eingebaut. Das Raumkonzept ist ungewöhnlich: Die engen Verhältnisse des Bauplatzes verlangten eine Entflechtung in der Vertikalen. Der eigentliche Hauptraum ist ein Leerraum, die grosse Halle, welche die monumentale Treppe aufnimmt. Sie, nicht einer der Säle, manifestiert sich durch die Kuppel gegen aussen. Von einem dreiseitig umlaufenden Umgang erschlossen, liegen sich die Säle der beiden Parlamentskammern im ersten Obergeschoss gegenüber – der Ständeratssaal zur Stadt hin, ausgezeichnet durch den zentralen, vorspringenden Gebäudekörper, der Nationalratssaal gegen das Aaretal, markiert durch die Auswölbung der Fassade.
Die Zufälligkeiten von Einzelmassnahmen
In einem stark genutzten Gebäude, das immer wieder neuen Ansprüchen angepasst werden muss, wird im Verlauf von hundert Jahren nahezu jeder Raum einmal oder mehrere Male tangiert. Neue Nutzungen werden eingebracht, technische Verbesserungen zugefügt, die Räume dem Zeitgeist entsprechend umgestaltet. Dem Parlamentsgebäude haben besonders die Umbauten der 1960er-Jahre zugesetzt. In zahlreichen Sitzungszimmern, in Garderoben und Korridoren wurden Decken, Gewölbe, Wandgliederungen verdeckt oder abgebrochen, die farbigen Tapeten weiss überstrichen und so «moderne» Räume geschaffen. Der Stuck wich Gipskartonplatten. Die schrittweise Nutzung der Dachräume führte dazu, dass die grossen Lünettenfenster zur Kuppelhalle vermauert wurden; ohne natürliches Licht wirkte die Halle fortan düster. Der Einbau des Bundeshausstudios für Fernsehen und Radio in den Dachraum über dem Ständeratssaal hatte einschneidende Folgen für das Haus, sein Tragwerk und seine innere Disposition; es wurde eine massive, weit gespannte Betondecke eingebaut, auf der die umfangreichen baulichen und technischen Installationen Platz fanden; das Dachgeschoss wurde zum Labyrinth. Der Einzug der EDV brachte Kabelkanäle und Einrichtungen wie die Abstimmungsanzeigetafeln. Erst in den 1980er-Jahren wurde bei weiteren Instandstellungsarbeiten versucht, die bestehenden Werte zu achten und zu bewahren, sie mit neuen Elementen von gestalterischer Qualität zu ergänzen.[1] In dieser Phase sind namentlich die Restaurierung des Nationalratssaals und der «Salle des pas perdus» sowie einiger Sitzungszimmer zu erwähnen.
Untaugliche und taugliche Erweiterungspläne
Als Befreiungsschlag war das Erweiterungsprojekt gedacht, das Mario Botta 1991 im Anschluss an einen Ideenwettbewerb präsentierte. Es sah eine Überbauung des Hangs unter dem Parlamentsgebäude mit einem zitadellenartigen Gebäude vor. Das städtebauliche Prinzip des freien Aarehangs wurde damit allerdings grob missachtet und der Altbau konkurrenziert; der Vorschlag wurde fallen gelassen.
Die Zeit nach dem Zuger Attentat 2001 stand unter dem Zeichen schrittweise erhöhter Sicherheitsansprüche. Auch in diesem Bereich stand ein pragmatisches, von Zufälligkeiten geprägtes Vorgehen im Vordergrund. Der gemeinsame Zugang für Parlamentsangehörige und Besuchende vom Bundesplatz wurde als Risiko empfunden und war auch organisatorisch kaum zu bewältigen. Mehrere Vorschläge für einen neuen, unterirdischen Besucherzugang vom östlichen Hof aus wurden von der Denkmalpflege abgelehnt, da sie die Gesamtsituation wesentlich beeinträchtigt hätten.[2]
Die Ansprüche des Parlaments nahmen laufend zu. Neu eingerichtete, individuelle Arbeitsplätze im Dach des Bundeshauses Ost erwiesen sich als zu weit von den Parlamentssälen entfernt. Die Fraktionen klagten über fehlende Räume für Sitzungen und Sekretariate. Der nötige Platz konnte schliesslich geschaffen werden, indem die Räume für die Medienschaffenden ausgelagert wurden. 2003–2005 wurde im historischen Gebäude Bundesgasse 8–12 in unmittelbarer Nähe das «Medienzentrum Bundeshaus» eingebaut.[3] Die massiven Eingriffe im dortigen Altbau waren nur dadurch zu rechtfertigen, dass damit der notwendige Freiraum für einen funktionierenden Parlamentsbetrieb unter Schonung der historischen Substanz des Parlamentsgebäudes geschaffen werden konnte.
Voraussetzungen
Die ohnehin notwendige Gesamterneuerung der Haustechnik erlaubte es, diese in einer zusätzlichen Unterkellerung unterzubringen. Dadurch wurde im Tiefparterre Raum frei für einen neuen Besuchereingang von der Bundesterrasse her. Er liegt ideal in der Gebäudeachse hinter der bestehenden Arkade, die den Wartenden einen Witterungsschutz bietet. Die doppelgeschossige Eingangshalle liegt unter dem Nationalratssaal; klug wird damit der Eingang vom Bundesplatz her, der unter dem Ständeratssaal liegt, gespiegelt. Treppen führen von der neuen Halle[4] direkt in die Kuppelhalle. Die Auslagerung der Arbeitsräume der Medienschaffenden und der Studios in das neue Medienzentrum brachte freien Platz im dritten Obergeschoss. Es entstanden neue individuelle Arbeitsplätze für die Parlamentsmitglieder und Fraktionszimmer unterschiedlicher Grösse.
Das alte Gesamtkonzept herausarbeiten und neu interpretieren
Eine genaue Kenntnis des Objekts ist Voraussetzung für das Festlegen von Massnahmen an Baudenkmälern. Diese eigentlich selbstverständliche Forderung an jede Restaurierung wird häufig missachtet oder auf bloss oberflächliche Art erfüllt. Beim Parlamentsgebäude war sie schwierig umzusetzen, da vor Baubeginn bloss vereinzelte Sondierungen durchgeführt werden konnten. Erst im Verlauf der Arbeiten konnte die Suche nach der noch vorhandenen Substanz systematisch vertieft werden. So stand eine intensive Analyse der ursprünglichen architektonischen Qualitäten am Anfang. Sie machte das Konzept von Wilhelm Auer deutlich, das auf einem klaren räumlich-organisatorischen Aufbau und einer durchgehenden gestalterischen Grundhaltung beruht, die allerdings in den letzten hundert Jahren durch unzählige Einzelmassnahmen gestört worden waren.[5]
Eine solche vertiefte Analyse des Baudenkmals ist zunächst Sache des Architekten. Er muss sich aber in einem solchen Fall durch eine Vielzahl von Fachleuten inderdisziplinär unterstützen lassen. Neben den eher technischen Disziplinen wie Baustatik, Gebäudetechnik, Bauphysik sind vor allem die detaillierte Kenntnis der Baugeschichte und die Bauforschung vor Ort wichtig. Denkmalpflege und Fragen der Konservierung / Restaurierung stehen im Zentrum.[6]
Sorgfalt und Durchführung
Eine genaue Analyse ist nur dann sinnvoll, wenn die daraus gewonnenen Erkenntnisse in die Umsetzung einfliessen. Eine bis ins Detail zuverlässige Planung ist Voraussetzung dazu; genügende Zeiträume in der Planung verbessern tendenziell die Qualität. Bei der Restaurierung des Parlamentsgebäudes waren aber die Voraussetzungen an sich schon schwierig: In dem komplexen Umbau waren in 21 Monaten effektiver Bauzeit über 100 Millionen Franken zu verbauen, acht Mal musste die Arbeit eingestellt und der Bau provisorisch für eine Parlamentssession hergerichtet werden. Trotz diesen erschwerenden Umständen war eine Umsicht zu beobachten, die ungewöhnlich ist. Noch vor der bewundernswerten organisatorischen Leistung der Architekten ist ihr nicht erlahmendes Engagement für die Architektur, für Strukturen, Räume, Lichtführung und Ausstattungen hervorzuheben. Die Antworten auf Fragen heutiger Architektur wurden im historischen Bau gesucht und gefunden. Nicht kontrastierendes, dialektisches oder mimetisches Verhalten war das Thema, sondern das empathische Eingehen auf den Bestand. Es zeigt sich exemplarisch, wie entscheidend wichtig die Wahl der Architekten für den richtigen Umgang mit einem Baudenkmal ist.
Ihre Sorgfalt betraf die Restaurierungsarbeiten ebenso wie die neuen Räume. In den ganz oder teilweise erhaltenen Räumen wurden historische Elemente mit grösster Vorsicht freigelegt, restauriert oder ergänzt, neue Elemente, beispielsweise die wieder eingeführte Farbigkeit, sorgfältig integriert. Bei den neuen Räumen wurde ein selbstbewusster, aber unaufgeregter Umgang mit Struktur, Raum und Ausstattung gepflegt, der die historischen Bereiche nicht zu übertrumpfen sucht, sich aber auch nicht leisetreterisch zurücknimmt. Die zu selten anzutreffende Verbindung alter und neuer Qualitäten zu einem stimmigen neuen Ganzen ist hier gelungen.
Einzelne Massnahmen im Innern
Die Eingangspartie auf Seite Bundesplatz[7] und die Kuppelhalle erheischten bloss eine grundlegende Änderung: Die hintermauerten Lünettenfenster mit den Glasmalereien von Szenen des Arbeitslebens vor charakteristischen schweizerischen Landschaften wurden geöffnet und rückwärtig wieder durch die grossen Oblichter erhellt. Zusammen mit der Glaskuppel, die ihr Licht vom Kuppelaufbau erhält, ist damit die Halle wieder zu einem hellen Tageslichtraum geworden. Die sorgfältige Reinigung der Innenwände von Schmutz, eine neue Beleuchtung und das Entfernen von jüngeren Möblierungen tragen zum frischen Eindruck bei. Für die Orientierung im Innern erwiesen sich die Wendeltreppen beidseits der Kuppelhalle als entscheidend wichtig. Sie wurden bis in das dritte Obergeschoss verlängert und ermöglichen so einen direkten Bezug zwischen den Geschossen. Die in den 1950er-Jahren eingebauten Personenaufzüge wurden durch weitgehend verglaste Anlagen ersetzt.[8] In den Sitzungszimmern im Hochparterre, die teilweise völlig umgestaltet, teilweise über den Wandtäfern durchgehend weiss gestrichen worden waren, wurden die vorhandenen historischen Teile, Täfer, Parkettböden und Stuckdecken sichtbar gemacht. Die Räume erhielten eine neue Farbigkeit.
Die beiden Ratssäle, die sogenannten Appartements der beiden Räte, waren bereits vor einigen Jahren einer Teilrestaurierung unterzogen worden und erforderten nur wenige Eingriffe. Die Behandlung der Sessel im Nationalratssaal mag beispielhaft für die beharrliche Suche der Architekten nach adäquaten Lösungen sein. Gemeinsam mit Spezialisten versuchten sie, die alten Sessel mit kleinen Eingriffen heutigen Komfortvorstellungen anzupassen, obwohl die Nutzer eine neue Bestuhlung gefordert hatten. Die zu geringe Beinfreiheit wurde durch ein geringfügiges Anheben der Pulte kompensiert, die fehlende Feuchtigkeitsabsorption des Sitzkissens durch den Ersatz des Kunstlederbezugs der 1960er-Jahre durch Naturleder erreicht, die unbequeme Sitzhaltung durch eine andere Sitzneigung und eine ausgeklügelte Flechttechnik des Jong-Geflechts korrigiert.
Zahlreiche Räume mit historischer Ausstattung wurden restauriert. Dabei wurde aufgrund unerwarteter Funde von Resten der ursprünglichen Ausstattung in vielen Fällen rekonstruierend der Erstzustand hergestellt. Markantes Beispiel dieses Verhaltens ist die Garderobe des Ständerats. Ihr reich bemaltes Gewölbe war in den 1960er-Jahren durch einen flachen Plafond verdeckt worden. Nach dessen Entfernung wurden die Anschlussgesimse wiederhergestellt, die Täfer restauriert und angepasst, die Holzmaserierung der Fenster rekonstruiert, der Parkettboden freigelegt und ein Hängeleuchter aus dem Korridor installiert.[9]
Das Wiedereinsetzen der hübschen, aber belanglosen Glasmalereien der Jahrhundertwende führte leider dazu, dass die qualitätvollen Arbeiten von Augusto Giacometti und Burkhard Mangold von 1930 entfernt wurden; der dekorative Gesamteindruck wurde einem bedeutenden Zeitzeugnis vorgezogen.[10]
Bedeutsam ist die Aktivierung der Halle unterhalb der Wandelhalle des Nationalrats. Die Galerie des Alpes wurde restauriert und mit dem dahinter liegenden, als Cafeteria eingerichteten Raum verbunden; es entstand ein attraktiver Begegnungsort. Die Fenster der historischen Räume wurden restauriert und mit neuen Verglasungen versehen. Zahlreiche hässliche Verglasungen der 1960er-Jahre wurden durch Nachbauten der historischen Fenster ersetzt.
Das dritte Obergeschoss wurde auf den Rohbau zurückgeführt und vollständig neu ausgebaut. Nach dem Abbruch der Studioeinrichtungen für Radio und Fernsehen und weiterer später eingebauter, meist verwinkelter Räume entstand eine übersichtliche Raumgruppe an einem um die Bogenfenster der Kuppelhalle laufenden Korridor – strukturell übernimmt er die Organisation der unteren Geschosse. Er wird durch grosse, die Lünettenfenster der Kuppelhalle belichtende Dachoblichter erhellt, die durch die Aussicht auf die Skulpturen des Daches die Orientierung erleichtern. Die daran anschliessenden Arbeitsräume für Mitglieder des Parlaments und die Parlamentsfraktionen übernehmen in Disposition und Gestaltung grundlegende Eigenschaften des bestehenden Baus, sprechen indessen eine heutige Sprache, einfach gestaltet, funktionell hochstehend, flexibel nutzbar. Sie haben eine gute Aussicht, lange zu bestehen.
Massnahmen am Äussern
An den Hauptfassaden waren keine wesentlichen Arbeiten nötig. Dagegen wurden die Sandsteinteile des Kuppelaufbaus renoviert. Entsprechend dem bei den Bundeshäusern üblichen Verfahren wurde dabei in der Manier längst vergangener Zeiten erneuernd renoviert, nicht konservierend restauriert. Zahlreiche Stücke wurden ersetzt, andere «auf den gesunden Grund» zurückgearbeitet und damit in Form und Substanz geschädigt.[11] Das Kupferblech der Kuppel selber konnte dafür entgegen den ersten Annahmen fast vollständig erhalten werden.[12] So blieben die Reste der ursprünglichen Vergoldung der Zierteile bestehen. Nach eingehender, kontroverser Diskussion wurden sie ergänzt oder neu aufgebracht.
Die Arbeiten an der Kuppel und eine neue Anleuchtung haben dem Parlamentsgebäude, dem wichtigsten baulichen Symbol der schweizerischen Eidgenossenschaft, wieder seine markante Stellung im Stadtganzen als Zentrum der städtebaulichen Neuordnung der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gesichert. Die erste umfassende Gesamtrestaurierung im Innern hat Ordnung geschaffen. In den Hauptgeschossen verbinden sich die historischen Räume auf selbstverständliche Art mit neu ausgestatteten Zimmern, im Dachgeschoss ist eine neue räumliche und gestalterische Ordnung entstanden. Dabei sind die historischen Qualitäten gewahrt und mit neuen architektonischen Qualitäten ergänzt worden.
Sicher, die Perfektionsansprüche waren enorm, der Erneuerungswille war umfassend, das Alter der historischen Substanz als eigener Wert ist kaum mehr spürbar. Angesichts der verheerenden Beschädigungen früherer Eingriffe und des berechtigten Repräsentationsanspruchs des Gebäudes ist diese grosse Eingriffstiefe indessen wohl vertretbar. Die Gesamtrestaurierung hinterlässt ein kostbares Gebäude, in dem sich das Alte und das Neue zu einem Ganzen verbinden. Es hat gute Chancen, für weitere hundert Jahre zu bestehen.
Anmerkungen/Literatur:
[01] Zu verdanken ist dieser Gesinnungswandel v. a. dem Projektleiter Hanspeter Seiler; er liess zahlreiche Räume restaurieren, unterstützt von Dr. Martin Fröhlich, zunächst als Sekretär der Eidg. Kommission für Denkmalpflege, 1978–2000 als Denkmalpfleger im Amt für Bundesbauten
[02] Das vom BBL forcierte Einglasen des Hofraums war denkmalpflegerisch so wenig zu vertreten wie ein gläsernes Eingangsbauwerk im Hof für einen unterirdischen Zugang. Bereits damals schlug die Denkmalpflege einen Zugang von Süden vor
[03] Architekten IAAG, Bern. Publiziert in Hochparterre 1/2003 sowie 1–2/2007
[04] Als einzige «künstlerische» Ausstattung beherbergt sie einen Druck der Dufourkarte ab den originalen Kupferplatten, auf der sich alle Besuchenden aus der Schweiz gewissermassen wiederfinden
[05] Das Pendant der Analyse des Vorbestands ist die noch zu erstellende Dokumentation der durchgeführten Arbeiten in einem Restaurierungsbericht
[06] Die Konstellation war insofern ungewöhnlich, als die Bauherrschaft in der Kunsthistorikerin
Monica Bilfi nger eine ausgezeichnete Kennerin des Parlamentsgebäudes zur Verfügung stellen konnte
[07] Die Sicherheitseinrichtungen und die mächtigen leuchtenden Korpusse am Empfang Seite Bundesplatz realisierten 2003 Clémençon + Ernst, Bern
[08] Deren statische Elemente wurden für die Sicherung der Treppenstufen mitgenutzt; da die Tragelemente abgehängt und auf Zug beansprucht sind, konnten sie sehr schlank ausgebildet werden
[09] Eine ähnliche Behandlung erfuhren auch andere Räume, so das Zeitungszimmer oder die Cafébar im 1. Obergeschoss
[10] Die Glasmalereien sind im Centre du vitrail in Romont deponiert
[11] Heutige Methoden gehen nicht von substraktivem Zurückarbeiten, sondern von additivem Ergänzen mit geeignetem Mörtel aus
[12] Erneuert wurden die Flach- und Steildächer sowie deren Spenglerarbeiten, die entsprechend der ursprünglichen Technik in verzinntem Blech mit Bleifugen ausgeführt wurden. Neue Oberlichtbänder entsprechend der Geometrie der historischen Stahlträger führen Tageslicht ein
[13] In der Diskussion war die Stellungnahme der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege entscheidend
– Eidg. Departement des Innern: Das neue Schweizerische Bundeshaus. Festschrift , Bern 1902
– Monica Bilfi nger: Das Bundeshaus in Bern. Schweizerischer Kunstführer GSK, Bern 2002 (auch in Französisch, Italienisch, Englisch)
– Bundesamt für Bauten und Logistik: Bundeshaus, Umbau und Sanierung Parlamentsgebäude Bern, 2006–2008. Bern 2008 (Dt./Franz./Ital./Romanisch). Mit Verzeichnis der Planer und Unternehmer
– Adrian Scheidegger, Markus Jakob: Aebi & Vincent Parlamentsgebäude in Bern. Bern 2009 (Dt./Franz.)
TEC21, Fr., 2009.05.15
verknüpfte Zeitschriftentec21 2009|20 Im besten Alter
![]()