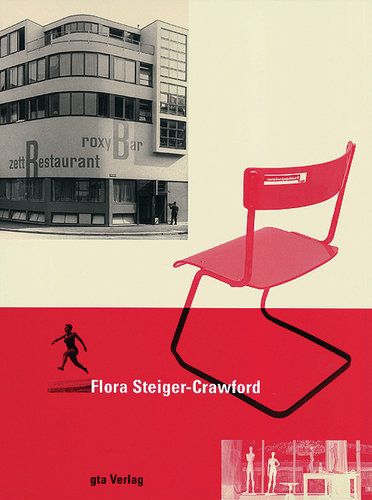Licht in allen Facetten
Das neue Haus für die Hotelfachschule im Zürcher Belvoirpark klärt eine städtebauliche Situation. Das Raumkonzept im Inneren schafft ein spannendes Miteinander von repräsentativen und funktionalen Räumen – wobei sowohl der Einfall des natürlichen Lichts als auch die eigens für das Haus entwickelten Leuchten eine wichtige Rolle spielen.
Das neue Haus für die Hotelfachschule im Zürcher Belvoirpark klärt eine städtebauliche Situation. Das Raumkonzept im Inneren schafft ein spannendes Miteinander von repräsentativen und funktionalen Räumen – wobei sowohl der Einfall des natürlichen Lichts als auch die eigens für das Haus entwickelten Leuchten eine wichtige Rolle spielen.
Die von Peter Märkli entworfene neue Hotelfachschule steht an der Geländekante zwischen Seestrasse und Belvoirpark. Durch seine präzise Setzung und die Volumetrie, die subtil auf die umgebenden Bauten reagiert, wird das Gebäude zu einem Scharnier zwischen einer Reihe von punktuellen Villenbauten entlang der Seestrasse und der Villa Schneeligut im Park.
Der 22 m hohe Neubau wendet sich mit einer fünfgeschossigen Fassade und zwei Annexbauten zum Belvoirpark. Dabei orientiert sich der Grundriss zum einen an der Flucht der Seestrasse, zum anderen nimmt er die Geometrie eines kleineren angrenzenden Gebäudes auf. Dadurch wird die flächig wirkende Parkfassade mit den regelmässig angeordneten, hochformatigen Fenstern einmal geknickt. Über die mittigen, grossflächigen Verglasungen, die in Anlehnung an eine klassische Säulenordnung dreigeteilt sind, zeichnet sich die zentrale Halle im Innern des Hauses gegen aussen ab.
Diese entwickelt sich vertikal über alle Stockwerke und lebt von der Wirkung des natürlichen Lichteinfalls und des Kunstlichts im Zusammenspiel mit den eingebauten Materialien. Das Kunstlicht stammt in erster Linie von lüsterartigen, eigens für den Bau gefertigten Leuchten. Vom Strassenraum nimmt man den Bau als dreigeschossiges Volumen wahr, dessen Fassade stärker geschlossen ist als zum Park hin, wobei sich die Halle auch hier über die Ausgestaltung der Fenster gegen aussen zeigt. Nicht zuletzt dank dem Kunstlicht, das den festlichen Charakter der Halle auch tagsüber von aussen ablesbar macht.
Das Licht im Gebäude war sehr früh im Entwurfsprozess ein Thema: Die Art der Beleuchtung hat sich zusammen mit der räumlichen Konfiguration des Gebäudes entwickelt.Peter Märkli hat dafür mit Lichtplaner Thomas Mika von Reflexion zusammengearbeitet, mit dem ihn eine langjährige Kooperation im Bereich der Lichtplanung verbindet.
Das Quadrat als wiederkehrende Form
Der grob verputzte Sockel in einem dunklen, kalten Grauton fasst das Haus mit den Annexbauten zu einem Ganzen. Der Rest der Fassade ist mit einem mineralischen Verputz in einem helleren Grau gehalten. Die Fensteröffnungen der Halle sind mit Betonfertigelementen konstruiert, die jeweils mit Pfeilern in einem dunkleren Farbton eingefasst sind. Trotz ihrer schlichten Ausgestaltung entsteht damit eine Assoziation mit der klassischen Villenarchitektur.
Ergänzt wird diese Wahrnehmung durch dekorative Elemente in Form von kleinen Quadraten, die aus dem gleichen Putz wie der Sockel bestehen und sich dadurch leicht von der Fassadenfläche abheben. Sie zeichnen das Eingangs- und das oberste Geschoss aus und schaffen in ihrer Kleinteiligkeit einen gestalterischen Bezug zu den benachbarten Fachwerkbauten im Park. Gleichzeitig lassen sie innerhalb der regelmässigen Fassadenordnung mit den hochformatig versetzten Fenstern eine zweite gestalterische Ordnung entstehen. Das gleiche Quadrat taucht als formales Grundelement auch bei den Leuchten in der Halle und im Restaurant wieder auf.
Zusammenspiel von Material und Licht
Dass die Geschosse nicht der Regelmässigkeit folgen, die man von aussen abzulesen glaubt, zeigt sich erst im Innern des Hauses: So ist das oberste Geschoss im Bereich des Auditoriums 4.5 m hoch, und das Eingangsgeschoss misst anders als die übrigen Stockwerke 3.5 m. Alle übrigen Geschosse sind 4 m hoch. Diese räumliche Grosszügigkeit entspricht zum einen den funktionalen Anforderungen einer Schule mit Seminarräumen und Auditorium, zum anderen unterstreicht sie den repräsentativen Charakter des Hauses, in dem sich Studierende aus aller Welt für Führungsaufgaben in Hotellerie, Gastronomie und Tourismus ausbilden lassen.
Das Haus betritt man von der Seestrasse aus über einen dunklen, mit schwarzem Naturschiefer verkleideten Raum. Dieser wirkt wie eine Schleuse, bevor man in die festlich beleuchtete Halle tritt, die sich im Gebäudeinnern als räumliche Figur über eine repräsentative Treppe nach unten und oben entwickelt und sich partiell über grosse Glasöffnungen nach aussen wendet. Auch hier sind die Wände mit dunklem Schiefer belegt.
Während der rote Teppich zusammen mit den grossformatigen Deckenleuchten dem Raum einen repräsentativen, fast festlichen Ausdruck verleiht, sind die Betondecken lediglich weiss gestrichen und vermitteln zusammen mit den weissen Akustikelementen einen rohen Charakter. Die mit Olivenholzfurnier belegten, fast raumhohen Türen, die in die angrenzenden Schulungsräume führen, wirken in ihrer Gestaltung wiederum eher klassisch.
Die Halle als mehrfach nutzbarer Raum
Durch die riesigen Fenster, die den angrenzenden Belvoirpark und die Landschaft in der Ferne zu Bildern fassen, entsteht in der Halle eine schöne Raumstimmung. Die zweiseitig angedockten Treppenhäuser übernehmen die Brandschutzfunktion und entlasten – ebenso wie die vier Körper, in denen die gesamte Haustechnik zusammengefasst wurde – die Halle in funktionaler Hinsicht. Solchermassen vollständig freigespielt kann sie als Treffpunkt oder als Ort zum Lernen dienen. Sie ist Foyer, Bibliothek, aber auch Rückzugsort. Und es finden darin Lernsituationen Platz, sei es die eigens dafür eingerichtete Übungsbar oder die Rezeption.
Die Halle wird ebenso wie die angrenzenden Treppenhäuser oder die Schulungsräume werden durch die raumhohen Fenster natürlich belichtet. Zusätzlich sorgen neben dem Stimmungslicht der grossformatigen Leuchtkörper in die Decke eingelassene Downlights – beispielsweise im Bereich des Empfangs oder der Bar – für gutes Arbeitslicht. Um die Halle ordnen sich situativ, je nach Nutzung des Stockwerks unterschiedlich, die zudienenden Räume wie Büros oder Sanitärbereiche.
Stimmungs- und Arbeitslicht
Das Restaurant im Gartengeschoss dient als Mensa für die Schülerinnen und Schüler, kann aber gleichzeitig als Ort für besondere Anlässe genutzt werden. Dafür sorgen das Eichenparkett, die kupferfarbenen Elemente, die Lüftungs- und Akustikelemente aufnehmen, der rundumlaufende Fries, der im überhohen Raum den menschlichen Massstab vermittelt, sowie die Deckenleuchten, die auf demselben Entwurfsprinzip basieren wie diejenigen in der Halle: Ausgehend vom Leuchtmittel LED bilden Flachstahlprofile, die mit quadratischen Gläsern bestückt sind, die Tragkonstruktion.
Durch Lufteinschlüsse im Glas wird eine diffuse Transparenz erzeugt, durch die das Licht der LED fällt. Während die Gläser in der Halle flache, kronleuchterartige Einzelstücke bilden, die damit eine gewisse Nobilität ausstrahlen, sind die Leuchten im Restaurant als repetitive, nicht gerichtete Elemente eingesetzt. Das warme, schimmernde Licht, das so in Halle und Restaurant erzeugt wird, kann auch von aussen wahrgenommen werden und vermittelt damit auf einer informellen Ebene den repräsentativen Charakter des Schulgebäudes. Die Leuchtstärke spielt hier keine zentrale Rolle.
Anders in den Seminarräumen: Auch diese Leuchten wurden eigens für ihren Zweck entworfen. In die viereckigen Elemente sind nicht nur die dimmbaren Leuchtkörper eingelassen, sie können auch kühlen, entlüften und heizen. Im Gegensatz zu den warm schimmernden Leuchtgebilden in der Halle verströmen sie ein kühles Arbeitslicht und sind so aufgebaut, dass sie für die verschiedenen Arbeits- und Unterrichtssituationen die gewünschte Lichtsituation erzeugen.
Trotz dem hohen funktionalen Stellenwert, den die Leuchtkörper haben, überzeugen sie als gestalterische Objekte an sich: Sie vermitteln auch auf formaler Ebenen in ihrer schlichten, geometrischen Form ihre hauptsächliche Funktion als Arbeitsleuchten. Eine Wirkung, die verstärkt wird, indem die Leuchten an die sichtbare geführte Infrastruktur der Haustechnikversorgung angeschlossen sind. Wie in den repräsentativen Räumen zeichnet auch dieses Licht die Funktion der Räume nach aussen ab und macht damit den inneren Aufbau der Hotelfachschule transparent.
TEC21, Sa., 2016.01.16
verknüpfte Zeitschriften
TEC21 2016|03-04 Kunstlicht im Raum