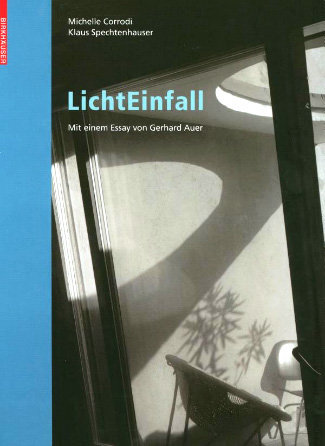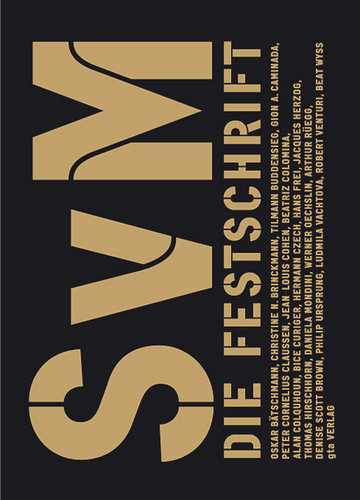Vom Pharmasitz zum Stadthotel
Der Hotelier Florian Weitzer startete 2010/11 das ambitionierte Projekt, ein Wiener Bürohaus aus der Zeit des Baubooms in ein Hotel zu verwandeln – was viele mit Skepsis verfolgten. Heute zählt das Hotel Daniel zu den angesagten Adressen, der Fortbestand einer Architekturikone ist gesichert.
Der Hotelier Florian Weitzer startete 2010/11 das ambitionierte Projekt, ein Wiener Bürohaus aus der Zeit des Baubooms in ein Hotel zu verwandeln – was viele mit Skepsis verfolgten. Heute zählt das Hotel Daniel zu den angesagten Adressen, der Fortbestand einer Architekturikone ist gesichert.
Auf den ersten Blick könnte das Gebäude am stark befahrenen Landstrasser Gürtel durchaus als Neubau durchgehen. Das etwas geschulte Auge jedoch identifiziert die Glasfassade mit dem filigranen Aluminiumraster und die sanft zum Eingang ansteigende Freitreppe aus porösem Travertin rasch als patiniert und aus einer anderen Zeit stammend, desgleichen das im hinteren Gebäudebereich untergebrachte Treppenhaus, das eindeutig den gestalterischen Duktus der 1950er-/1960er-Jahre aufweist. Den bauzeitlichen Beweis liefert dann der Blick an die Decke, sowohl in der Hotellobby als auch in den Zimmern: Hier zeigt sich unverdeckt und roh der Sichtbeton mit seinen Alterungsspuren. Tatsächlich wurde das Gebäude 1959–1962 von Georg Lippert (1908–1992), damals einer der meistbeschäftigten Architekten Österreichs, als Büro- und Produktionsgebäude des Basler Pharmakonzerns Hoffmann-La Roche geplant und errichtet.
Hoffmann-La Roche Wien
Als Mitte der 1950er-Jahre auch in Österreich ein wirtschaftlicher Aufschwung einsetzte, beschloss Hoffmann-La Roche, am bereits seit 1907 existierenden Wiener Standort zu expandieren. Nach eingehender Evaluierung konnte die Firma 1958/59 südlich des Stadtzentrums an der Ecke Landstrasser Gürtel/Jacquingasse ein geeignetes Grundstück für einen Neubau erwerben. Mit seinen unterschiedlichen Nutzungen und Funktionen war das Gebiet bereits damals ein dezidiert städtischer Ort. Hier verdichteten sich stadträumliche Schnittstellen auf engstem Raum – der mehrspurige Gürtel als wichtige Verkehrsachse, dichte Blockrandbebauungen aus der Gründerzeit, aufgebrochen durch das weitläufige Areal des Schlosses Belvedere, der Schweizergarten, in dem damals gerade der Österreich-Pavillon der EXPO 58 in Brüssel von Karl Schwanzer als Museum des 20. Jahrhunderts wiederaufgebaut wurde («20er Haus», 1959–1962), und letztlich der neue Südbahnhof (1951–1961) an städtebaulich markanter Ecklage zwischen Wiedner Gürtel und Arsenalstrasse. Auf dem erworbenen Grundstück stand zudem noch die kriegszerstörte Ruine des 1894/95 von Fellner & Helmer erbauten neubarocken Palais Lanckoron´ski, die 1960 endgültig abgerissen wurde.
Georg Lipperts Projekt entstand ab 1959 in enger Zusammenarbeit mit wichtigen Entscheidungsträgern bei Hoffmann-La Roche. Sicher hatte auch Roland Rohn (1905–1971), damals Hausarchitekt des Konzerns und mitverantwortlich für dessen Corporate Design, den 1960–1962 umgesetzten Entwurf kritisch begleitet und gutgeheissen. Lippert platzierte den langrechteckigen, siebengeschossigen Bau mit der Längsseite gegen den Landstrasser Gürtel. Als Konstruktion für das von der Strasse leicht zurückversetzte Gebäude wählte er ein Stahlbetonskelett mit Rundstützen und Plattendecken sowie zusätzlichen Aussteifungen im Treppenhaus und in den Aufzugs- und Sanitärbereichen.
Umhüllt wurde das Skelett von einer membranartigen Aussenhaut mit ursprünglich 534 Elementen aus eloxierten Aluminiumprofilen und Isolierglas – eine der ersten Curtain Walls in Österreich. Der vom Terrain leicht abgehobene, scharf geschnittene Baukörper mit dem grünlich reflektierenden Glas der Fassaden und dem als Flugdach stilisierten, bei Nacht hinterleuchteten Kranzgesims verliehen dem Gebäude von Anfang an einen hohen Wiedererkennungswert. Lippert schuf einen der internationalen Moderne verpflichteten Bau mit einem eleganten, zeitlosen Äusseren, das die zukunftsorientierte Haltung des Basler Pharmaunternehmens eindrücklich visualisierte. Auch stadträumlich vermochte er zwischen der geschlossenen Bebauung der Jacquingasse und den anschliessenden offenen Bereichen gut zu vermitteln.
Weniger spektakulär, die Möglichkeiten der Skelettkonstruktion jedoch konsequent ausnützend, war das Innere durch Leichtbauwände frei unterteilbar und konnte an die wechselnden Anforderungen der Verwaltungs-, Labor-, Produktions- und Lagerbereiche flexibel angepasst werden. Als die Flächen nicht mehr reichten, wurde 1972–1974 ein ebenfalls von Lippert geplanter Erweiterungsbau an der Rückseite des Hauses errichtet. In den 1990er-Jahren gab Hoffmann-La Roche das Gebäude auf, und verschiedene Firmen nutzten es fortan für Bürozwecke. Nach längerem Leerstand erwogen die damaligen Eigentümer eine Generalsanierung unter Wahrung der ursprünglichen Nutzung als Bürobau.
Aus Roche wird Daniel
2008 erfolgte im Vorfeld der geplanten Sanierungen eine umfangreiche Prüfung des Bauzustands. Dabei wurde der generelle Zustand als sehr gut beurteilt; als wesentliche Probleme wurden wie bei den meisten Bauten jener Zeit insbesondere energetische Mängel (erhebliche Wärmeverluste aufgrund zahlreicher Wärmebrücken und mangelhafter Dämmung) und nicht erfüllte Sicherheits- und Brandschutzanforderungen festgestellt (fehlende Absturzsicherung im Brüstungsbereich, keine Sicherheit vor Brandüberschlag von Geschoss zu Geschoss u. Ä.). Um den Fortbestand der Büronutzung zu ermöglichen und die entsprechenden Vorgaben zu erfüllen, wäre nur – so die Analyse – der komplette Ersatz der Fassade durch einen dem originalen Erscheinungsbild entsprechenden Nachbau infrage gekommen. Dafür fehlte damals aber das Geld; und zudem entschloss sich das Bundesdenkmalamt 2009 – im Zeichen der zunehmenden Sensibilisierung für wichtige Bauten der Nachkriegsmoderne –, das Gebäude unter Schutz zu stellen, wobei Fassade und Treppenhaus in jedem Fall erhalten, das ohnehin bereits umgebaute Innere jedoch verändert werden durften. Die wenig aussichtsreiche Lage änderte sich mit dem Auftritt des Grazer Hoteliers Florian Weitzer.
Als Weitzer auf der Suche nach einem geeigneten Wiener Standort das ehemalige Roche-Gebäude entdeckte und dann noch erfuhr, dass es Georg Lippert errichtet hatte, war die Sache für ihn klar: Denn Lippert war auch der Architekt des Hotels Daniel beim Grazer Hauptbahnhof (1955/56), das Weitzer seit 1974 betreibt und in dem der Hotelier, der eher vielgewandter Ausprobierer denn klassischer Hotelmanager ist, sein «Smart Luxury»-Konzept erfolgreich umgesetzt hat. Für sein Wiener Projekt fand Weitzer mit Atelier Heiss Architekten ein Büro, das bereits im Vorfeld von Sanierung und Umbau 2010/11 ein regelrechtes Faible für den Bau aus den 1960er-Jahren entwickelt hatte.
Die zukünftige Hotelnutzung ermöglichte nun die substanzielle Erhaltung der Fassade: Sie wurde saniert, fehlende und beschädigte Teile wurden gemäss Bestand erneuert. Die ungenügenden energetischen und akustischen Dämmeigenschaften wurden in Kauf genommen und müssen auch von den Hotelgästen toleriert werden. Im Zuge der Anpassungen an aktuelle bauliche Auflagen kam es im Innern zur Errichtung eines zweiten Treppenhauses. Abgebrochen wurde hingegen eine später errichtete Erschliessung zwischen Hauptbau und rückseitigem Erweiterungsbau, wodurch der ursprüngliche solitäre Charakter des Gebäudes wiederhergestellt werden konnte. Eine sorgfältige Erneuerung erfuhr das original erhaltene Haupttreppenhaus, lediglich ein kleiner Teil der Verglasung musste im Bereich der unteren vier Geschosse aufgegeben werden. Gegen Brandüberschlag und als Absturzsicherung wurden innenliegend bis zum unteren Fensterrand Brüstungsmauern angebracht.
Im Innern bestanden – abgesehen vom Treppenhaus – keine originalen Bestandteile mehr, und auch der gewachsene Zustand war alles andere als schützenswert. Somit konnte eine auf die neue Hotelnutzung abgestimmte komplette Neustrukturierung vorgenommen werden, wobei die Skelettkonstruktion entsprechende Freiheiten erlaubte, gleichzeitig aber auch den Raster für den Einbau der Hotelzimmer vorgab. Während im Untergeschoss Mitarbeiter-, Lager- und weitere Nebenräume Aufnahme fanden, wurde das Erdgeschoss als grosser, offener Raum mit Lobby, Rezeption, Shop, Restaurant- und Frühstücksbereich gestaltet. Lediglich die Küche, ein minimales Backoffice, zwei barrierefreie Zimmer und eine Gästetoilette sind räumlich abgetrennt. Gegen den parkartigen Bereich zum Gürtel ist das Erdgeschoss mit einer Terrasse erweitert worden.
In den sechs Obergeschossen fanden insgesamt 115 relativ kleine Doppelzimmer Platz. Die schmalen Zimmer, jeweils zwei zwischen einem Stützenabstand, weisen meist noch eine Einknickung in der Trennwand auf, um das Bett quergestellt unterzubringen und auch noch zirkulieren zu können. Lediglich die um den neuen Erschliessungskern angeordneten Räume sind grösser, zudem eine Suite im obersten Geschoss mit Aussicht auf Belvedere und Innenstadt. Das Dachgeschoss konnte nicht für die Hotelnutzung umgebaut werden, wiederhergestellt wurde aber die indirekte Beleuchtung des für das Gebäude so charakteristischen Flugdach-Kranzgesimses.
Erhalten blieb auch samt Schienen – quasi als kleines Industriedenkmal – die Aufzugsanlage für den Fassadenreinigungskorb.
«Smart Luxury»
Sanierung und Umbau sind nicht nur von der zuständigen Fachstelle als «rundum geglücktes Beispiel für die Denkmalpflege» gewürdigt worden. Das ist die eine Seite. Die andere ist das Betreiberkonzept, das dem Gebäude seinen Erfolg beschert. Geboten wird im Daniel für den «Urban stay» der Gäste «Smart Luxury»: Unnötige Dinge werden weggelassen, stattdessen jene Annehmlichkeiten ermöglicht, die man eigentlich immer schon wollte – wie etwa einen bereitstehenden Scooter für individuelle Stadterkundungstrips.
Dazu gehört auch der Verzicht auf das Sterne-System, das Weitzer – der für die Einrichtung des Hotels zu einem grossen Teil selbst verantwortlich zeichnet – als völlig veraltet taxiert. Er setzt auf Originalität, Individualität und Innovation anstelle strikter Normen: So besteht die Rezeption aus einer charmanten Vintage-Vitrine, die Einrichtung des Restaurantbereichs strahlt gehobenen Flohmarkt-Chic aus, allenthalben fällt der Blick auf roh belassene Bereiche des Betonskeletts, geduscht wird in den Zimmern in einer frei in den Raum gestellten Glaskabine, relaxen kann man in einer Hängematte.
Im parkähnlichen Bereich gegen den Gürtel, in dem auch das 116. Zimmer steht, ein silbrig glänzender Trailer von 1952, wird Urban Gardening praktiziert, während auf dem Dach viele fleissige Bienen den Rohstoff für den Honig liefern, der unten im Shop zum Verkauf steht. Letzterer bietet ein breites Sortiment an Gadgets, durch deren Erwerb man sozusagen ein Stück Daniel mit nach Hause nehmen kann. Bekrönt wird dieser Mikrokosmos von einem auf dem Dach installierten, gefährlich nach unten gebogenen Segelboot in Originalgrösse – Erwin Wurms Kunstwerk «Misconceivable»».
Bestand und Veränderung
Das Hotel Daniel vermag mehrere Dinge unter einen Hut zu bringen. Zuallererst hat die Neunutzung als Hotel den Fortbestand des Gebäudes und der denkmalgeschützten Curtain-Wall-Fassade in ihrer originalen Substanz gesichert. Man kann einwenden, dass dies jener vielfach praktizierten Manier entspricht, lediglich die historische Hülle eines Gebäudes zu bewahren und das Innenleben komplett zu erneuern. Allerdings zielte dieser Bau mit dem frei gestaltbaren Grundriss bereits in seiner Anlage auf Veränderung und Anpassung ab. Insofern ist der Umbau in ein Hotel, der ja auch die Skelettstruktur unangetastet lässt, nur eine weitere Nutzungsschicht, die jederzeit verändert oder durch eine neue abgelöst werden kann.
Im Weiteren hat der Umbau unter Beweis gestellt, dass es auch für die Erhaltung von Bauten aus den Boomjahren tragfähige Lösungen gibt. Voraussetzung dafür sind ein entsprechendes Nutzungskonzept, kompetente Planer und aufgeschlossene Behörden, insbesondere die Denkmalpflege. In diesem Fall konnte so einer jener charakteristischen Nachkriegsbauten in Österreich erhalten werden, die leicht verspätet den Anschluss an die internationale Moderne signalisierten. Überhaupt wurde das Gebäude in einer bewegten Zeit fertiggestellt, in der unterschiedliche Strömungen, Tendenzen und kulturelle Grundhaltungen aufeinandertrafen: der humane Funktionalismus Roland Rainers, der zeichenhafte Modernismus Karl Schwanzers, positivistische Haltungen, die eine von Fortschritt und Technik ausgehende Architektur verfochten, ebenso sich herausbildende Positionen – später unter «The Austrian Phenomenon» subsumiert –, die diesen «Bauwirtschaftsfunktionalismus» fundamental kritisierten und ein völlig neues Verständnis von Architektur und gebauter Umwelt vertraten.
Das Weiterbestehen des Hoffmann-La Roche-Baus ist aber auch wichtig für die Dokumentation des gebauten Werks von Georg Lippert, denn einige seiner zentralen Grossbauten wie das Bürogebäude der Bundesländer-Versicherung (1959–1962) oder das Verwaltungsgebäude der Austrian Airlines (1975–1978) sind mittlerweile abgebrochen worden. Projekte wie das Daniel könnten aber durchaus auch Anlass bieten zur kritischen Aufarbeitung von Werk und Biografie des jeweiligen Architekten, was gerade bei Georg Lippert zu einigen neuen Erkenntnissen führen würde.
Die Verwandlung des ehemaligen Roche-Baus reflektiert letztlich auch die beträchtlichen Veränderungen in unmittelbarer Nähe. Das Gebiet ist noch städtischer geworden und heisst nunmehr Quartier Belvedere. Aus dem Museum des 20. Jahrhunderts im Schweizergarten ist das «21er Haus» geworden (Umbau/ Erneuerung durch Adolf Krischanitz, 2007–2011), der während 50 Jahren gebietsprägende Südbahnhof wurde 2009/10 abgerissen. Während an seiner Stelle jetzt der elegant geschwungene Erste Campus steht, fahren die Züge nun vom etwas weiter südwestlich gelegenen neuen Hauptbahnhof Wien ab. Es war dieser neue Bahnhof, der als wichtiger Impulsgeber für die Gegend fungierte – auch für die Entscheidung, ein Bürogebäude aus den 1960er-Jahren in ein Hotel der etwas anderen Art umzubauen.
TEC21, Fr., 2017.06.09
verknüpfte Zeitschriften
TEC21 2017|23 Nachkriegsmoderne: Pioniere neu entdeckt