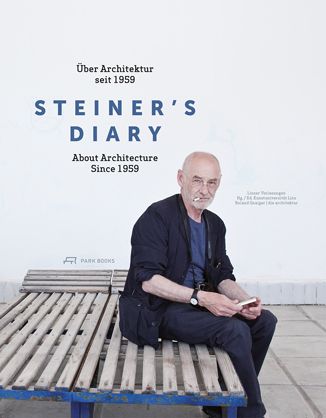Anlässlich der 15. Kleinkonferenz stellte am 4. Juli 2011 Maria Vassilakou, Stadträtin für Stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung und BürgerInnenbeteiligung...
Anlässlich der 15. Kleinkonferenz stellte am 4. Juli 2011 Maria Vassilakou, Stadträtin für Stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung und BürgerInnenbeteiligung...
Anlässlich der 15. Kleinkonferenz stellte am 4. Juli 2011 Maria Vassilakou, Stadträtin für Stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung und BürgerInnenbeteiligung ihre Pläne und konkreten Vorhaben für die nächsten fünf Jahre dar. Die Exklusivität der Kleingruppe erlaubte es, auf die Interessens- und Themenschwerpunkte der Partnerfirmen des Architekturzentrum Wien zielgerichtet einzugehen, bereits im Vorfeld wurden Wünsche und Anliegen in einem Fragenkatalog gesammelt. Dietmar Steiner moderierte den Abend.
Dietmar Steiner: Was sind die Zielgebiete der Stadtplanung aus heutiger Sicht? Was sind die Prioritäten und Umsetzungshorizonte? Wohin soll sich die Stadt entwickeln?
Maria Vassilakou: Ich bin nicht der größte Fan von Zielgebieten, sie sind jedoch ein Instrument, das sich zunächst bewährt hat, beispielsweise die Funktion des Zielgebietskoordinators, der auch die Möglichkeit hat, sich in mehreren Magistratsabteilungen zu bewegen, anstatt isoliert zu arbeiten. Die Zielgebiete haben sich im Wesentlichen positiv entwickelt. Die Stadt definiert sehr wohl, wo verdichtet werden soll, wo Wachstum notwendig ist und versucht dort Boden zu erwerben. Natürlich sind auch die Investoren und Anwohner eingeladen, mitzudiskutieren, Transparenz und Klarheit sollten gewährleistet werden.
Der neue Stadtentwicklungsplan (STEP) gibt uns die Möglichkeit, das Instrument der Zielgebiete zu evaluieren. Das, was daran funktioniert, soll beibehalten werden. Das wäre die Festlegung auf einige bereits zuvor definierte Areale, wo es Sinn macht zu wachsen. Hier braucht es auch eine intensive Bearbeitung und Koordination. Andererseits bin ich eine Befürworterin von Bezirksentwicklungsplänen und möchte grundsätzlich den neuen STEP auch so aufsetzen, dass er nicht nur der interessierten Fachöffentlichkeit, Investoren, Architekten und Entwicklern, sondern insgesamt Bürgern die Möglichkeit gibt, sich einzubringen, mitzudiskutieren und am Ende zu wissen, wo und wie dieses Wachstum stattfinden soll.
DS: Mit Stadterweiterung, mit der neuen Stadtentwicklung ist auch die Frage der sozialen Infrastruktur verbunden. Die rechtzeitige Ausstattung der neuen Zielgebiete mit Schulen und Kindergärten etc. scheint immer noch ein Problem zu sein. Es gibt doch eine Infrastruktur- Kommission, die das festlegen sollte. Gibt es da einen Bruch zwischen Stadtentwicklung und Infrastruktur?
MV: Derzeit entsteht in der Stadt so viel, dass es kaum möglich ist, mit den Infrastrukturkosten mitzuhalten. Ich habe mir die Budget-Prognose für das kommende und für das übernächste Jahr angesehen. Das nächste Jahr ist dramatisch. Es wird etwa doppelt so hohe Infrastrukturkosten geben als derzeit dafür vorgesehen und budgetiert ist. Die Verhandlungen werden noch zu führen sein. Es werden hohe Infrastrukturkosten im Bereich Kindergärten und Schulen, dazu noch Kanalanschlüsse, Straßen, Fernwärme etc. auf uns zukommen. Nicht zu vergessen die Ebene des Grünraums: Wir haben zunehmend Areale, für die wunderschöne Leitbilder existieren, jedoch das Geld für die Verwirklichung fehlt. Ich denke, eine Lösung kann nur der Weg hin zur Planwertabgabe sein. Damit hätten wir die Möglichkeit, die Infrastruktur dementsprechend zu gestalten und zu finanzieren. Die Planwertabgabe ist sowohl im Zusammenhang mit der Deckung der Infrastrukturkosten als auch als Bodenmobilisierungsmaßnahme wichtig.
DS: Das heißt also auch Flächenmobilisierung. Seitdem ich mit dem System des geförderten Wohnbaus in Wien zu tun habe, sehe ich, dass die Kosten am Limit sind – die Bauträger verbluten, die Architekten sowieso schon immer, aber auch die Baufirmen und die Förderung. Warum wird das politisch nicht stärker thematisiert?
MV: Das ist sehr heikel. Es macht zum Beispiel Sinn, mit zeitlich befristeten Widmungen zu arbeiten. Kombiniert man diese mit einer Planwertabgabe, hat man bereits eine Flächenmobilisierungsmaßnahme geschaffen. Hier eine Lösung zu finden, ist allerdings juristisch nicht einfach. Es gibt daher eine Arbeitsgruppe, die konkret an einer Planwertabgabe für Wien arbeitet. In dieser Gruppe sitzen sowohl Planer als auch Juristen aus dem Magistrat, die Leitung hat ebenfalls ein Jurist aus der Magistratsdirektion inne. Durch das gemeinsame Arbeiten von Planern und Juristen kann von vornherein ein „das geht so nicht“ der Juristen verhindert werden.
DS: Viele Raumplaner sind der Meinung, eine Planwertabgabe hält nicht vor der österreichischen Verfassung.
MV: Ich denke, dass die Verfassungskonformität ein wesentlicher Aspekt ist. Andererseits sollte die Verfassung nicht als Vorwand genommen werden, neue Ideen von vornherein abzulehnen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Dinge zunächst angeblich nicht gehen – die Planwertabgabe oder die Anrainerparkplätze, um ein zweites Beispiel zu bringen. Bei genauerem Hinsehen stellt man aber fest, es geht doch. Es ist zwar nicht einfach, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
DS: Im Zusammenhang mit der Planwertabgabe gleich zu einer weiteren Frage: Wann kommt es endlich zu einer Reform der Verfahren zu Flächenwidmung und Bebauungsplan? Abänderungen dauern zu lange, sind oftmals inhaltlich nicht nachvollziehbar und lassen jede Vision einer verträglichen Stadtentwicklung vermissen.
MV: Die Instrumente sind schon sehr lange in Verwendung und sicher modernisierungsbedürftig. Sie werden dem Prozesshaften der heutigen Widmung und des heutigen Städtebaus in keiner Art und Weise gerecht. Wir haben im Zuge des neuen Stadtentwicklungsplans mehrere Bereiche definiert, die neu diskutiert werden. Einer davon ist, neue Instrumente im Rahmen der Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung zu schaffen. Ich ersuche jedoch um Verständnis, dass ich heute dazu nichts sagen kann. Das Wesen einer Debatte ist, dass man zusammenkommt, sich einbringt und miteinander diskutiert und dass man am Ende gemeinsam einen neuen Weg aufzeigt. Ich bin überzeugt, dass der neue Stadtentwicklungsplan vor allem in Kombination mit der Novelle des Garagengesetzes und der Bauordnung, die wir ebenfalls für das nächste Jahr vereinbart haben, einiges in Bewegung bringen wird.
DS: Die Reform der Bauordnung ist ein jahrzehntelanger Wunsch aller Beteiligten und Betroffenen. Jede Reform hat sie schlimmer gemacht.
MV: Ja, natürlich ist das eine sehr komplexe Materie. Wesentlich ist, dass man solche Reformen nicht hinter verschlossenen Türen angeht, sonst wird dieses Flickwerk aus Kompromissen nur weitergetragen. Der neue STEP gibt uns die Möglichkeit, öffentlich und transparent zu diskutieren. Ein Design stellt sicher, dass sowohl die Fachöffentlichkeit, Investoren, Entwickler, Universitäten, der Magistrat und die Bezirke, aber auch interessierte Bürger die Möglichkeit haben, verschiedene Themen abzuarbeiten, miteinander zu verschränken. Mir ist wichtig, am Ende ein schlankes, verständliches Produkt zu haben.
DS: Es gibt zur Stadtentwicklung auch ganz konkrete Fragen für bestimmte Areale: Nordbahnhof, Nordwestbahnhof, Franz-Josefs-Bahnhof, Westbahnhof, das rechte Donauufer, Donaufeld.
MV: Beim Nordbahnhof ist derzeit ein städtebaulicher Ideenwettbewerb für das Gebiet Innstraße/Nordbahnstraße in Vorbereitung. Der Wettbewerb für den Bank Austria Campus läuft gerade. Für die Vorplatzgestaltung, das heißt für das Entree in den Nordbahnhof gibt es von unserer Seite Bemühungen um einen gesonderten Wettbewerb.
Beim Nordwestbahnhof ist die Entwicklungsperspektive eine mittel- bis langfristige. Die ÖBB wollen sowohl die Trasse als auch den Bahnhof selbst 2019 freigeben. Hier gibt es hervorragende Ideen, viel Grünraum mit hoher Qualität. Wir hätten auch die Möglichkeit, ein ähnliches Konzept wie die „High Line“ in New York zu verwirklichen. Unsere Aufgabe in der nächsten Zeit wird es sein, die Flächen dafür sicherzustellen.
Beim Franz-Josefs-Bahnhof haben wir es mit einem Areal von immenser Wichtigkeit, insbesondere für den 9. Bezirk, zu tun. Ich möchte hervorheben, dass es hier eine frühe Einbindung von interessierten Bezirksbewohnern gab. Die Durchwegung und Verbindung zum Wasser sind von besonderer Bedeutung. Hier könnte ein neuer Stadtteil gewonnen werden, der eine Bereicherung für den 9., teilweise auch für den 20. Bezirk wäre. Die Verhandlungen gestalten sich zwar freundlich, aber nicht unkompliziert. Die wesentliche Frage ist hier, ob die Platte, genauer gesagt die Bahn bleibt oder nicht, denn dann wäre hier auch Wohnbau möglich.
Für die weitere Entwicklung des rechten Donauufers ist die Linie U2 natürlich vorteilhaft. Mit dem Projekt „Marina-City“, das jetzt einen neuen Startschuss bekommen hat, zeigen wir anhand eines Leitprojekts, wohin es geht. Das Projekt sieht zwar eine unterbrochene, aber doch großzügige Überplattung des Kais und eine Anbindung an das Ufer vor. Christoph Chorherr hat vor mehr als einem Jahrzehnt die Idee geboren, Wien nicht neben der Donau zu haben, sondern an die Donau zu bringen. Auch in diesem Bereich wird mittels einer Machbarkeitsstudie das Realisierungspotenzial überprüft werden.
DS: Es gibt beim STEP zurzeit über diese konkreten Gebiete hinaus zwei weitere Stadtentwicklungsgebiete, die im Fokus der Diskussion stehen. Das sind die Ränder Wiens, Liesing im Süden und das Donaufeld und Kagran im Norden, wo sich zwar in den letzten Jahrzehnten viel entwickelt hat, aber gleichzeitig ein infrastrukturelles und verkehrsmäßiges Desaster entstanden ist.
MV: In Liesing sehe ich ein großes Entwicklungspotenzial, auch für innovative Projekte auf der „grünen Wiese“. Es wird zum Beispiel über „City-Farming“ diskutiert, die Konzepte in diesem Bereich bringen einiges an Neuerungen mit sich. Ich glaube, dass es uns gelingen wird, dort etwas entstehen zu lassen, das wir in einigen Jahren stolz präsentieren können. Für das Donaufeld gibt es ein ausgezeichnetes Leitbild, das im Herbst diskutiert und präsentiert wird. Es setzt stark auf sanfte Mobilität – ein sehr modernes Mobilitätskonzept – und Grünraum. Spannend ist dort auch die Frage nach der Gestaltung der Dichte. Das Zentrum Kagran scheint jetzt unter den Zielgebieten auf, um die Verkehrssituation und die mangelnde Qualität im öffentlichen Raum zu verbessern. Es wird nicht möglich sein, alle Sünden der Vergangenheit zu reparieren, aber man wird einiges verändern können.
DS: Zum Thema Dichte und öffentlicher Raum gibt es das Vorzeigemodell Kabelwerk in Wien, das auch international wahrgenommen und akzeptiert wird. Ich halte das im Verhältnis zu anderen Stadterweiterungsgebieten für einen durchaus gelungenen Städtebau. Ich habe immer wieder gehört, dass viele Abteilungen der Stadt davor zurückschrecken, dieses doch mühsame, kooperative Verfahren noch einmal anzuwenden. Oder könnte es doch als Vorbild für weitere Projekte gelten?
MV: Ich kenne niemanden, der davor zurückschrecken würde. Das Kabelwerk hat gezeigt, wie man es macht, auch in Bezug auf das frühe Einbinden der Bevölkerung und das Konzept der kulturellen Zwischennutzung. Natürlich hatte das Kabelwerk auch den Vorteil einer hervorragenden Infrastruktur- und Nahversorgungssituation. Kooperative Verfahren bringen einiges, funktionieren aber nur bis zu einer bestimmten Größe, siehe dazu das Beispiel „Mehrwert Simmering“.
DS: Bei der Zwischennutzung geht es immer auch um die Frage der Haftung und Zulassung.
MV: Zwischennutzungen brauchen eine gewisse Rechtssicherheit für beide Seiten. Wir arbeiten an der Entwicklung von Musterverträgen für unterschiedliche Formen der Zwischennutzung: sowohl für Gemeinschaftsgärten, also City-Farming-Initiativen, als auch für temporäres Wohnen. Was noch zu entwickeln sein wird, ist die temporäre Nutzung von Geschäftslokalen. Wenn zum Beispiel die TU oder die Universität für angewandte Kunst Räume für bestimmte Lehrveranstaltungen suchen, dann sprechen wir vom Konzept einer „university in progress”. Hier braucht es schon eine gewisse rechtliche Klarheit.
DS: Wir kommen zur generellen Frage der Mobilität. Ich nenne es nicht Verkehr, ich nenne es die Mobilitätsfrage. Ich glaube, die europäischen Städte nähern sich langsam dem Kollaps. Kann sich der Individualverkehr in Zukunft überhaupt noch bewegen? Meiner Beobachtung nach passiert in französischen und spanischen Städten wesentlich mehr als in Wien, was zum Beispiel die Installierung und Bevorrechtung von Straßenbahnen betrifft. Hier scheinen die Wiener Linien ins Stocken geraten zu sein.
MV: In Wien haben wir vor allem eine Fixierung auf die U-Bahn, deren Bau jedoch sehr lange dauert und darüber hinaus mit hohen Kosten verbunden ist. Persönlich bin ich daher auch ein großer Fan der Straßenbahn. Sie kostet ein Zehntel des Geldes der U-Bahn, sie braucht ein Zehntel der Zeit, um realisiert zu werden und ist wahrscheinlich auch das, was wir in den meisten Gebieten derzeit brauchen würden.
DS: Nur der Bund zahlt nichts dazu.
MV: Richtig. Aber das eigentliche Problem ist nicht die fehlende Infrastruktur, sondern die zu langen Intervalle. Die Diskussion „U-Bahn bis ins Umland“ ist nicht notwendig, da wir mit der S-Bahn eine sehr hochwertige Schienen-Infrastruktur besitzen, die Wien zum Beispiel mit Klosterneuburg verbindet. Welchen Sinn macht es, parallel dazu unter der Erde eine zweite Schienen-Infrastruktur auszubauen? Woran wir arbeiten müssen, sind U-Bahn-würdige Intervalle für die S-Bahn, da ein wesentlicher Bestandteil des Wiener Verkehrsproblems der Pendlerverkehr aus dem Umland ist. Im Rahmen des kommenden Verkehrsdienste-Vertrags, der im nächsten Winter mit den ÖBB ausverhandelt werden muss, wird dies zu diskutieren sein. Wir haben auch schon Gespräche mit Niederösterreich begonnen, denn die Finanzierung muss von Wien und Niederösterreich gemeinsam übernommen werden. Neben dem Ausbau muss auch das Thema Autobesitz in Wien angesprochen werden. Parkplätze im öffentlichen Raum, Car-Sharing-Angebote und Stellplatz-Regulativ sind Stichworte dazu.
Unser Ziel ist es, den motorisierten Individualverkehr um ein Drittel zu reduzieren. Wie kann ich beispielsweise das Fahrrad fördern? Dies muss schon bei der Planung von neuen Siedlungen und Arealen mitbedacht werden. Muss man ein Auto besitzen, nur weil man ab und zu auch eines fahren möchte? Und wie kann ich öffentlichen Raum zurückerobern?
DS: Ein Beispiel aus Madrid: Dort wurde die Haupt-Westausfahrt Richtung Portugal auf eine einspurige Fahrbahn reduziert und alles andere für Fahrräder und Gehsteigverbreiterungen bis hin zu einem großen Park zwischen den beiden Fahrbahnen umgebaut. Ich glaube, wir müssen Verkehrsstraßen rückbauen, um öffentlichen Raum zu gewinnen.
MV: Darum geht es. Wenn jedoch in Wien über Verkehrskonzepte diskutiert wird, kommt sofort das Argument der Parkplätze. Es gibt in Wien sogar eine Bezirks-Förderung zum Rückbau von Parkplätzen an der Oberfläche, im Gegenzug dazu könnten Wohnsammelgaragen entstehen. Diese Förderung wird nur zum Teil in Anspruch genommen. Wir stecken derzeit mitten in einer Debatte, die mit der Neuverteilung nicht nur des öffentlichen Raumes, sondern und ganz besonders der Straße zu tun hat. Es werden an bestimmten Stellen Parkplätze verloren gehen, damit die Straßenbahn fahren kann und die Radwege ausgebaut werden können. Es gehen Parkplätze verloren, damit wir öffentlichen Raum gewinnen, den wir Fußgängern und anderen Nutzungen zur Verfügung stellen wollen. Ein gutes Beispiel ist die Mariahilfer Straße, die als eine verkehrsberuhigte Zone neu gestaltet werden soll. Ein Problem, mit dem wir jedoch konfrontiert sind, ist die Finanzierung und hier komme ich wieder zur Planwertabgabe.
DS: Ein Thema, das immer wieder kommt, ist die Frage der jetzigen Pflichtstellplatz- Regelung im Wohnungsbau, die 1:1 beträgt. Werden diese Garagen auch tatsächlich in vollem Umfang genutzt?
MV: Wesentlich ist, von dieser 1:1-Regelung wegzukommen und in vielen Bereichen sogar in die entgegengesetzte Richtung zu gehen. Vor allem dort, wo eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr vorhanden ist oder wo in naher Zukunft eine gute Dichte an Car-Sharing-Angeboten vorhanden sein wird. Einerseits wird sehr viel Geld in die Hand genommen, um Wohnsammelgaragen entstehen zu lassen, andererseits hat man in der gesamten Umgebung leer stehende, frei finanzierte Garagen, die aufgrund der Stellplatz-Verpflichtung entstanden sind. Ich habe mir anhand der Kontroverse rund um die Geblergasse im 17. Bezirk ausgerechnet, wie lange die Stadt Wien mit der Förderung, die es zurzeit für den Bau von Wohnsammelgaragen gibt, leer stehende Garagenplätze anmieten und zum Preis von monatlich 70 Euro weitervermieten könnte. Ich kam auf 50 Jahre. Die Frage ist, wie man alle diese leer stehenden Garagenplätze besser nutzen kann, um wiederum Autos von der Oberfläche wegzubekommen.
DS: Wie sind die Entwicklungspläne zur U1-Verlängerung nach Rothneusiedl bzw. zur U2-Verlängerung?
MV: Die U1-Verlängerung nach Rothneusiedl hat diesen Sommer begonnen. Wie weit man bauen wird, klärt sich in der nächsten Zeit. Das hängt davon ab, inwieweit die erforderlichen Flächen in Rothneusiedl zu bekommen und dann zu entwickeln sind. Eines ist klar: Wir werden sicher keine U-Bahn bauen, die in die grüne Wiese führt. Mit heutigem Stand fehlen wesentliche Flächen, um hier einen neuen Stadtteil entstehen zu lassen.
Was die U2-Verlängerung betrifft, gibt es mehrere Varianten einer Trassenführung, deshalb gibt es noch keine definitive Entscheidung. Im Rahmen des neuen Masterplans für Verkehr muss in einer Kosten-Nutzen-Rechnung bewertet werden, wie hoch die Kosten für die unterschiedlichen Trassenvarianten sind. Die Entwicklung der entsprechenden Stadtteile bedeutet in den nächsten Jahren mehrere Tausend Menschen mehr in diesem Gebiet. Aber es ist noch nicht klar, ob am Ende jene kritische Masse erreicht werden kann, für die es sich lohnt, dorthin eine U-Bahn zu bauen. Die U2-Verlängerung ist jedenfalls mit technischen Schwierigkeiten verbunden, was zu viel höheren Kosten als ursprünglich angenommen führt.
DS: Ist auch die Verlängerung bis Südbahnhof und Sonnwendviertel fraglich?
MF: Der schwierigste Teil der Verlängerung ist der erste ab dem Karlsplatz. Dieser ist auch mit den größten Kosten verbunden. Wenn diese Schwierigkeit überwunden ist, ist die Frage, wie weit verlängert wird, zweitrangig.
DS: Im Zusammenhang mit der Qualitätssicherung im Bereich Stadtentwicklung und Verkehr sollte auch das Spannungsfeld an den Stadt- und Landesgrenzen angesprochen werden. Es betrifft die Wiener Bürger genauso wie die Bürger der angrenzenden Landgemeinden. Wie können konstruktiv länderübergreifend Stadt und Land, Gemeinden und betroffene Bezirke miteinander die optimalen Lösungen und den richtigen Schlüssel für die Finanzierung finden?
MV: Ich sehe erstmals eine Bereitschaft, über einen gemeinsamen Ausbau der öffentlichen Verkehrsanbindungen zu diskutieren. Wir wollen im Rahmen der vorhandenen Institutionen, das sind im Wesentlichen die Planungsgemeinschaft Ost (PGO) und das Stadt-Umland-Management, ein gemeinsames Konzept für diese Metropolregion in Angriff nehmen. Es gibt zum Beispiel zunehmend die Einsicht, dass das Ansiedeln von Einkaufszentren und verschiedenen Gewerbegebieten just an oder jenseits der Grenze am Ende uns alle mittelfristig mit größeren Problemen konfrontiert. Allein im Korridor Mödling hat sich in den letzten zehn Jahren der motorisierte Individualverkehr verdoppelt. Es gibt auch Überlegungen zu einer Metrobus-Anbindung zwischen Wien und dem Umland. Auch die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung in Wien ist unumgänglich, wenn es darum geht sicherzustellen, dass Pendler das Auto möglichst am Stadtrand abstellen und nicht bis weit in die Stadt hineinfahren. Das bedeutet, Wien und das Umland brauchen eine verbindliche Ebene für Planungsentscheidungen und für die Finanzierung. Es gibt sehr wohl Partner, auch in Niederösterreich, die einen Finanzausgleich innerhalb der Regionen fordern.
DS: Wir haben heute sehr viel Neues erfahren und ich darf mich herzlich dafür bedanken.
MV: Auch ich darf mich für die Einladung bedanken und bin überzeugt, dass der Herbst Sie nicht enttäuschen wird.
[Zusammengefasst von Alexandra Viehhauser]
Hintergrund, So., 2011.12.11
verknüpfte ZeitschriftenHintergrund 52 Architecture Lounge
![]()