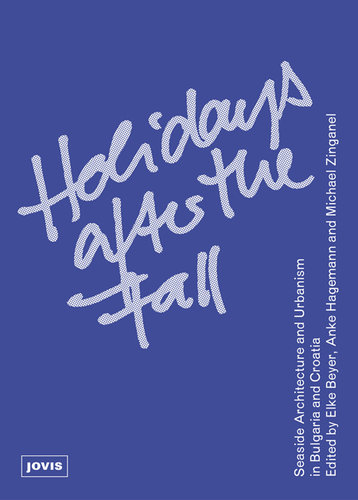Zurück zum Start – Architektur- und Städtebaugeschichte als Wissensgeschichte
Architektur- und Städtebaugeschichte stellen für die Architekturtheoretikerin und Kulturwissenschaftlerin Christa Kamleithner — wie für mich auch — eine...
Architektur- und Städtebaugeschichte stellen für die Architekturtheoretikerin und Kulturwissenschaftlerin Christa Kamleithner — wie für mich auch — eine...
Architektur- und Städtebaugeschichte stellen für die Architekturtheoretikerin und Kulturwissenschaftlerin Christa Kamleithner — wie für mich auch — eine spezifische und hoch spannende Wissensgeschichte dar, die — wenn auch oft stark zeitverzögert und mutiert — reale politische Effekte nach sich zieht und sich auf die Lebensverhältnisse in (und zwischen) den Städten auswirkt. Was in der jeweils eigenen Disziplin ohnehin als bekannt vorausgesetzt und/oder in der eigenen Blase erwünscht, gefürchtet oder verdammt wird, ist dabei weniger interessant, als dass durch nur kleine Überschreitungen des eigenen Felds sowie Erweiterungen hinsichtlich der Methoden und Quellen neue Erkenntnisse oder zumindest andere Lesarten ermöglicht werden: Im Fall des vorliegenden Buchs Ströme und Zonen wurde die penible Beobachtung der Entwicklung der Diskurse um die funktionale Stadt weit über die uns vertraute Zeitspanne in Richtung deren (Vor-)Geschichte ausgedehnt. Und tatsächlich räumt das Buch so mit ein paar von uns gut und gerne geglaubten Selbstmystifikationen der Städtebaugeschichte auf und weist den Innovationsanspruch der Helden der Moderne in ihre historischen Grenzen.
Denn das Konzept der funktionalen Stadt wurde, so Christa Kamleithner, nicht erst von den Architekt:innen der CIAM 1933 während ihrer berühmten Schiffsreise erfunden und 1943 in der Charta von Athen verfestigt. Die Genealogie lässt sich vielmehr bis weit ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Das Buch beginnt daher auch nicht mit dem vierten CIAM-Kongress. Dieser bildet nur den Epilog, um en passant nachzuweisen, dass trotz der pathetischen revolutionären Rhetorik des Manifests wenig davon neu war. Den Prolog bildet hingegen das Kapitel Bilder einer Ausstellung über die Allgemeine Städtebau-Ausstellung in Berlin im Jahr 1910, die den Startschuss für eine breitere Begeisterung für Statistiken darstellen sollte. Hier wurden Stadtentwicklungskonzepte aus aller Welt vorgestellt. Der Kern der Ausstellung war jedoch der Wettbewerb Groß-Berlin und seine großformatigen Pläne zu Nutzungsclustern und Verkehrsnetzen, die von statistischen Karten und Diagrammen begleitet wurden, die auch Le Corbusier, den Autor der Charta von Athen beeindruckt hatten. Der Zusammenhang von statistischer Kartografie und moderner Stadtplanung sei, so die Autorin, in der Forschungsliteratur bislang unterbelichtet geblieben (S. 16).
Die zehn Kern-Kapitel ihres Buchs werden demnach von zwei viel diskutierten bildstarken und wirkmächtigen Ereignissen gerahmt. Dazwischen führt die Argumentationskette aber noch weiter zurück, und zwar bis um 1800. Die aktuell mit Recht so heiß diskutierte Bodenfrage begleitet uns von Beginn an durch das Buch, stellte doch die Befreiung des Bodenmarkts (aus der Kontrolle von Adel und Klerus) über die Grenzen der Städte hinaus eine der Grundforderungen der Liberalen dar ebenso wie die Voraussetzung für die Entwicklung neuer Städtebautheorien und ihrer Umsetzungen.
Es war tatsächlich eine Krankheit, die Cholera, die in den 1830er-Jahren, vor allem in England und Frankreich, die wissenschaftliche Untersuchung des städtischen Raums vorangetrieben und neuartige statistische Karten hervorgebracht hat, die jene Ängste vor Dichte und Armut schürten, die für moderne Stadt- und Planungsvorstellungen bestimmend wurden. Die Hygienebewegung rückte den Missständen vorerst nur mit Karten zu Leibe, die die Krankheiten des »sozialen Körpers« offenlegen sollten (siehe auch ihr Beitrag in dérive No 81). Diese Karten förderten aber, so die Autorin, »ein Denken in Stauungen und Ballungen, Flüssen und Zirkulation und legen für verschiedenste Bereiche ein- und dasselbe Vorgehen nahe: die Drainage, also eine technische Steuerung von Verteilungen.« (S. 84f.) Die folgende Aufschließung der Stadt durch moderne Kanäle, Leitungen und Verkehrsachsen sollte aus ihr dann auch tatsächlich einen zusammenhängenden »Organismus« machen.
Mit einiger Verspätung wurden die Maßnahmenkataloge auch in Deutschland und in Österreich gefordert, nun zusätzlich gestützt durch neue ökonomische Stadtmodelle aus den 1860er-Jahren, die von der Vorstellung eines idealen liberalen Bodenmarkts ausgingen: Dabei hatten liberale Ökonomen wie Faucher in Berlin oder Sax in Wien vor allem die Mittelschicht im Auge, die sie in einer Pionierrolle sahen, um in neue Villensiedlungen oder Cottageviertel im Grüngürtel zu ziehen, wozu allerdings erst die »Schaffung billiger und ausgiebiger Kommunikationsmittel« von Nöten war (S. 104). Wie bei der Entwicklung des Schwemmkanalsystems war London auch hier, beim Eisenbahnbau, Pionier und Vorbild. Und tatsächlich lassen sich das unterschiedliche Wachstum von London, Paris, Berlin und Wien mit den unterschiedlichen Verkehrskonzepten und Routen der Stadtbahnen in Verbindung bringen.
Dass Stadtplanung und Liberalismus heute einvernehmlich als Gegensatzpaar verhandelt werden, ist für das Verständnis ihrer Genealogie wenig hilfreich. Christa Kamleithner ist es daher ein Anliegen, auf die Beharrungstendenzen liberaler Ideen in den Planungstheorien hinzuweisen: Die Zeit, als die Städtebaureform Gestalt annahm — im deutschen Sprachraum um 1870 —, gilt bekanntlich ja als Anfang vom Ende des Liberalismus. Ein Auslöser dafür war der Börsencrash 1873, der ausgerechnet durch einen Spekulationsboom bei Bau- und Eisenbahnprojekten ausgelöst worden war. Auch wenn diese Krise zu einer vehementen Kapitalismuskritik führte (die leider auch mit einem zunehmenden Antisemitismus einherging), blieb für die bürgerlichen Reformer jedoch eine Welt ohne freie Märkte unvorstellbar. Diese Märkte sollten nur insoweit verbessert oder reguliert werden, dass die Verteilungseffekte soweit akzeptabel werden, dass eine drohende soziale Revolution verhindert werden kann. Dass die öffentliche Hand Wohnungen für die Armen baut, wie die noch lange von der politischen Mitentscheidung ausgeschlossenen Sozialdemokrat:innen forderten, war für sie nicht denkbar. Vielmehr sollte der Ausbau des Verkehrs allein die Wohnungsnot lindern, weil er mehr bebaubare Fläche erschließen und so die Konkurrenz am Bodenmarkt erhöhen und daher die Preise senken würde.
Reinhard Baumeisters Handbuch von 1876 kann im deutschen Sprachraum als Auftakt eines Planungsdenkens gelten. Darin legt er den Fokus genau darauf: nämlich mit Infrastrukturen in Bevölkerungsbewegungen zu intervenieren, wie das dann auch der Wettbewerb für einen Generalregulierungsplan für Wien 1892 und der Wettbewerb für Groß-Berlin 1910 machen sollten. Für den letzteren war die Stadt ein »wirtschaftspolitischer, verkehrstechnischer und baukünstlerischer Organismus« (S. 235), seine Teilnehmer arbeiteten bereits mit prognostizierten Bevölkerungsentwicklungen und sahen funktionale Zonierungen für ein Verwaltungs- und Geschäftszentrum, Wohngebiete für unterschiedliche soziale Schichten sowie Erholungs- und Industriegebiete vor.
Sowohl die Citybildung als auch die Verlegung der Industrie an die Peripherie blieben um 1910 allerdings Wunschdenken. Abhängige, schlecht verdienende Kleinstunternehmer:innen bevölkerten London, Paris, Berlin und Wien. Zugleich entwickelte sich in den Hinterhöfen eine avancierte Kleinindustrie, die mit der Elektrifizierung einen Aufschwung erfuhr. Gegenüber all dem versprachen sich die Planer einzig von Großhandel und Großindustrie einen Fortschritt. Und um die ihrer Meinung nach atürlichen Prozesse der Citybildung wie der Randwanderung der Industrie zu unterstützen, und die Ärmsten aus dem Zentrum zu vertreiben, riefen die liberalen Reformer dann aber durchaus nach der Hilfe der öffentlichen Hand. Ganz und gar nicht unterschwellig wurde versucht, im Zentrum nur Tätigkeiten zuzulassen, bei denen die Armen ausgeschlossen bleiben. Und auch die von Frauen betriebene Heimarbeit kam unter Beschuss (S. 241). Diese Planungstheorien beinhalteten auch präzise Bilder einer bürgerlichen Geschlechterordnung, die auf die gesamte Bevölkerung ausgeweitet werden sollte.
Auch die Gartenstadtbewegung ist ohne ein leistungsfähiges Eisenbahnnetz undenkbar: Schon der Erfinder der Gartenstadt, Ebenezer Howard, hatte in seinem Buch von 1898 keine Siedlungsutopie vorgestellt, sondern, das betont die Autorin, die ökonomische Folgerichtigkeit seines Konzepts zu zeigen versucht, das darauf hinauslief, Großstädte in ein vernetztes System von Klein- und Mittelstädten zu überführen. Stellte die Deutsche Gartenstadt-Gesellschaft die Idee der Gartenstadt vorerst ebenso in den Dienst einer Streuung der Industrialisierung, so nahm ab 1900 die These von der Großstadt als »Rassengrab« an Fahrt auf: die vermeintlich »tauglichen« Bevölkerungsgruppen würden durch schwache Geburtenraten gegenüber reproduktionsfreudigeren, aber weniger tauglichen immer mehr in die Minderheit gedrängt. Die Angst vor der Stadt als Ort der Degeneration wurde damit zunehmend rassistisch aufgeladen (S. 245). Insgesamt verhärteten sich Organismus-Vorstellungen mit Bakteriologie, Evolutionstheorie und Eugenik: Der einzelne Organismus wie die Bevölkerung, die sich zum Volkskörper formierte, sahen sich in einen dauernden Kriegszustand versetzt und nahmen festungsartige Züge an. Das traf, so die Autorin, auch auf die städtebaulichen Konzepte nach 1900 zu. Geschlossene Städte mit Satelliten an Eisenbahnverbindungen begannen, die Stadtmodelle zu dominieren.
Die Strukturmodelle in den Städtebauhandbüchern änderten sich auch nach dem Ersten Weltkrieg keineswegs, obwohl sich politische Struktur und Planungspraxis radikal verändert hatten (S. 258): Wohnungsmärkte und private Wohnungswirtschaft waren mit dem Krieg zusammengebrochen, und die Erfahrungen der Kriegswirtschaft und der politische Erfolg der Sozialdemokratie führten zum Ausbau der Planungs- und Verwaltungsapparate. Die Städtebaumodelle abstrahierten inzwischen aber vollends von ihren Produktionsbedingungen und erschienen als politisch neutral. Diese Trennung von Planung und Politik war auch den CIAM-Architekt:innen extrem wichtig, versuchten sie doch identische Stadtplanungskonzepte in völlig gegensätzlichen politischen Regimen — die sogar von unterschiedlichen Eigentumsverhältnissen gekennzeichnet waren — umzusetzen: in der kommunistischen Sowjetunion, im von der Volksfront regierten Frankreich, im faschistischen Italien, in Nazi-Deutschland usw. Es gelang ihnen auch, Planung als eine eigenständige Tätigkeit zu etablieren, die scheinbar universell gültigen Prinzipien folgt. Die Trennung von Arbeiten und Wohnen wurde beispielsweise 1962 als Planungsprinzip in der BRD gesetzlich verankert (S. 317). Die Masse an analytischen Karten, die beim vierten CIAM-Kongress zum Einsatz kamen, suggerierte mit Erfolg wissenschaftliche Objektivität. Den CIAM-Architekt:innen gelang es, durch ihre pathetische Sprache und die Bildmächtigkeit der abstrakten Darstellungstechniken ihrer Bestandsanalysen zu suggerieren, dass die von ihnen vorgeschlagene Funktionstrennung der Stadt — wohnen, arbeiten, sich erholen, sich bewegen —, die über Jahrzehnte durch verschiedene Akteurinnen geformt worden war, eine neue, bahnbrechende Idee wäre.
Christa Kamleithners Ströme und Zonen bietet eine Diskursanalyse par excellence: Zu Diskursen zählt Michel Foucault nicht nur die Zirkulation von Texten, sondern eben auch die von Karten und Diagrammen. Diskurse sind ihm zufolge »Praktiken, die systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen. (…) Wenn über Jahrzehnte auf sie Bezug genommen wird, sind aus ihnen Entitäten geworden, die sich von sichtbaren Dingen kaum unterscheiden und handfeste Konsequenzen haben. So ermöglichte das Denken in statistischen Verteilungen einen Zugriff auf die Stadt, der über alle lokalen Besonderheiten hinwegging, ihre Bevölkerung als bewegliche und formbare Masse begriff, die kanalisierbar schien wie Wasserströme.« (S. 24). Die Entwicklung der Planungstheorien, der Analysewerkzeuge und Praktiken haben — entgegen der Proklamationen der CIAM-Architektinnen — bestehende Tendenzen immer mehr verstärkt und sukzessive die Wunschvorstellungen der Theoretikerinnen und Planerinnen in soziale Realitäten verwandelt: Nachverdichtung des städtischen Raums, höchstmögliche soziale Durchmischung, kurze Wege und ein Mix an Nutzungen waren definitiv unerwünscht.
Christa Kamleithner
Ströme und Zonen.
Eine Genealogie der »funktionalen Stadt«
Bauwelt Fundamente 167 Basel: Birkhäuser 2020
376 Seiten, 29,95 Euro
dérive, Do., 2021.03.25
verknüpfte Zeitschriften
dérive 82 Sampler