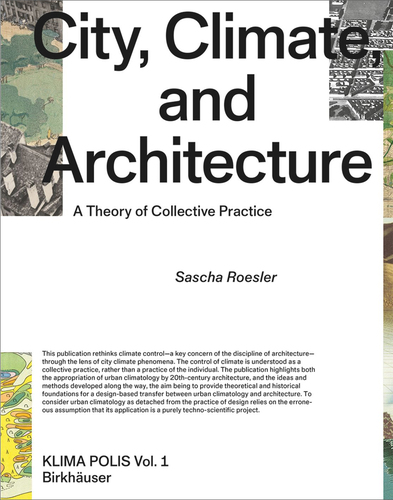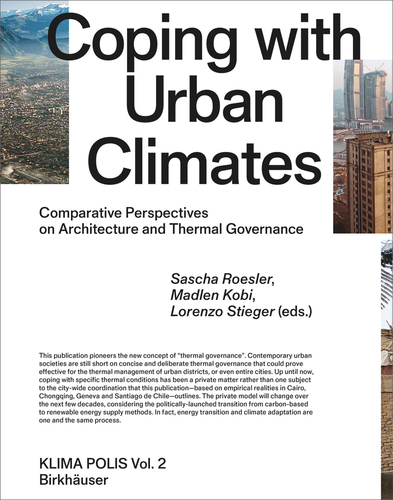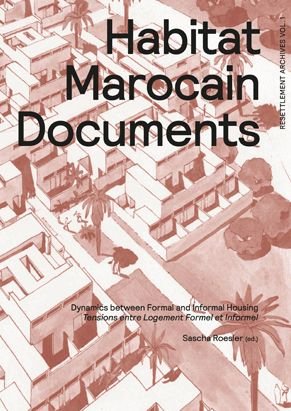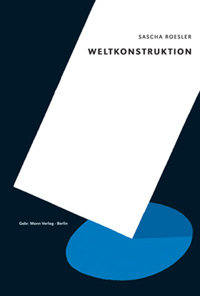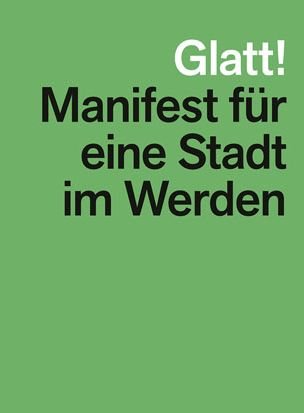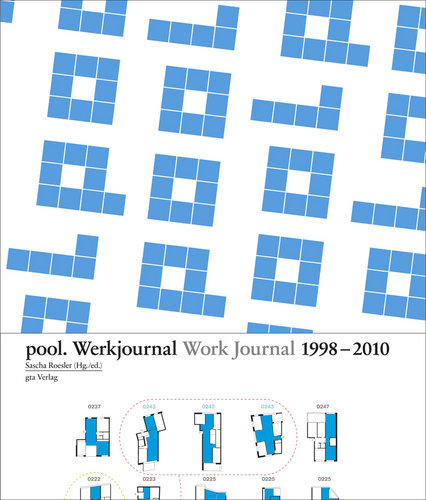Obwohl die Schweiz nicht zu den hochgefährdeten Erdbebenzonen Europas gehört, gibt es immer wieder Erdstösse, die für Menschen und Kulturgüter gefährlich sind. Im Gespräch wird klar, wie in der Vergangenheit mit diesem Risiko umgegangen wurde, weshalb Erdbebensicherheit im Entwurf zur Selbstverständlichkeit gehören sollte und welches die politischen und normativen Hürden sind, die es noch zu überwinden gilt.
Mit Hugo Bachmann und Monika Gisler sprach Architekt Sascha Roesler
Obwohl die Schweiz nicht zu den hochgefährdeten Erdbebenzonen Europas gehört, gibt es immer wieder Erdstösse, die für Menschen und Kulturgüter gefährlich sind. Im Gespräch wird klar, wie in der Vergangenheit mit diesem Risiko umgegangen wurde, weshalb Erdbebensicherheit im Entwurf zur Selbstverständlichkeit gehören sollte und welches die politischen und normativen Hürden sind, die es noch zu überwinden gilt.
Mit Hugo Bachmann und Monika Gisler sprach Architekt Sascha Roesler
Gemäss einer Risikostudie des Bundesamtes für Zivilschutz ist die Erdbebengefahr die bedeutendste Naturgefahr in der Schweiz. Doch ist das Ausmass einer Erdbeben- Katastrophe nicht in hohem Masse menschengemacht? Und wie wurde diese Verantwortung in der Geschichte gedeutet?
MG: Die Katastrophe ist nicht das Beben selbst, sondern was mit den Gebäuden und den Menschen passiert. Somit ist die Bauweise entscheidend dafür, wie katastrophal sich ein Erdbeben auswirkt. Den Menschen trifft also eine gewisse Eigenverantwortung für das Ausmass des Schadens. Das zeigt sich auch in der Geschichte. Lange Zeit wurden Erdbeben nicht naturwissenschaftlich, sondern theologisch erklärt. Man deutete das Beben als Strafe für ein schlechtes oder als Ermahnung für ein besseren Leben.
HB: Seit dem verheerenden Erdbeben von Lissabon 1755 wurde auch die sogenannte Theodizee-Frage gestellt: Warum lässt Gott das zu? Diese Frage taucht bis heute auf. Erdbeben werden so als Strafe Gottes definiert.
MG: Erst im Laufe des 18. Jahrhunderts hat man Erdbeben in zunehmendem Masse auch naturwissenschaftlich erklärt, so dass nun unterschiedliche Deutungsmuster nebeneinander bestehen konnten, naturwissenschaftliche und theologische. Man hat beispielsweise Erdbeben mit dem Wetter zu verknüpfen versucht und wollte dies auch empirisch nachweisen. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts existierte die Theorie der Elektrizität als Ursache von Erdbeben. Und etwa zur selben Zeit sind die ersten Zusammenhänge zwischen Erdbeben und der Entstehung der Erde hergestellt worden. Erst jedoch seit den frühen 1960er-Jahren hat man die heute gültige Theorie der Plattentektonik formuliert. Bis Ende des 19. Jahrhunderts hatte man also keine klare Vorstellung davon, wie Erdbeben entstehen und damit auch keine brauchbare Erdbeben-Prävention.
Frühe bauliche Massnahmen
Seit wann gibt es einen gelehrten Diskurs über sinnvolle bauliche Massnahmen?
MG: Kulturgeschichtlich ist das ein sehr junges Thema. Rousseau hatte nach dem Beben in Lissabon 1755 die schlechte Bauweise der Stadt kritisiert. Solche Hinweise waren jedoch sehr vereinzelt. Und man findet keine baulichen Umsetzungen solcher Warnungen. Für die Schweiz kenne ich bis ins 20. Jahrhundert hinein keine schriftlichen Quellen, die auf eine Erdbeben bedingte Ertüchtigung von Gebäuden hindeuten würden. Insofern unterscheiden sich Erdbeben von anderen Naturkatastrophen. Im Fall von Hochwasser etwa wurden viel früher Überlegungen angestellt, wie man Dämme bauen könnte.
HB: Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Hochwasser relativ häufig auftreten. Eigentliche Schadenserdbeben gibt es bloss etwa alle 100 Jahre. 1946 war das letzte grosse Schadensbeben der Schweiz, im Wallis. Und ganz schwere Erdbeben mit katastrophalen Schäden gibt es in der Schweiz sogar nur etwa alle 500 bis 1000 Jahre. Ein schlimmes Erdbeben verursacht zwar bis zu 100 mal grössere Schäden als ein schlimmes Hochwasser – heute wäre mit rund 100 Milliarden Franken Schäden zu rechnen, wenn in Basel ein grosses Erdbeben stattfinden würde. Die wirklich schlimmen Erdbeben ereignen sich aber in einem so weiten zeitlichen Abstand zueinander, dass sie sich nicht in unserem gesellschaftlichen Bewusstsein verankern. Das ist der Hauptgrund dafür, dass man in der Schweiz bis in jüngster Zeit keine baulichen Massnahmen gegen Erdbeben ergriffen hat. MG: Im Vergleich zu Hochwasserkatastrophen muss man feststellen, dass in der Schweiz die Opferzahlen von Erdbeben immer sehr gering waren. Vom Basler Beben von 1356, immer noch das stärkste Erdbebenereignis der letzten 1000 Jahre, nimmt man an, dass nicht sehr viele Leute gestorben sind.
Gab es denn im Bereich eines alltäglichen Bauens schon früher vorbildhafte Ansätze zu einem erdebensicheren Bauen?
HB: Es gibt kaum überzeugende Anhaltspunkte, dass man Erdbebengefahren systematisch berücksichtigt hätte. In mittelalterlichen Städten beobachte ich immer wieder Eckpfeiler an alten Häusern. Nach dem Erdbeben von Basel hat man die Häuser mit Eckpfeilern gebaut. In Wil, Bischofszell, Zofingen, in den Zähringerstädten im Raum Bern usw. gibt es solche Eckpfeiler. Das ist meine private Ansicht, aber ich sehe keinen Grund, weshalb man solche Eckpfeiler sonst gemacht hätte. Die Eckpfeiler tragen zur Stabilität des Mauerwerks eines Gebäudes bei. Das waren vielleicht erste bauliche Massnahmen, um Gebäude in der Schweiz gegen Erdbeben sicherer zu machen.
Forschung zum erdbebensicheren Bauen
Welche historische Rolle spielt der Stahlbau für ein erdbebensichereres Bauen? Und seit wann wird dieser Zusammenhang systematisch erforscht?
HB: Für die Forschungsgeschichte bedeutsam war das Erdbeben von San Francisco 1906. Unter dem Eindruck dieses Ereignisses hat man angefangen, sich darüber Gedanken zu machen, wie man Gebäude erdbebensicherer ausbilden könnte; ebenso nach dem berühmten Tokio Erdbeben 1923 mit 150 000 Toten und, wie in San Francisco auch, mit tagelangen Bränden. In der Folge hat man insbesondere dem Stahlbau anstelle von Mauerwerk eine besondere Leistungsfähigkeit im Erdbebenfall zugeschrieben – allerdings ohne dass man damals verstanden hätte, wie sich ein Erdbeben auf ein Bauwerk auswirkt.
Was mit einem Gebäude während eines Erdbebens passiert, ist sehr komplex. Einigermassen verstanden wird das erst in den letzten drei Jahrzehnten. Das Erdbeben-Ingenieurwesen hat sich in einem wissenschaftlichen Sinn erst in den 1960er Jahren etabliert, primär im Zusammenhang mit dem Bau kalifornischer Atomkraftwerke. Aus diesem Umfeld sind am Anfang die stärksten wissenschaftlichen Impulse gekommen. Auch die ersten Bauwerke der Schweiz, für die eine so genannte Erdbebenbemessung gemacht wurde, waren unsere AKW; natürlich waren diese Bemessungen aus heutiger Sicht bloss rudimentär. Die Idee, dass man ein Gebäude für den Erdbebenfall möglichst sicher bauen sollte, habe auch ich das erste Mal in den 1960er Jahren gehört, als man unsere ersten AKW geplant hat. Die Atomindustrie hat entsprechend auch die ersten Forschungsgelder zur Verfügung gestellt, um an den Hochschulen erste kleinere Forschungsprojekte durchzuführen. Mit der Zeit wurde dieses Wissen auch auf andere Gebäudetypologien übertragen. Die ersten modernen Erdbeben- Normen auf wissenschaftlicher Basis sind in den 1970er und 80er Jahren in den USA und in Neuseeland erarbeitet worden, gleichsam mit einem wachsenden Bewusstsein für das Risiko und die Schwächen der Technokratie. Eine neue Methode: Duktilität und Kapazitätsbemessung Forschungsgeschichtlich kann man also sagen, dass die Baudynamik erst ungefähr ein halbes Jahrhundert nach den Erkenntnissen in der Seismologie folgte. HB: Ja. Die entscheidende Methode, die das ganze Erdbebeningenieurwesen auf den Kopf gestellt hat, wurde in den 1980er Jahren in Neuseeland entwickelt: das Capacity-Design; auf Deutsch: Kapazitätsbemessung. Entdeckt und entwickelt wurde die Methode insbesondere von Professor Thomas Paulay, für den ich damals arbeitete. Die Methode hat zur sogenannt duktilen Bauweise geführt. Ein Bauwerk ist dann duktil konstruiert, wenn es sich unter Erdbebeneinwirkung so stark verformen kann, dass es dabei zwar lokal bleibende Verformungen erfährt, aber ohne einzustürzen. Duktilität meint plastische Verformbarkeit des Tragwerks, was unter Umständen bleibende Verformungen mit starken lokalen Schäden miteinschliesst; auf keinen Fall jedoch zu einem Zusammenbruch des Tragwerks führt. Heute verwendet man überall auf der Welt diese duktile Bauweise im Gegensatz zu einer nicht-erdbebengerechten Bauweise.
Welche Bedeutung kommt den Architekten für die Konzeption duktiler Gebäude zu?
HB: Die Architekten verfügen über die wichtigsten Schalthebel. Im Ablauf der Planung ist das Entscheidende der erdbebengerechte Entwurf. Von der ersten Skizze an sollte der Aspekt der Erdbebensicherheit von Architekten berücksichtigt werden. Und um das zu machen, muss man keine einzige Berechnung durchführen; man muss bloss einige wesentliche Grundsätze berücksichtigen.[1] Am besten geschieht dies durch eine frühzeitige Zusammenarbeit zwischen Architekt und Ingenieur beim Entwurf des Gebäudes. Mit wenigen gescheiten Massnahmen kann man die Erdbebensicherheit von Gebäuden enorm verbessern. Wenn man es jedoch nicht macht, dann kann der Ingenieur noch so viel rechnen; das Gebäude bleibt ein schlechter erdbebenbezogener Entwurf. Der Ingenieur berücksichtigt mit der Berechnung, der Bemessung und der konstruktiven Durchbildung des Tragwerks und der nicht-tragenden Bauteile wie Zwischenwände und Fassadenelemente zwar die Norm, aber die Norm sagt wenig zu den grundsätzlichen Entwurfsprinzipien.
Erdbeben-Normen in der Schweiz
Ob eine Gesellschaft bauliche Massnahmen gegen Erdbebengefahren ergreift, ist letztlich abhängig davon, wie sie die Gefahren einschätzt. Sie, Herr Bachmann, sprechen mit Blick auf den öffentlichen Erdbebendiskurs der Schweiz von den «vergessenen Erdbeben». Moderne Erdbebennormen sind erst seit 1989 in Kraft. Haben wir in der Schweiz ein Wahrnehmungs- und Überlieferungsproblem betreffend der real existierenden Erdbebengefahren; oder sind wir bloss europäischer Durchschnitt?
MG: In der Schweiz sind die Erdbeben-Normen noch ein bisschen jünger als beispielsweise in Italien; aber auch dort ist die Normgebung relativ jung, aus den 1970er Jahren. Wenn man sich vor Augen führt, dass es dort schon immer schwere Erdbeben gegeben hat, mutet das besonders erstaunlich an. Wenn wir heute davon reden, dass man Erdbebengefahren ernst nehmen soll, dann hat das mit Berechnungen zu tun, was passieren könnte, wenn es wieder ein schweres Erdbeben gibt. Überlegungen zur Erdbebensicherheit muten sehr theoretisch an und müssen entsprechend stark institutionell forciert werden: mit Normen, mit Gesetzgebungen. Ansonsten hat man sozusagen kaum einen Grund, sich mit Erdbeben zu beschäftigen. Es geht darum, mittels Normen die Wahrnehmung von Erdbeben zu institutionalisieren.
HB: Es ist schwierig, das vorhandene komplexe Wissen in einfache Regeln umzusetzen, die man beim Planen und Bauen brauchen kann. Zudem hat man bloss langsam verstanden, was ein Erdbeben mit einem Gebäude macht. In der SIA-Norm von 1970 hatte man nur einen kurzen Abschnitt zur Erdbebensicherheit drin.[2] Da war noch kaum von Schwingungen die Rede. Vor dem Hintergrund der genannten internationalen Entwicklungen habe ich 1980 vom SIA den Auftrag erhalten, als Vorsitzender einer entsprechenden Kommission für die Schweiz eine eigentliche Erdbeben-Norm auszuarbeiten. 1989 ist diese erste moderne Erdbeben-Norm der Schweiz in Kraft getreten. Wobei man sagen muss, dass auch die jüngste Norm eine blosse Empfehlung darstellt.
SIA Normen haben grundsätzlich die Rechtskraft von Vereinsstatuten. Die Anwendung der Norm unterliegt dem Privatrecht; entscheidend ist, was in den Bauverträgen steht: «Die SIA-Normen sind einzuhalten». Da entstehen natürlich Interpretationsspielräume. Und weil Erdbeben nicht im öffentlichen Bewusstsein sind, wird sogar heute noch nicht-erdbebengerecht gebaut. Heute weiss man sehr gut, wie man Gebäude duktil gestalten kann. Das ist in die heutigen Normen eingeflossen. Auf einem anderen Blatt steht, ob die Normen tatsächlich angewendet werden. Bis jetzt ist die Anwendung der SIA-Erdbeben-Normen für private Bauten nicht gesamtschweizerisch verbindlich vorgeschrieben. Nur die Kantone Wallis und Basel-Stadt haben sie seit einigen Jahren vorgeschrieben.
Wo müsste man ansetzen, um den Normen gesamtschweizerisch mehr Geltung und Nachachtung zu verschaffen?
HB: Das Bauwesen ist in der Schweiz rechtlich Sache der Kantone. Der Bund hat keine Verfassungskompetenz im Erdbebeningenieurwesen – im Gegensatz zum Hochwasser. Man hat zwar versucht, das zu ändern – man wollte einen neuen Bundesverfassungsartikel zu Naturgefahren, der auch die heute verstreuten gesetzlichen Bestimmungen zu Hochwasser, Lawinen etc. zusammenfasst – blieb jedoch ohne Erfolg. Viele Kantone haben bis heute bezüglich der privaten Bauten noch nichts unternommen, andere sind aktiv geworden. Etwa die Hälfte aller Kantone bauen unterdessen ihre eigenen, also öffentlichen Gebäude nach den SIA-Normen. Und viele Kantone haben angefangen, ihre eigenen Bauten auf Erdbebensicherheit zu überprüfen. Der Bund setzt jetzt ebenfalls bei allen seinen eigenen Bauten – Hochschulen, Verwaltungsgebäuden etc. – die SIA Normen durch. Insgesamt machen die öffentlichen Bauten immerhin ein paar Prozent aus, ca. fünf bis sechs Prozent. Der grosse Teil jedoch, etwa 90 Prozent, sind private Bauten. Dass es Auflagen bei Baubewilligungen und entsprechende Kontrollen gibt, ist bloss in Basel und im Wallis durchgesetzt. Andere Kantone, z.B. Fribourg, Waadt, Nidwalden, nähern sich momentan Basel und Wallis an. Aber in jenen Kantonen, die die grösste Bausubstanz und somit auch das grösste Risiko aufweisen – im Mittelland – sind die privaten Bauten immer noch, um es salopp zu sagen, vogelfrei. Da macht niemand Auflagen und Kontrollen, wenn der Bauherr, der Architekt oder der Ingenieur das nicht durchsetzt.
Ertüchtigung bestehender Bauten
Fürchten viele Bauherren die Kosten für entsprechende Massnahmen der Ertüchtigung bei bestehenden Bauten?
MG: Die einzige Massnahme, um sich vor den Folgen von Erdbeben zu schützen, ist das erdbebensichere Bauen und Ertüchtigen bestehender Bauten. Eine kürzlich erstellte Studie zeigt aber, dass es sehr teuer ist, bestehende Gebäude, und seien sie auch kulturell wertvoll, zu ertüchtigen. Am sinnvollsten wäre dies also anlässlich einer sowieso anstehenden Sanierung.
HB: Von Neubauten wissen wir, dass erdbebensicheres Bauen fast nichts zusätzlich kostet, wenn man es richtig macht. Der Aufwand liegt zwischen null und einem Prozent der Baukosten. Darum ist es unverantwortlich, wenn man es nicht macht. Mit der 2004 eingeführten SIA Richtlinie 2018 gibt es ausserdem ein ganz hervorragendes Verfahren, mittels dessen man mit ökonomischen Kriterien – und auch unter Einbezug von kulturellen und rechtlichen Wertmassstäben – bestehende Gebäude untersuchen kann. Mittels dieses Verfahrens kann man klar sagen, wo es verhältnismässig ist, zu ertüchtigen und wo nicht. Das hängt von den Ertüchtigungskosten ab, aber es hängt auch von der sogenannten Personen-Belegungszahl ab. Das Hauptziel des Ingenieur-Erdbebenwesen ist immer noch, Tote zu verhindern; oder grössere Umweltkatastrophen, wenn man an die Basler Chemie denkt.
Welche Erdbebenstärken halten denn vor 1989 gebaute Gebäude aus?
HB: 85 bis 90 Prozent des Gebäudebestandes der Schweiz hat nie eine Erdbebenbemessung erfahren. Diese Gebäude weisen häufig eine ungenügende Erdbebensicherheit auf. Man kann jedoch keine generelle Aussage machen. Jedes Gebäude ist ein Individuum, ganz besonders in der Schweiz. Wenn man Erdbebengefahren beim Entwurf, bei der Bemessung und bei der Konstruktion nicht berücksichtigt, dann resultieren Gebäude, die zufälligerweise sehr erdbebensicher sein können und solche, die bereits bei einem schwachen Erdbeben in sich zusammenfallen. Es kann von kleinen Veränderungen abhängen, ob die Erdbebensicherheit besser oder schlechter wird; und man kann deshalb auch nicht von einer spezifischen Erdbebenstärke ausgehen.
Erdbebenertüchtigung ist also ein grosses Thema in der Schweiz. Mit welchen Prioritäten sollte man hier vorgehen?
HB: Ich gehe von 200 bis 300 Gebäuden aus, die bis heute in der Schweiz auf Erdbeben ertüchtigt wurden und die jetzt eine einigermassen genügende Erdbebensicherheit aufweisen. Der Bund hat auch bei seinen eigenen, bestehenden Gebäuden eine systematische Überprüfung bezüglich Erdbebentüchtigkeit eingeleitet. Bei rund der Hälfte der Bundesbauten muss bei der anstehenden Sanierung auch die Erdbebensicherheit verbessert werden. Einige ganz schlimme Fälle hat man unterdessen bereits ertüchtigt, zum Beispiel 1994 das Auditoriumsgebäude der ETH Zürich auf dem Hönggerberg. Der Kanton Zürich hat alle seine Schulhäuser und Spitäler überprüft. Einige, wie das Spital Winterthur, sind unterdessen ertüchtigt worden.
Zum Schluss die Frage: Wie schätzen Sie die Potentiale von Stahl für ein zukünftiges erdbebensicheres Bauen in der Schweiz ein?
HB: Erdbebensicheres Bauen ist grundsätzlich nicht von der Bauweise abhängig. Bei der Ertüchtigung von bestehenden Gebäuden hat der Stahl jedoch bestimmt eine wichtige Rolle zu spielen. Stahlelemente sind konstruktiv flexibel, man kann sie einfach in die gewünschte Form bringen und man kann sie einfach transportieren. Deshalb ist Stahl bei der Ertüchtigung, wenn es um Verstärkungen geht, ein besonders praktischer Baustoff.
Anmerkungen:
[01] Hugo Bachmann: Erdbebengerechter Entwurf von Hochbauten – Grundsätze für Ingenieure, Architekten, Bauherren und Behörden, Richtlinien des BWG, Bern 2002.
[02] «Die Tragwerke sollen den Beanspruchungen durch Erdbeben widerstehen. Die Intensitätsklasse VII nach der Rossi-Forel-Skala ist für das ganze Land gültig. An stärker gefährdeten Orten kann die zuständige Behörde die Intensitätsklasse VIII vorschreiben. […] Die Tragwerke sind für eine horizontale Beschleunigung b=g/50 für die Intensitätsklasse VII und b=g/20 für die Intensitätsklasse VIII zu berechnen (g=Erdbeschleunigung).»
[Zu den Interviewpartnern: Hugo Bachmann ist der Doyen des schweizerischen Erdbebeningenieurwesens. Er hat in den 1970er Jahren die internationale Forschung in die Schweiz gebracht und als damaliger Professor für Baudynamik und Erdbebeningenieurwesen an der ETH Zürich etabliert.
Die Wissenschaftshistorikerin Monika Gisler ist eine profilierte Kennerin der Erdbebengeschichte der Schweiz, die in ihrer Dissertation die Anfänge einer naturwissenschaftlichen Beschreibung von Erdbeben beschreibt.
Sascha Roesler ist Architekt und Lehrbeauftragter an der ETH Zürich im Wahlfach «Einführung in die ethnografische Forschung der modernen Architektur».]
Steeldoc, Di., 2011.12.20
verknüpfte Zeitschriftensteeldoc 2011/03+04 Erdbebensicherheit im Stahlbau
![]()