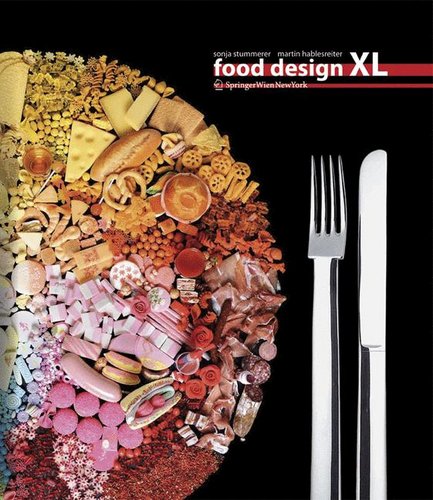Kalorienherz der Stadt
Die Stadt besteht nicht aus Architektur allein. Ohne eine ausreichende Kalorienversorgung sind Städte und Urbanität nicht denkbar. Das Essen prägt wesentlich die Stadtgestalt – mit Bauten für die Aufbereitung und Verteilung der Nahrung, vor allem aber, weil das Essen immer und überall als Kultur verstanden und entsprechend architektonisch inszeniert, gestaltet und überhöht wurde. Ein historischer Abriss zur Beziehung zwischen Essen, Kultur und Stadt.
Die Stadt besteht nicht aus Architektur allein. Ohne eine ausreichende Kalorienversorgung sind Städte und Urbanität nicht denkbar. Das Essen prägt wesentlich die Stadtgestalt – mit Bauten für die Aufbereitung und Verteilung der Nahrung, vor allem aber, weil das Essen immer und überall als Kultur verstanden und entsprechend architektonisch inszeniert, gestaltet und überhöht wurde. Ein historischer Abriss zur Beziehung zwischen Essen, Kultur und Stadt.
Der kreative Umgang mit Essbarem ist wahrscheinlich ebenso alt wie der Drang des Menschen, Kunst zu schaffen. Allerdings wird im Gegensatz zum Kunstwerk die Nahrung aufgegessen und taugt nicht als bleibendes Zeugnis der Menschheitsgeschichte (vgl. Bild 2). Dennoch hat der gestalterische Umgang mit lebenserhaltenden Kalorien die Entwicklung der Menschheit massiv beeinflusst. Sowohl kulturelle Faktoren als auch pragmatische Denkweisen bei der Nahrungsgestaltung spielten und spielen eine entscheidende Rolle bei der Evolution. Der Paläoanthropologe Richard Leakey schrieb dazu: «Zwar enthielt die Kost der Hominiden mehr Fleisch als die ihrer nichthominiden Verwandten, (…) aber die entscheidende Abweichung war die ganz neue Verhaltensweise, Nahrung zu suchen, um sie erst später zu verzehren, sowie der Verzehr in der Gruppe. Die unmittelbare Konsequenz einer solchen Ordnung dürfte gewesen sein, dass die bereits unter den höheren Primaten wohlentwickelten sozialen Wechselbeziehungen noch weiter verstärkt wurden.»[2] Die Ernährung wird vom Menschen als kultureller Akt begriffen, der Hierarchien festlegt, den Jahresablauf strukturiert und Gemeinschaften eine Identität verschafft. Der Schritt von der individuellen «Hand in den Mund» zum zivilisierten Erzeugen und Aufteilen war eine bahnbrechende kulturelle Leistung: Erst das Wissen und die Fähigkeit, Nahrung zu produzieren, zu lagern, zu transportieren und zu verteilen, führte in der neolithischen Revolution zum Sesshaftwerden der Menschen, zum Bau fester Gebäude (Speicher), zur Entwicklung grösserer Gemeinschaften und letztlich zur Entstehung von Städten.
Die Kultur der Ernährung als urbaner Faktor
Die Formen und Arten der Ernährung definieren seit je den kulturellen Zusammenhalt urbanen Lebens. Bis heute werden beispielsweise zu bestimmten Anlässen Feste mit speziellen Speisen gefeiert. Bis heute entnehmen Gemeinschaften einen Teil ihrer Identität ihren Nahrungsvorlieben und grenzen sich damit bewusst von anderen Kulturen ab. Dazu zählen religiöse Tabus und Vorschriften genauso wie der Ekel gegenüber fremden Ernährungsformen.
Damit gleicht die Art der Ernährung der metaphorischen Bedeutung von Architektur, ist doch die gebaute Stadt ein kultureller Ausdruck des Zusammenlebens. Auch die formale Sprache einer Stadt und ihrer Gebäude vermittelt Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Sowohl das architektonische Erscheinungsbild als auch die rituelle Auseinandersetzung mit dem Stadtraum, etwa in Form von Festen oder Prozessionen, verhelfen der urbanen Gemeinschaft zu einer spezifischen Identität und einer kulturellen Aufarbeitung der eigenen Geschichte. Hierarchie und soziale Ordnung werden mit Hilfe von Architektur und Stadtplanung immer wieder manifestiert.
Kirchen und Kathedralen gehören zu den bedeutsamsten Bauten Europas und sind ein essenzieller Bestandteil städtischer Identität. Sie markieren die städtischen Zentren und erfüllen – aus kulturanthropologischer Sicht – die Funktion eines «rituellen Restaurants»: Das von Athenaios angesprochene Menschenopfer (vgl. Kasten) findet noch immer symbolisch in Form der christlichen Liturgie statt. Die Teilnehmer von Messen teilen und verspeisen gemeinsam den Leib ihres Religionsgründers und trinken sein Blut. Die Kirchenarchitektur, die einen für die Elemente der Liturgie zweckdienlichen Raum schafft und diese gleichzeitig inszeniert und überhöht, ist das Resultat einer kultischen Handlung, die direkt mit der gemeinsamen Aufnahme von Nahrung zusammenhängt.
Doch selbst im mittlerweile atheistisch geprägten kapitalistischen Europa treten identitätsstiftende Architektur und Nahrungsgestaltung in trauter Gemeinsamkeit auf den Plan. Nicht allein die Gesellschaften, sondern ganze Städte definieren sich über die Nahrung, wie etwa die sogenannten «Spezialitätenküchen» zeigen. Speziell gestaltete Esswaren wie das Wiener Schnitzel oder Zürcher Geschnetzeltes sind vergleichbar mit Wappentieren oder den gebauten Wahrzeichen der Städte. Auch das jeweilige Sortiment an Essbarem, an Zutaten, Gerichten und Geschmäckern gehört zum Aufputz städtischer Gesellschaften, wie Kathedralen, Gräber und andere Architekturen. Davon abgesehen ist es guter urbaner Ton, mit einer Überfülle an Esswaren und deren Gestaltungsmöglichkeiten zu protzen. Während Brüssel, Turin oder Zürich berühmt sind für ihre Schokoladenvariationen, sind in Wien die «disneyeske» Darbietung von Nahrung auf dem Naschmarkt oder das Schaufenster des Hofzuckerbäckers Demel, wo in kurios-dekadenter Gestaltungswut alle nur erdenklichen Formen aus Zuckerwerk nachgestellt werden, bedeutende Delikatessenattraktionen. Gemeinschaften grenzen sich durch Vorlieben und Abneigungen bei der Aufnahme von Nahrung ab. Dieser kulturelle Faktor definiert auch einen entscheidenden Teil pragmatischer, urbaner Infrastruktur: So verlangt etwa das hinduistisch geprägte Chennai im Süden Indiens nach perfekter Distribution verschiedenster Gemüse und vegetarischer Gerichte, während das Kalorienherz Tokios der weltgrösste Fischmarkt in Tsukiji ist und multiethnische Städte wie London oder New York möglichst grosse Nahrungsvielfalt bieten müssen. Die logistischen Anforderungen an die Infrastruktur dieser Metropolen sind enorm in Anbetracht des Bedarfs an biologischer, koscherer, geschächteter oder vegetarischer Nahrung. Das Essen muss zu städtischen Verteilerposten geliefert, gelagert, gekühlt, verteilt, zubereitet und endlich in entsprechender Form und passendem Rahmen verzehrt werden. Erst das gezielte Zusammenspiel von Architektur und Nahrungsangebot in gestalteten Zonen vermittelt die Identität einer Stadt. Dabei sind sowohl Versorgung (Märkte, Kleinhandel, Supermarkt) als auch Konsumation (Wohnung, Restaurant, Take-away) essenzieller Bestandteil der räumlichen Struktur und des gesellschaftlichen Wertekodex. So sind heute die Versorgungszonen im städtischen Gefüge – ursprünglich übel riechende Areale voller Logistik, Schweiss und Blut – viel besuchte Touristenattraktionen.
Städtische Versorgung in der Antike
Die Gründungen der ersten nichtbäuerlichen Gesellschaften in Babylon oder Theben waren erst möglich, als man die Logistik der Versorgung im Griff hatte. Ehe an die Errichtung architektonischer Wunder in Mesopotamien und Ägypten gedacht werden konnte, musste die organisierte, «industrialisierte» Herstellung von Brot und Bier zur Versorgung einer grossen Zahl von Bauarbeitern und Stadtbewohnern gelöst sein.
Später entfaltete sich auch die Macht Roms und Konstantinopels unter anderem dank ihrer perfekten Versorgung. Im alten Rom waren die Stadtverwaltung und unzählige «Take-away»- Restaurants für die Ernährung der Bevölkerung verantwortlich, da nur wenige, sehr reiche Haushalte überhaupt über eigene Küchen verfügten. Die Auswirkungen auf das damalige Stadtbild und die urbane Struktur sind leider noch unzureichend erforscht. Kulturhistorisch werden heute die «Circenses» in Form der Kolosseumsruine als Denkmal verehrt, doch ohne «Panem» wäre Rom in sozialem Unfrieden untergegangen. Zweitausend Jahre vor der Erfindung von Kühlschrank, Supermarkt und Lastwagen waren die Römer in der Lage, ihre Millionenstadt und eine schlagkräftige Armee ausreichend zu ernähren. Während der Frühphase des Römischen Reichs belieferte Sizilien die Hauptstadt mit lebensnotwendigem Korn, bis Ägypten erobert und zur Kornkammer des Reichs wurde. Riesige Mengen an Weizen wurden nach Ostia verschifft, dort in Lagerhäusern gelagert, in zentralen Herstellungsbetrieben zu Brot verarbeitet, das gratis an die Bevölkerung verteilt wurde. Erst die Unterbrechung der «Lebensader» Ostia–Rom ermöglichte den Germanen die Eroberung der Ewigen Stadt.
Essen im Mittelalter
Auf den Untergang des Römischen Reichs folgte ein langer Dämmerschlaf der europäischen Städte. Vergleichsweise kleine, stark befestigte Orte dominierten für Jahrhunderte das urbane Erscheinungsbild des Kontinents, und sie wurden auch anders versorgt als die antiken Vorgänger. Im ausgehenden Mittelalter regten sich ausserdem erste Formen des Kapitalismus, und daraus resultierten soziale Strukturierungen des Stadtraums: Die Lebensmittel wurden von den Bauern der Umgebung auf sogenannten Wochenmärkten angeboten, die nach ihrem Angebot getrennt waren. Die Segregation in Fleisch-, Gemüse-, Wildbretoder Fischmärkte definierte das Erscheinungs- und Geruchsbild städtischer Zonen und legte damit auch Hierarchien fest. So ist es beispielsweise kein Zufall, dass das westwindexponierte Wien seine fleischverarbeitenden Betriebe im äussersten Osten der Stadt ansiedelte und sich ein bis heute existierendes soziales West-Ost-Gefälle ausbildete, da sich wohlhabende Familien nicht in der Nähe «bäuerlichen Pöbels» oder «riechender Fleischergesellen» niederliessen. Im Unterschied zur Antike wurde im Mittelalter zu Hause gegessen. Die mittelalterliche Lebensgemeinschaft, bestehend aus Familie, Gesellen und Dienstboten, hatte den Ort ihres Zusammenhalts am gemeinsamen Esstisch, die Aufgabe der Verköstigung oblag der Hausfrau oder den Mägden. Erst die industrielle Revolution erschütterte dieses System aus kleinen Versorgungsgemeinschaften.
Industrielle Revolution
Das drastische Wachstum der Städte, der schnelle Zuzug tausender Industriearbeiter und die Notwendigkeit, zur Sicherung des Überlebens alle Familienmitglieder in die Fabrik zu schicken, provozierten neuartige Formen der Ernährung. Eine Arbeiterfamilie konnte sich wegen der extrem niedrigen Löhne die kochende Frau am Herd schlichtweg nicht leisten. Kantinen existierten zunächst kaum und boten kaum ausreichend Nahrung an. Auf diese Situation reagierten erfindungsreiche und geschäftstüchtige Männer wie Justus von Liebig, Julius Maggi und Henry Nestlé. Liebig kreierte den Fleischextrakt, eine stärkende Nahrung für die Massen. Maggi erfand gemeinsam mit dem Arzt Fridolin Schuler Methoden zur kostengünstigen, industriellen Herstellung nahrhafter Hülsenfruchtgerichte für Fabrikarbeiter und prägte den Spruch: «Wer schneller arbeitet, muss auch schneller essen.» Henry Nestlé nutzte Liebigs Analyse der Muttermilch und entwickelte daraus unter dem Namen «Henri Nestlés Kindermehl» das Milchpulver. Diese drei Produkte stehen exemplarisch für die radikale Industrialisierung der Nahrungsmittelversorgung. In und um Chicago entstanden zu dieser Zeit riesige, nach industriellen Gesichtspunkten funktionierende Schlachthöfe, die den Fleischbedarf der US-Metropolen decken konnten. Dort, und nicht in Henry Fords Autofabrik, haben die ersten Fliessbänder ihre Arbeit aufgenommen.
Nestlé und seine Kollegen ermöglichten die Versorgung der arbeitenden Massen und erreichten damit wiederum die Vergrösserung von Industrie und Metropole. Billigst hergestellte Nahrung, die obendrein kaum Kochaufwand erforderte, und effiziente Kalorienproduktion sicherten das wirtschaftliche und das urbane Wachstum. Notwendig war auch die Entwicklung von Gerichten, die in die Fabrik mitgebracht und dort einfach verzehrt werden konnten. Die heutigen Snacks und Fertiggerichte sind eine Spätfolge der Ernährungssituation in der frühen Industriegesellschaft. Fastfood ist deshalb in früh und stark industrialisierten Ländern wie England oder Deutschland tiefer verwurzelt als in Ländern wie Österreich und der Schweiz, wo ländliche und industrielle Lebensformen länger nebeneinander oder in Mischformen existierten und deshalb lokale Kochtraditionen stärker erhalten bleiben konnten.
Arbeiter und Angestellte wohnten nicht mehr bei ihren Arbeitgebern, sondern in der eigenen Wohnung. Der Trend zum Kleinfamilienhaushalt setzte sich im 20. Jahrhundert fort und prägte die weitere städtebauliche Entwicklung und die Ausgestaltung der Ernährungskultur. Die Erfindung des Kühlschranks erlaubte es, nicht mehr täglich einkaufen zu müssen. Da damit eine direkte Nähe zu Nahrungsquellen wie Märkten oder Läden nicht mehr entscheidend war, wuchsen die Distanzen zwischen Versorgern und Haushalten. So erlaubte der Kühlschrank die räumliche Ausbreitung der Städte. Der Kühlschrank, neue Konservier- und Lagermethoden, die Entwicklung des Autos und schliesslich die Einführung des Supermarktes als umfassender Nahversorger für motorisierte Kunden mündeten in der Ausbildung riesiger, suburbaner Ansammlungen von Einfamilienhäusern. Schlossen sich einst Menschen zu engen städtischen Räumen zusammen, um mit kurzen Wegen die Effizienz zu steigern, so erlaubte nun modernes Food Design eine distanzierte Behausungsform – eine «antidichte » Stadt.
Was bringt die Zukunft?
Trotz all diesen Zusammenhängen scheint sich die westliche Gesellschaft kaum für die Versorgung mit Nahrung zu interessieren. Architekten reden zwar gern übers Kochen und lieben schicke Restaurants, planen aber immer noch häufig Küchen wie in den 1950er- Jahren und schreiben bei städtebaulichen Planungen lediglich das Stichwort «Nahversorger » in den bunten Plan. Beinahe unbemerkt beeinflusst unterdessen der Lebensmittelhandel als Verteiler von Food Design Alltag und Lebensstil. Kaum wahrgenommen arbeiten Entwicklungsabteilungen von Nahrungsmittelkonzernen an perfekt angepassten Essensformen für alle nur denkbaren Lebenssituationen. Möglicherweise werden in nicht allzu ferner Zukunft Lebensmittel in Tanks an den Stadträndern gezüchtet. Schon heute spricht die Industrie von «taylor made food», von Produkten etwa, deren Bestandteile auf Wunsch des Konsumenten im Supermarkt maschinell gemixt werden, nach dem Motto: «Ich hätte gerne ein Joghurt mit 1.5 % Fett, 25 Erdbeerstückchen, 5 Mandeln, 1 Gramm Vanille und Crèmigkeitsfaktor 5.» Parallel dazu entwickelt sich das Internetshopping.
Einige der erwähnten Entwicklungen gehen sicher weiter, doch gibt es auch Gegentrends: Die fortschreitende Industrialisierung der Produktion (mit hors-sol, also bodenunabhängig produzierter Nahrung und Functional Food) wird von einem neuen Interesse für biologischen Anbau und traditionelle Sorten begleitet; der Globalisierung der Nahrungsmittelversorgung steht ein neues Interesse an lokalen Küchentraditionen gegenüber. Auch die Individualisierung geht weiter, doch die steigende Zahl Einpersonenhaushalte in unseren Städten – diese Prognose darf man wohl mit einiger Sicherheit wagen – wird die soziale Tradition einer urbanen Gastrokultur nicht gefährden, eher im Gegenteil. Was immer sich durchsetzen wird: Jede Situation, in der gegessen wird, ist direkt oder indirekt mit Architektur, Städtebau und Produktdesign verbunden. Es ist die Aufgabe der Architekturschaffenden, Ausdrucksformen für die Versorgung, Herstellung und den Verzehr von Nahrung zu gestalten.
Deipnosophistai - Das Gelehrtenmahl
«Als noch Kannibalismus und zahlreiche andere Übel herrschten, trat ein gewisser – und alles andere als törichter – Mann auf den Plan, der als erster dazu überging, das Opferfleisch zu rösten. Und weil es um so vieles besser als (rohes) Menschenfleisch schmeckte, liess man davon ab, einander zu verspeisen, und bereitete fortan die geopferten Tiere auf ebendiese Weise zu. Durch die genussvolle Erfahrung belehrt, experimentierte man weiter und kam zur Kochkunst. (...) Nachdem eine gewisse Zeit verstrichen war, gelang schliesslich die Entdeckung des Wurstens. Sein Erfinder kochte ein Zicklein, zerlegte es, setzte eine Süssspeise, dann, dem Auge nicht sichtbar, mit viel Geschick einen Fisch zu und rundete das Ganze zum Schluss mit Zugaben von Gemüsen, reichlich gepökeltem Fisch, Grütze und Honig ab. Und als alle auch aufgehört hatten, das Fleisch der verstorbenen Menschen zu essen, verstärkte sich in ihnen, der Genüsse wegen, von denen ich spreche, der Wunsch zusammenzuleben, so dass alsbald die ersten Lokalgemeinschaften, dann – alles, wie gesagt, infolge der Kochkunst! – ganze Städte entstanden.»[1]
Athenaios, griechischer Schriftsteller im 3. Jh. n. Chr., über die untrennbare Verbindung von Nahrungsmittelversorgung und Urbanität
Anmerkungen
[1] Claus Friedrich: Athenaios. Das Gelehrtenmahl. Anton Hiersemann Verlag, Stuttgart, 1998
[2] Richard Leakey: Die Suche nach dem Menschen. Umschau-Verlag, Frankfurt a. M., 1981, S. 94
TEC21, Mo., 2008.06.23
verknüpfte Zeitschriften
tec21 2008|26 Urban Essen