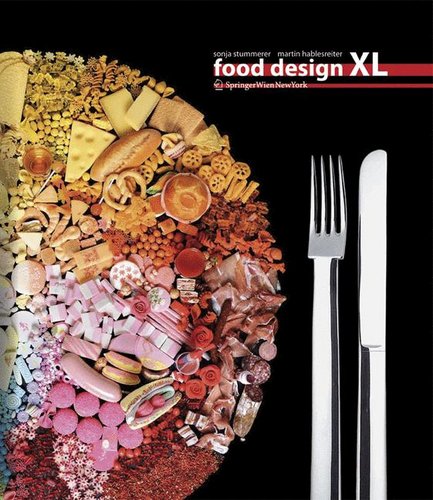Im Tokioter Stadtviertel Omotesando siedelten sich fast über Nacht Niederlassungen der besten Modelabels der Welt an. Nach Flagship Stores von Comme des Garçons oder Issey Miyake realisiert der japanische Jungstar Jun Aoki für Louis Vuitton ein Geschäft, während Herzog & de Meuron für Prada einen spektakulären Bau errichten.
Im Tokioter Stadtviertel Omotesando siedelten sich fast über Nacht Niederlassungen der besten Modelabels der Welt an. Nach Flagship Stores von Comme des Garçons oder Issey Miyake realisiert der japanische Jungstar Jun Aoki für Louis Vuitton ein Geschäft, während Herzog & de Meuron für Prada einen spektakulären Bau errichten.
Italiens Modelabel Prada setzt auf grosse Architekten. Szenestar Rem Koolhaas konzipierte den vor kurzem eröffneten Flagship Store in New York, weitere Läden in Los Angeles und San Francisco werden demnächst folgen. Beide Parteien vermarkten sich gegenseitig hervorragend. Nun wagt sich Prada gemeinsam mit Herzog & de Meuron in jene Stadt vor, in der das Einkaufen längst zum Erlebnis stilisiert wurde. Die Selbstverständlichkeit der breiten Masse, teure Markenprodukte zu erwerben und zu tragen, bezeugt das ungezwungene Verhältnis der Japaner zum Konsum. Angesichts der Tatsache, dass eine Japanerin für einen Kimono mehr als doppelt so viel auslegen muss wie für ein Chanel-Kostüm, dürfen Marken wie Prada auf ein kauffreudigeres Publikum zählen als in Europa oder in Amerika. Auch die japanische Lust am Spiel mit dem Verkaufsambiente kommt dem italienischen Label entgegen. Die neugierigen Konsumenten wollen von kreativen Marketingideen unterhalten werden, wobei ungewöhnliche Präsentationen und atmosphärische Räume besonders geschätzt werden. Die Idee, den Kunden zusätzlich zu den Waren auch Serviceleistungen und Unterhaltung anzubieten, hat in Japan Tradition.
Prada Plaza
Auf dieses «Mehr an Service» antworten nun Prada und Herzog & de Meuron mit der Schaffung eines öffentlichen Raumes im sonst so dichten Tokio. Die sogenannte Prada Plaza vor dem im Entstehen begriffenen Gebäude soll zum Treffpunkt im belebten Omotesando-Viertel werden. In dieser teuren Stadt ist unbebautes Land ein Luxus, den Prada geschickt als Marketing- Gag einsetzt. Ein weiterer Anziehungspunkt soll die Fassade werden, denn eigens entwickelte dreidimensionale Glaswaben sorgen für Durchsichtigkeit bei doch nicht gänzlicher Transparenz. Die sanft abgerundeten Ecken der Fassade erinnern an die Ästhetik der siebziger Jahre und harmonieren perfekt mit dem gegenwärtig so beliebten Retrostil von Prada.
Mit seinem Erscheinungsbild wird sich der neue Prada Flagship Store in Omotesando in bester Gesellschaft befinden. In unmittelbarer Nähe eröffnete Comme des Garçons schon 1989 ein Geschäft mit einer Glashülle aus gebogenen, blauen Scheiben, die es bei Nacht in einen magischen Hybriden aus Licht und Raum verwandeln. Yoshi Yamamoto, Issey Miyake und dessen neues Label Apoc verkaufen ihre Kultmode ein paar Häuserblocks weiter. Die berühmten japanischen Designer wählten Omotesando als Standort, um sich von der Ginza, dem noblen Einkaufsviertel in unmittelbarer Nachbarschaft des Kaiserpalastes, abzuheben, und gaben damit das erste Signal für die weitere Entwicklung des Stadtteils. In der Ginza treffen sich Noblesse und Tradition, in Omotesando hingegen geben sich Avantgarde und junges Publikum ein Stelldichein.
Calvin Klein als Trendsetter
Die stadträumliche Entwicklung Tokios kennzeichnet sich grundsätzlich durch eine ständige Verschiebung von Hierarchie und Bedeutung der einzelnen Quartiere. Trendviertel entstehen in zuvor unbedeutenden Wohngebieten und verschwinden nach einiger Zeit wieder, um anderswo neu zu entstehen. Noch vor wenigen Jahren beherbergte die Ginza alle wichtigen Marken aus Übersee. Damals war Omotesando nicht mehr als ein Paradies für konsumwütige Teenager. Möglichst auffällige Mode war das Credo der Vergangenheit, doch nun hat sich die breite Allee, die von der Omotesando-Kreuzung zum Bahnhof Harajuku führt, zum schicksten Einkaufsviertel der Stadt entwickelt. Extravaganz wird hier mit teuren Markenprodukten verbunden. Gerade deswegen setzen internationale Designermarken in Japan auf einen Imagewechsel, der nicht mehr nur die arrivierte Mittelklasse, sondern das kaufkräftige junge Publikum ansprechen soll.
Calvin Klein war der erste ausländische Modemacher, der das Potenzial von Omotesando entdeckte und 1994 sein weltweit erstes Exklusivgeschäft hier eröffnete. Doch nicht nur die Wahl des Standorts, sondern auch die Idee, in Tokio einen Flagship Store zu errichten, machte «CK» zum Trendsetter. Kurze Zeit später folgte Gucci und löste einen wahren Boom mit Folgen für die Stadtentwicklung aus. Omotesando wurde zu einer einzigartigen Ansammlung frei stehender Flagship Stores in Dimensionen, die ihresgleichen in Europa suchen. 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche sind keine Seltenheit. Doch nicht nur die Grösse dieser Markentempel ist erstaunlich, sondern auch der Umstand, dass es sich um eine Art kleiner Kaufhäuser handelt, die ausschliesslich Produkte einer einzigen Marke anbieten. Die japanischen Kunden schätzen an Omotesando aber nicht nur die europäischen Marken, sondern auch die für Tokio ungewöhnliche Atmosphäre eines fast schon pariserisch anmutenden Boulevards. Die breite Allee erlaubt nämlich als einzige Strasse Tokios den in Europa so beliebten Schaufensterbummel. Üblicherweise wird in Japan nur im Inneren riesiger Kaufhäuser flaniert. Deren universellem Angebot setzen die exklusiven Flagship Stores eine für Japan neuartige Produktpräsentation entgegen.
Die mittlerweile so beliebte Zelkoven-Allee diente ursprünglich nicht dem Kommerz, sondern als Verbindungsstrasse zwischen dem Kaiserpalast und dem Meiji-Schrein, der wichtigsten religiösen Anlage der Stadt. An hohen Feiertagen benützt der Kaiser auch heute noch die alte Strasse, doch die gegenwärtige Religion in Omotesando heisst Mode. Selbst traditionelle Marken wie Louis Vuitton oder Chanel versuchen in Omotesando neuen Trends zu folgen. Obwohl Taschen und Accessoires von Louis Vuitton in Japan seit Jahrzehnten zu den begehrtesten Markenartikeln zählen, beauftragte das Label einen Jungstar der hiesigen Architekturszene mit dem Entwurf eines neuen Flagship Store. Jun Aoki ist bekannt für seine eigenwillig spielerische Formensprache, und so scheint es, als seien die Zeiten, in denen Designermode mit Noblesse einhergehen musste, endgültig vorüber. Bei Chanel wird man in Omotesando nicht mehr mit eleganter Zurückhaltung begrüsst. Vielmehr sieht man sich einem leinwandgrossen Bildschirm gegenüber, auf dem die jüngsten Modeschauen zu sehen sind.
Oft aber wird die Hinwendung zum jungen Publikum erst zaghaft gewagt, und noch bestechen viele Interieurs nicht durch grosse Ideen. Spürbar wird vielmehr die Auswechselbarkeit der Inneneinrichtungen. Davon hält Prada selbstverständlich nichts. Das italienische Modelabel wetteifert lieber mit seinen japanischen Nachbarn: mit dem unvergleichlichen Shop von Comme des Garçons, dem schon dreimal vollkommen neu gestalteten Geschäft von Yoshi Yamamoto und mit Issey Miyake, der stets mit lokalen Architekten zusammenarbeitet. Für diese japanischen Designer ist die Interpretation des Standorts von grosser Bedeutung, denn gerade in Tokio ist auch der urbane Raum austauschbar. Hier wird nicht nur schnell ein Interieur ausgewechselt, sondern gleich das Erscheinungsbild eines ganzen Stadtteils. Omotesando ist momentan schick, doch schon macht sich Daikanyama bereit. Junge Designer aus London und aus Tokio haben dort bereits Quartier bezogen und einige phantastische Geschäfte eröffnet. Mode- und Kunststudenten sowie andere Trendsetter versuchen dort schon heute ihre Kleidung von morgen zu finden. Sie denken nicht mehr an Omotesando, doch Herzog & de Meuron haben die Chance, einem schnelllebigen Stadtteil Architektur zu geben, die dauern wird.
Neue Zürcher Zeitung, Fr., 2002.06.14