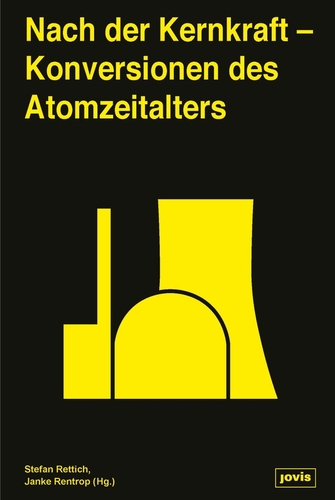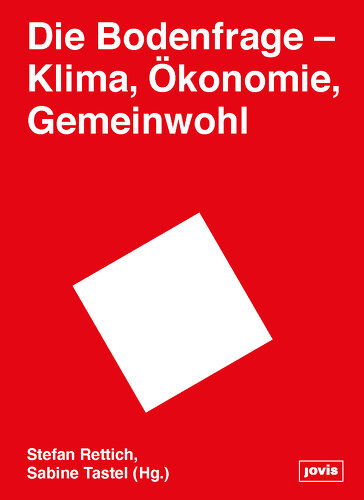Vor fast genau sechs Jahren stellte Horst Köhler, der damalige deutsche Bundespräsident in einem Zeitungsinterview fest, dass es innerhalb der föderalen...
Vor fast genau sechs Jahren stellte Horst Köhler, der damalige deutsche Bundespräsident in einem Zeitungsinterview fest, dass es innerhalb der föderalen...
Vor fast genau sechs Jahren stellte Horst Köhler, der damalige deutsche Bundespräsident in einem Zeitungsinterview fest, dass es innerhalb der föderalen Republik „große Unterschiede in den Lebensverhältnissen“ gibt und dass es diese zu akzeptieren gilt, um den Subventionsstaat hinter sich zu lassen. Mit dieser Forderung brach Köhler ein Tabu. Er stellte das Recht auf gleichwertige Lebensverhältnisse in Frage, das in Deutschland im Grundgesetz verbrieft ist, und löste damit einen Sturm der Entrüstung aus. – Dabei hatte Köhler nur den Status quo adressiert und laut ausgesprochen, was unter Urbanisten längst zum Allgemeingut gehörte: Wie unter dem Brennglas wiederholte sich im Osten Deutschlands die Raumentwicklung der alten BRD, mit allen Unzulänglichkeiten und Fehlern, nicht zuletzt angeheizt durch die neo-liberale Steuerpolitik der Kohl-Administration. Entscheidend dabei war, dass der Megatrend der Suburbanisierung, der sich in der alten BRD seit den frühen 1960er Jahren als Wachstumsphase abzeichnete, sich in den neuen Ländern unter demografischen und ökonomischen Schrumpfungsprozessen vollzog. Im Rückblick sieht es so aus, als hätten sich die Regionen und Städte in Ostdeutschland innerhalb einer Dekade nach einem dualen Prinzip neu konfiguriert.
Es sind die normativen Kräfte der Globalökonomie, die Manuel Castells in seiner Trilogie als das Informationszeitalter beschreibt. Entstanden sind polarisierte Raum- und Gesellschaftsstrukturen, die, nach dem digitalen Prinzip von „eins“ oder „null“, sich innerhalb oder außerhalb des Raumes der globalen Ströme wiederfinden. – Eine Tendenz, die sich auf allen Maßstabsebenen und für das gesamte Bundesgebiet abzeichnet.
Transformative Stadt
Innerhalb der neuen Bundesländer nimmt die aufstrebende Großstadt Leipzig auf Grund ihrer dynamischen Entwicklung mit sprunghaft wechselnden Vorzeichen eine Sonderrolle ein. Interessant ist dabei, dass die jeweilige allgemeine Einschätzung im Grunde nie der tatsächlichen Situation entsprach. Im Rückblick zeigt sich eine unberechenbare Stadt, die während ihrer Boomphase in den 1990er Jahren schrumpft und just in dem Moment, in dem sie sich zur Schrumpfung bekennt – das mag Zufall sein – wieder zu wachsen beginnt.
Zur Wende wies die gesamte Stadt erhebliche bauliche und funktionale Defizite auf. Leipzig war schon lange zuvor eine schrumpfende Stadt, die seit den 1950er Jahren bis zur Wende rund 60.000 Einwohner verlor. In die Nachwende- Jahre startete die Stadt deshalb nicht nur mit dem für ostdeutsche Großstädte typischen ökonomischen Strukturbruch, sondern auch mit einem Leerstandssockel von immerhin 35.000 Wohnungen in der gründerzeitlichen Kernstadt. Der dann einsetzende Bauboom war aus dieser Sicht unnötig und zielte an der tatsächlichen Marktsituation vorbei. Innerhalb einer Dekade wuchs an der Peripherie eine quantitativ und funktional gut bestückte Edge- City heran, die drohte, die Kernstadt auszutrocknen. Der Handel spielte sich fast ausschließlich auf der grünen Wiese ab, im suburbanen Raum der Stadtregion wurden weitere 34.000 Wohneinheiten neu errichtet. In der Folge stieg der Leerstand in der inneren Stadt auf 60.000 Wohnungen an.
Leipzig war die erste Stadt im Osten, die sich öffentlich zu ihrer Situation bekannte. Die Stadt eröffnete damit – sicherlich unbewusst – einen Diskursraum über ihre Zukunft. Über die Möglichkeit in der Unmöglichkeit, über das Wachsen im Schrumpfen. Der Diskurs hat im Rückblick nicht nur neue Denkräume eröffnet, sondern auch das Leerlaufen gestoppt. Im Gegenteil: Der Trend hat sich seither umgekehrt. Die Stadt im Gesamten verzeichnet ein sachtes Einwohnerwachstum und – viel erstaunlicher – sowohl die Stadtrandlagen als auch die Peripherie verlieren wieder, zu Gunsten der Kernstadt. Das erscheint paradox, verweist aber auf einen neuen Typus Stadt, dessen Raumproduktion sich aus einer Gleichzeitigkeit und Interaktion von Wachstumsund Schrumpfungsprozessen generiert – eine Art „Fluxus Stadt“, die jetzt um stabile Quartiere der Kernstadt und funktional aufgeladene Bereiche der Peripherie herum oszilliert. Fast scheint es, als bestünde die Kontinuität hier in der Transformation und als wäre das Temporäre das einzig Permanente. Diskontinuität und wechselhafte Polarisierung bilden denn auch die allgemeinen Parameter der „Transformativen Stadt“. Sie ist deshalb eine politisierte Stadt, in der das hohe Maß und die Permanenz an Veränderung situativ verhandelt werden muss.
Urbane Raumpolitik
Die räumlichen Verhältnisse in unseren Städten nur auf den Wirkungsgrad globaler Entwicklungen zu reduzieren, wäre zu einfach. Die Polarisierung der Räume in den Regionen wie in den urbanen Lagen ist eben auch das konkrete Ergebnis nationaler Politik sowie lokalen Handelns. Heutige Raumpolitik setzt wie die „unternehmerische Stadt“ auf Managementmethoden. Bereiche der öffentlichen Sphäre, die dem Funktionsgerüst unserer Städte nicht unmittelbar dienen, werden verleast, verkauft, verhökert. Die Erlöse aus dem Allgemeingut werden dagegen mehrheitlich in die Entwicklung weniger privilegierter Teilräume gelenkt, um im internationalen Konzert der Städte konkurrenzfähig zu bleiben.
Damit schafft die „unternehmerische Stadt“ das perfekte räumliche Pendant zu unserer fragmentierten Gesellschaft von heute, die von Polarisierung, Kontrolle und Exklusion geprägt ist. Das große Versprechen der Teilhabe ist dagegen eine verblasste Utopie, eine tägliche Ohrfeige für alle jene, die heute in den heruntergekommenen Räumen des Wohlfahrtsstaates leben müssen, die einst für gesellschaftliche Modernisierung, Aufstieg und Emanzipation standen.
Erst mit der jüngsten globalen Finanzkrise wurde offenbar, dass sich die öffentliche Hand in ihrem Privatisierungswahn selbst amputiert hat. Was aber passiert, wenn Städte nicht mehr handlungsfähig sind, wenn sie ihre Entwicklung nicht mehr selbst bestimmen und steuern können, oder wenn dem „Unternehmen Stadt“ gar der Konkurs droht? In Ostdeutschland müssen sich die Kommunen auf Grund der rasanten demografischen und ökonomischen Schrumpfung seit mehr als einer Dekade mit diesen Fragen auseinandersetzen. Diese unfreiwillige Avantgarde-Situation ist auch eine Probebühne für gesamteuropäische Entwicklungen und die Zeit nach dem ökonomischen Paradigma der letzten beiden Dekaden.
KARO* und L21
KARO* interessiert sich für das Design, den Entstehungsprozess und das soziale Regelwerk dieser Mikronetze und Raumpioniere. In den vergangenen Jahren wurden mehrere Experimente unternommen, solche Prozesse der Aneignung und der Selbstorganisation künstlich zu initiieren. Im Fokus steht ein Raumbegriff, der sich über das Herstellen und Ordnen von sozialen Beziehungen definiert. Der öffentliche Raum wird dafür zweckentfremdet, er ist lediglich situative Bühne und Katalysator für weiterführende Transformationsprozesse. Die Experimente erfolgen in Form von temporären Testläufen. In scheinbar aussichtslose Situationen werden oftmals kleine kulturelle Zellen eingeschmuggelt, die das Potential besitzen, sich rasch zu vermehren oder die Fähigkeit haben, zu mutieren und selbstorganisierte Systeme zu bilden.
Ausgangspunkt dieser selbst initiierten Forschungsreihe war die Gründung der Architektengruppe L21. Die Gruppe nutzte über mehrere Jahre den öffentlichen Raum von Leipzig als Bühne für absurde Situationen und Interventionen. Zum einen, um politische Hintergründe urbaner Schrumpfung aufzudecken, zum anderen, um eine ernsthafte partizipatorische Praxis einzufordern. Dem informellen Netzwerk L21 ging es bei der Gründung in erster Linie darum, die negativ konnotierte Leerstandsdebatte und fortschreitende Perforation auf neue Möglichkeiten in der Stadtentwicklung hin zu untersuchen.
Wahllokal
Ein zweiter, wesentlicher Punkt, der adressiert wurde, ist das bestehende Eigentumsrecht, das die Mobilisierung von Grundstücken für öffentliche Zwecke oder die Möglichkeit zur Aneignung durch die Anwohner verhindert. Anfänglich diskutierte Ansätze wie eine progressive Grundbesteuerung, die marktgerechte Neubewertung von Grund und Immobilien oder Tauschpools für Grundstücke sind aus der offiziellen Debatte längst wieder verschwunden. Es bleibt alles beim Alten, die Stadt gehört den Grundbüchern und den verfälschten Buchwerten in den Bilanzen der Eigentümer.
Im September 2002, am Tag der Bundestagswahl, hat L21 auf den Trümmern eines seit längerer Zeit eingestürzten Gründerzeithauses deshalb ein „Wahllokal“ eingerichtet. „Aufbau Ost ist Chefsache“ war eines der Versprechen, die von den verschiedenen Kanzlerkandidaten vor der Wahl geäußert wurden. Ziel war es, mit den Besuchern des Wahllokals die politischen Ansätze der Parteien und ein von L21 entworfenes Sechs-Punkte-Papier zum Stadtumbau zu diskutieren. Es war fast symptomatisch und nicht unerwartet, dass über den Tag verteilt drei Polizeieinsätze erfolgten – das friedliche und rege frequentierte Sit-in war nicht legal. Weniger Dichte und mehr Grün, die allgemeinen Versprechen der „perforierten Stadt“, lösen sich in den meisten Fällen, wenn überhaupt, nur visuell ein. Spätestens an der Grundstücksgrenze zeigt sich die unsichtbare rechtliche Barriere und damit die vielleicht entscheidende Aufgabe der Politik: Ohne Möglichkeiten der Aneignung und der Bewirtschaftung von neu gewonnenen Freiräumen werden sich die Potenziale in schrumpfenden Räumen nicht entfalten können. Und auch sonst wird es immer mehr darum gehen, die komplexen Zusammenhänge eines Ortes sichtbar zu machen und darauf situativ zu reagieren.
Handgemachte Bibliothek in Magdeburg
Mehr als 30.000 Bücher umfasst der Bestand der Bürgerbibliothek im Magdeburger Stadtteil Salbke, der seit Juni 2009 in Teilen auch in der zugehörigen Freiluftbibliothek zugänglich ist. Die Regale sind nicht verschlossen, die Bücher können rund um die Uhr entnommen werden. Es ist eine Bibliothek des Vertrauens, ohne Bürokratie und Leihschein. Es ist eine Entwicklung, die zu Projektbeginn im Jahr 2004 kaum denkbar war, die ohne Partizipation und multiple Autorenschaft erst gar nicht möglich gewesen wäre. Partizipation oder die Auseinandersetzung mit dem urbanen Alltag sind keine neuen Phänomene. Sie tauchen sowohl in der Kunst als auch in der Architektur des 20. Jahrhunderts immer dann auf, wenn eine Distanz zum normalen Leben und der Gesellschaft erkannt wird. Es handelt sich im besten Sinne um Selbstkritik an der eigenen Praxis und um eine „Infragestellung des Autors“[1]. Fast könnte man meinen, es handle sich um ein notwendig wiederkehrendes, reinigendes Ritual.
Ein intimes Zwiegespräch zwischen Autor, Rezipienten und deren Alltag, mit dem Ziel, die Vorbedingungen von Stadt und Architektur für den nächsten Zeitraum neu zu definieren.
Stadt auf Probe
Salbke gilt in Magdeburg seit den 1990er Jahren auf Grund von hoher Arbeitslosigkeit und Leerständen als Sinnbild für Schrumpfung. Die Idee für ein temporäres Zeichen und den Bau einer Freiluftbibliothek – auf der Freifläche der ehemaligen abgebrannten Ortsbibliothek – wurde bereits zu Beginn des Jahres 2005 als Ergebnis einer von der Stadtverwaltung beauftragten Studie zur Entwicklung von Brachflächen diskutiert und im Stadtteil positiv aufgenommen. Allerdings fehlten die Mittel für die Umsetzung.
Nachdem die Architekten von der Berliner Galerie Aedes zu einer Gruppenausstellung eingeladen wurden, griffen sie das Konzept erneut auf, und das Projekt gewann wieder an Fahrt. Der Ausstellungsbeitrag war als ergebnisoffenes Experiment konzipiert und bestand darin, mittels einer temporären Intervention im öffentlichen Raum einen Partizipationsprozess zu initiieren und aus diesem die Form und die Funktion einer möglichen Freiluftbibliothek abzuleiten.
Ein leeres Ladenlokal, direkt an der Brachfläche gelegen, diente als Basislager für einen einwöchigen Workshop. Hier wurden an einem Stadtmodell Entwürfe und Möglichkeiten durchgespielt und verworfen, Modelle von Kindern und Bewohnern des Stadtteils gebaut, und am Ende der Woche wurde die tragfähigste Lösung als Modell im Maßstab 1:1 errichtet. Als Baumaterial für den temporären Funktionstest einer langen Bücherwand mit Bühne dienten 1.000 Bierkisten, die ein lokaler Getränkehändler bereit stellte. Ein Spendenaufruf nach Büchern fand in der gesamten Stadt Widerhall und die so zusammengetragenen Bücher füllten die Regale der temporären Installation. Obwohl das improvisierte Bibliotheksmöbel nur für zwei Tage den Stadtraum bestimmte, hat es eine dauerhafte Wirkung entfaltet. Direkt nach dem Abbau der Installation hat der Bürgerverein die Entscheidung getroffen, mit den 700 gespendeten Büchern eine informelle Bürgerbibliothek in dem Ladenlokal neben dem Grundstück zu gründen und diese ohne finanzielle Unterstützung selbst zu betreiben.
Innerhalb von zwölf Monaten wuchs der Buchbestand auf 10.000 Bände an. Auf Grund dieser dynamischen Entwicklung wurde auf Initiative der Architekten ein Förderantrag für ein ExWoSt-Forschungsprojekt des Bundes gestellt, mit dem Ziel, das Provisorium in eine dauerhafte Struktur zu überführen und auch die Idee der Freiluftbibliothek zu verwirklichen. Ende 2006 wurde das Projekt schließlich als Modellvorhaben in das Forschungsvorhaben aufgenommen. Damit war die Umsetzung der Freiluftbibliothek als dauerhaftes Stadtmöbel finanziell abgesichert.
Soziales Design
Die Beteiligung folgte bei der danach anstehenden Planung des Bauprojekts dem Muster der ersten Phase, in Form von gemeinsamer Arbeit, Diskussion und der Besetzung eines weiteren, leer stehenden Ladenlokals im Ortskern. In einem vierwöchigen Planungscamp wurde die Idee eines grünen Wohnzimmers, das, geschützt vom Straßenlärm, eine Ruhezone im Stadtteil bieten soll, weiter verfeinert. Neben der Kernfunktion als Bibliothek wurden differenzierte Begegnungsräume und Aktionsflächen wie etwa eine Bühne und ein Jugend- Corner definiert. Auch die Akteursdichte ist in diesem Zeitraum deutlich angewachsen: Es gibt jetzt acht Gruppen, die über das Projekt und eine dafür entwickelte Internetplattform miteinander vernetzt sind. Um den Bürgerverein, der die führende Rolle einnimmt, haben sich u.a. die Grundschule, ein Jugendclub, die Kirchgemeinde und die kommunale Wohnungsgenossenschaft gruppiert. Letztere stellt auch das Ladenlokal für die Bürgerbibliothek kostenfrei zur Verfügung.
Recycling der Nachkriegsmoderne
Auffälligstes Merkmal des Objektes ist zweifelsohne die Fassade aus tiefgezogenen Aluminiumformteilen, die mit ihrer modernistischen Ornamentik an eine Kaufhausfassade aus den 1960er Jahren erinnert. Tatsächlich stammt die Fassade samt Unterkonstruktion von einem ehemaligen Horten-Warenhaus, das im Jahr 2007 in der westfälischen Stadt Hamm abgebrochen wurde. Die dortige Stadtverwaltung hat die Fassade zur Unterstützung des sozialen Projektes in Magdeburg zu günstigen Konditionen abgegeben.
Ausgangspunkt der gesamten Fassadenüberlegung war wiederum der Beteiligungsprozess, bei dem sich mehrere Bürger für den Einsatz von Recyclingmaterial ausgesprochen hatten. Kontakte der Architekten zur Stadtverwaltung in Hamm führten letztlich zum Vorschlag dieser ungewöhnlichen Idee, die von den Bürgern mit Begeisterung aufgenommen wurde. Allerdings mussten zunächst heftige Widerstände – wie rechtliche Fragen, Klärung der Verkehrssicherheit in der Nutzung und Materialprüfungen – überwunden werden, bevor die Fassade heute als neues „Village Icon“ den Aufbruch des Stadtteils nach Jahren starker demografischer Schrumpfung signalisiert.
Situatives Design
Partizipative Wechselspiele wie bei der Fassade gab es zwischen den Akteuren und den Architekten zuhauf, sodass sich die Grenzen der Autorenschaft tatsächlich verwischen. Zum Beispiel wurde ein Wettbewerb ausgelobt, zu dem alle Jugendlichen aus Magdeburg ihr tag, d.h. ihre persönliche Graffiti-Unterschrift einreichen konnten. Die besten tags wurden dann von Jugendlichen selbst aufgebracht.
Vorgegeben war lediglich die Verwendung der Farben Weiß, Schwarz und Chrom. Es mag mit an dieser Aktion gelegen haben, dass Jugendliche, die an der Entwicklung des Projektes wenig Interesse zeigten, heute die größte Nutzergruppe stellen. Allerdings nicht ohne Konflikte, denn das von den Jugendlichen präferierte Chillen deckt sich nicht ganz mit der Idee des kontemplativen Lesens. Dennoch ist die Lage, auch nach einer ersten Vandalismusattacke Ende 2009, bis heute stabil. Dies zeigt aber auch, dass das Projekt nicht nur Katalysator der Stadtentwicklung ist, sondern auch Monitor bestehender sozialräumlicher Konflikte, die es weiterhin mit situativen Ansätzen zu begleiten und zu lösen gilt.
Anmerkung:
[01] Kravagna, Christian: Arbeit an der Gemeinschaft. Modelle partizipatorischer Praxis; in: Babias, Marius; Könneke, Achim (Hg.): Die Kunst des Öffentlichen; Verlag der Kunst, Dresden 1998
Hintergrund, Mi., 2011.01.12
verknüpfte ZeitschriftenHintergrund 49 18. Wiener Architekturkongress
![]()