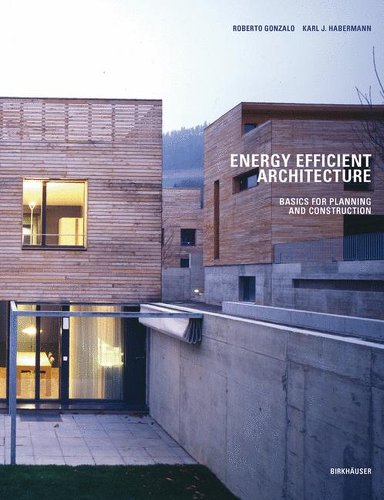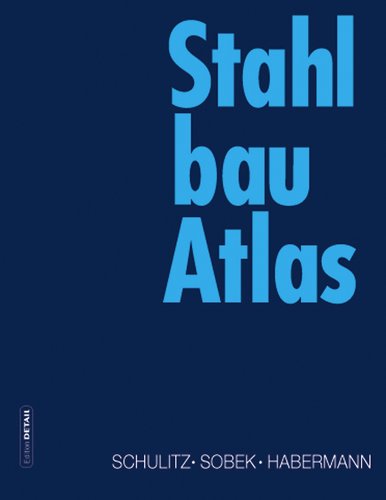Das Funkeln im Moos
Welche Vorstellungen tauchen im Kopf bei den Begriffen Schule und Farbe auf? Da sind vor allem Foyers, die von vielerlei Kunsterziehungsprodukten verklebt und verstellt sind – kein besonders positives Gefühl, eher die Assoziation an rigoros in Bahnen gelenkte Kreativität. Da tut es gut, wenn ein Gebäude – professionell farbig gefasst – signalisiert: Hier bin ich, hereinspaziert, ich biete Anregung, wecke Neugier, sorge aber auch für Geborgenheit. Alles Aspekte, die man mit dem Farbspektrum Orangerot verbindet. Keine Villa Kunterbunt, sondern sorgfältig aus dem örtlichen Kontext entwickelte Architektur und ein ebenso sorgfältig konzipiertes Farbkonzept.
Welche Vorstellungen tauchen im Kopf bei den Begriffen Schule und Farbe auf? Da sind vor allem Foyers, die von vielerlei Kunsterziehungsprodukten verklebt und verstellt sind – kein besonders positives Gefühl, eher die Assoziation an rigoros in Bahnen gelenkte Kreativität. Da tut es gut, wenn ein Gebäude – professionell farbig gefasst – signalisiert: Hier bin ich, hereinspaziert, ich biete Anregung, wecke Neugier, sorge aber auch für Geborgenheit. Alles Aspekte, die man mit dem Farbspektrum Orangerot verbindet. Keine Villa Kunterbunt, sondern sorgfältig aus dem örtlichen Kontext entwickelte Architektur und ein ebenso sorgfältig konzipiertes Farbkonzept.
Die neue Grundschule in Dachau Augustenfeld, einem städtebaulichen Entwicklungsgebiet auf der der Stadt abgewandten Seite der ICE-Trasse, setzt in Form und Farbe ein deutliches Zeichen, und das ist gut so. Soll sie doch in naher oder fernerer Zukunft eine identitätsstiftende Mitte im neuen Quartier bilden. Noch besteht das Siedlungsgebiet allerdings nur auf dem Reißbrett und der Blick vom östlichen Vorfeld der Bahnstation bis zum Schulgebäude ist unverbaut. Nur, wenn man über Lage und Form Bescheid weiß, kann man das Gebäude aus der Distanz ausmachen, denn die Wahl der Grundfarbe wurde von den Architekten bewusst am moorigen Untergrund festgemacht: »Schlammgrau« war dann auch die in die Diskussion eingeführte Bezeichnung. Sie steht für eine Tönung der Oberfläche, die sich tatsächlich an der Farbe von der Sonne getrockneten Torfs festmachen lässt. Die Zeit, zu der die Anwohner im Dachauer Moos ihr Brennmaterial gestochen und die Felder nach und nach trockengelegt haben, um Kartoffeln und Rüben anbauen zu können, ist längst vorbei. Offene Aufschlüsse im Gelände sind im Dachauer Moos heute kaum mehr zu finden. Im Stadtrat und in der örtlichen Presse stieß die Farbbezeichnung »schlammgrau« dann auch auf vorhersehbares Befremden. So meinte ein Mitglied des Gremiums, diese Schlamm‧farbe wäre nachgerade ein Ausdruck von Trostlosigkeit. Der Oberbürgermeister ließ sich dadurch nicht verunsichern und meinte nur entschieden: »Ich find´s gut.« Zwei Jahre nach dieser konträren Debatte hat sich die Aufregung gelegt. Schüler, Eltern, Lehrer, Bauherrschaft und Bürger haben sich mit ihrer Schule angefreundet. Heute hat das Erscheinungsbild einen wesentlichen Anteil am hohen Maß der Identifikation mit der eigenen Schule.
Schlammgrau und kräftiges Rot Die detaillierte Ausarbeitung der Farbgestaltung war das Ergebnis eines Wettbewerbs Kunst am Bau, den die Stadt Dachau auf Betreiben von deffner voitländer bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt des Entwurfs auslobte. Während die Idee der schlammgrauen Fassung der Außenfassaden schon existierte, wurde für die Innenhöfe lediglich eine »frische, aktive Farbgebung« als Vorgabe formuliert. Eine Jury unter der Leitung des renommierten Malers und Professors der Münchner Kunstakademie Günter Förg entschied sich für die Ideen des ortsansässigen Künstlers Paul Havermann. Der Maler hatte an der Grundvorstellung der Architekten, dass sich der Bau mit seiner strengen, farbig gefassten Kubatur aus dem moorigen Untergrund nach oben schiebt, angeknüpft und ein mutiges und in sich schlüssiges Farbkonzept erarbeitet. Dieses wurde in der Folgezeit in enger Zusammenarbeit konkretisiert und verfeinert. Für drei ausgewählte rot-orange Töne wurde die Umsetzung auf unterschiedlichem Untergrund getestet und schließlich festgemacht. Neben der Wirkung der Farbe in durchgefärbtem Beton oder auf verputzter Wandoberfläche ging es um die Art der Beschichtung der Fensterprofile und der Einfärbung der auszuwählenden Markisenstoffe. Die festzulegenden Farben hatten im Kontext zum warmen Grau der Grundfarbe, dem Asphalt im Eingangsbereich sowie der Vegetation und den Rasenflächen im Umfeld zu bestehen. In ihrer Argumentation für ein »kräftiges Funkeln im Moos« konnten die Beteiligten schließlich mit Fug und Recht auf die Geschichte der berühmten Dachauer Malerkolonie und das Ergebnis der Freiluftmalerei bekannter Künstlerpersönlichkeiten aus den Epochen des frühen und späten 19. Jahrhunderts verweisen.
Zeigte sich die nur vordergründig eintönige Moorlandschaft in ihren unterschiedlichen Stimmungen übers Jahr doch äußerst vielfältig und alles andere als eindrucksarm und regte damit zu entsprechenden künstlerischen Umsetzungen an. Namen von Spitzweg, über Dillis bis Marc und Nolde legen hierzu ein bedeutendes Zeugnis ab. Bewegt man sich, selbst bei trübem Wetter, auf die Schule zu, so beginnt der graue Quader dennoch an den Gebäudeeinschnitten zu leuchten. Es bedarf keiner weiteren Hinweisschilder zum Eingang. Dieser ist bereits durch die Farbe deutlich formuliert. In Foyer und Pausenhalle sorgt das kräftige Farbspiel für gute Laune. Die aus dem klaren Kubus polygonal ausgeschnittenen Aufenthalts- und Verkehrsflächen setzen sich graduell farblich gegeneinander ab und unterstützen auf selbstverständliche Art und Weise hier auch die Orientierung im Gebäude. Erst in den Klassentrakten mit den breiten, hellen Fluren und den angeschlossenen Unterrichtsräumen kehrt farbliche Ruhe ein. Hier ist ein neutraler Untergrund aus Weiß- und Grautönen wichtig für die Entfaltungsmöglichkeit der Kinder. Die Grundrissorganisation ist übersichtlich angelegt. In der Eingangs- und Pausenhalle laufen die Fäden zusammen. Dem Eingangshof entspricht der sogenannte Theaterhof auf der gegenüberliegenden Seite. Die zwei Klassentrakte, ost-west-orientiert mit großzügigen, aber nicht überdimensionierten Fenstern ausgestattet, werden durch einen weiteren internen Hof, den Klassenhof, voneinander getrennt. Hier ließe sich auch Unterricht im Freien abhalten. Die Flure vor den Klassenräumen sind nicht nur nach beiden Seiten geöffnet, sondern auch breit genug, um genügend Platz zum Verweilen, zum gegenseitigen Austausch und zum Kommunizieren zu bieten. Nach Norden ist der Flügel mit Ganztagsbetreuung im Erdgeschoss und den Räumen für Schulleitung und Lehrpersonal im Obergeschoss orientiert. Die im Gebäude geschickt integrierte Hausmeisterwohnung bietet sowohl die gewünschte Kontrollmöglichkeit des Eingangs als auch die erforderliche Wohnqualität. Die Ausstattung der Klassenzimmer ist nicht zuletzt auch aus Kostengründen ohne Schnörkel. Der Blick aus dem Fenster bietet jedoch Ablenkungsmöglichkeiten genug. Die polygonale Führung der Wände der Innenhöfe und der Pausenhalle sorgt nicht nur am Tag für fein nuancierte Lichtbrechungen und Reflexionen.
Auch in den Abendstunden gibt es bei künstlicher Beleuchtung ein ähnlich eindrucksvolles und abwechslungsreiches Farbenspiel. Die Beleuchtungskörper in den Höfen nehmen geschickt die banale Straßenbeleuchtung auf und erzeugen, falls notwendig, auch nachts ein ähnlich hohes Maß an Durchlässigkeit des Gebäudes wie am Tage. Die Konstruktion entwickelte sich aus dem Wunsch des Bauherrn nach konventioneller und äußerst wirtschaftlicher Bauweise. Die Architekten wählten daher, abgesehen von den Fassaden der Pausenhalle, eine Massivbauweise mit Ziegelmauerwerk für alle Innen- und Außenwände. Die einschalige Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln erreicht mit einer Stärke von 49 cm sehr gute Wärmedämmeigenschaften.
Nachbarschaften Der Freibereich vor der Schule bietet sich von selbst als Pausenhof an und ist mit einer Doppelreihe von Bäumen sensibel vom Außenbereich der benachbarten Montessorischule abgetrennt. Der Auftakt für eine weiterführende grüne Verbindungsachse nach Norden ist gelegt. Mit dem Bau der privat initiierten und von einem Verein getragenen Montessorischule wurde nach Fertigstellung der Grundschule vor zwei Jahren in direkter Nachbarschaft begonnen. Sie hat mittlerweile auch ihren Betrieb aufgenommen. Die schon projektierte Dreifach-Turnhalle wird ebenso wie die bereits vorhandenen Sportflächen beiden Schulen zur Verfügung stehen. Zur heute noch skurril erscheinenden Lage auf freiem Feld und zur verkehrstechnisch kaum zufriedenstellenden Erschließung des neuen Schulkomplexes kann man nur Folgendes anmerken: Hoffentlich lässt die städtebauliche Entwicklung und Einbindung nicht allzu lange auf sich warten. Die aktuelle Erschließung ist kaum akzeptabel. Neben einer kurzen Stichstraße von der Hauptstraße zum Parkplatz mit Wendeschleife gibt es nur einen schmalen Fußweg zu den anschließenden freistehenden Siedlungshäusern entlang der alten Augustenfelder Straße. Ein aus dem Internet herunterladbarer Wegeplan für die Schulkinder ist ein anschaulicher Beleg für die desolate Lage. Die schnelle Umsetzung der Verkehrsinfrastruktur müsste uneingeschränkte Priorität haben. Dass hierbei die konsequente Trennung von Fuß- und Fahrwegen und der Erhalt der Sichtachse zum Schlossberg ebenso Berücksichtigung finden sollten wie die Überwindung oder die ansatzweise Korrektur der durch Schallschutzmaßnahmen entstandene ICE-Barriere, versteht sich von selbst.
db, Do., 2009.01.22
verknüpfte Bauwerke
Grundschule Dachau Augustenfeld
verknüpfte Zeitschriften
db 2009|01 Farbe im Dialog