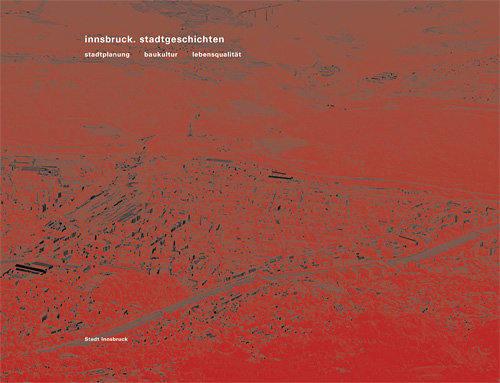Luxus auf dem Land
Das alteingesessene Modehaus »Föger Woman Pure« erhielt auf einem schmalen Nachbargrundstück einen expressiven Anbau, der Schaufenster, Präsentationsraum und Laufsteg zugleich ist. Die kleinräumliche Gliederung des Altbaus wird dort in räumliche Opulenz überführt. Trotz fein ausgearbeiteter Details bedürfen der ruppige Charme der Oberflächen und die ungekannte Großzügigkeit des Anbaus seitens der Kundschaft noch einiger Gewöhnung.
Das alteingesessene Modehaus »Föger Woman Pure« erhielt auf einem schmalen Nachbargrundstück einen expressiven Anbau, der Schaufenster, Präsentationsraum und Laufsteg zugleich ist. Die kleinräumliche Gliederung des Altbaus wird dort in räumliche Opulenz überführt. Trotz fein ausgearbeiteter Details bedürfen der ruppige Charme der Oberflächen und die ungekannte Großzügigkeit des Anbaus seitens der Kundschaft noch einiger Gewöhnung.
Der alte Industrieort Telfs, eine 15 000-Einwohner-Gemeinde im Tiroler Oberland, hat keine kunsthistorischen Baudenkmäler aufzuweisen und nur wenige Zeugnisse beachtenswerter zeitgenössischer Architektur. Giebelhäuser mit Satteldach säumen die Hauptstraße. Und so wirkt das Schaufenster des Luxusmodengeschäfts wie ein Bote von einem fremden Stern.
Seit den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts beherbergt das unscheinbare dreigeschossige Haus an der Telfer Hauptstraße ein Textilgeschäft. Eine Vorfahrin hatte hier die von der längst verblichenen Textilindustrie erzeugten Stoffe in ihrem Resteladen auf 20 m² unter die Leute gebracht. Das Geschäft blieb in der Familie, die inzwischen an mehreren Fronten erfolgreich unternehmerisch tätig ist. Midi Moser-Föger erbte es vor über 20 Jahren, hat es nach und nach erweitert und dem Sortiment ein »Upgrade« verpasst. Vor einigen Jahren kaufte sie das angrenzende Wohnhäuschen, ließ es abreißen und an seiner Stelle im Vorjahr von Reto Pedrocchi ein spektakuläres Schaufenster errichten.
Das Medieninteresse war groß – und beabsichtigt. Wenn eine mutige Unternehmerin fernab der mondänen Nobelorte mit den exquisitesten Labels Geschäfte machen will, braucht sie Aufmerksamkeit.
Den Architekten hatte sie über ihre Verbindungen zu großen Pariser Modehäusern kennengelernt; als Projektleiter hatte er schon für Herzog & de Meuron den Prada-Flagshipstore in Tokio umgesetzt und für Comme des Garçons zwei »Guerillastores« in Basel. Pedrocchi war verblüfft, wie viel Entgegenkommen er vonseiten der lokalen Baubehörde erfuhr, nur Straßenflucht, Bauhöhe und v. a. der Rhythmus der Satteldachsilhouette waren einzuhalten.
Der im alpinen Raum eigentlich überall präsente und gefürchtete Ortsbildschutz ist in Telfs kein Thema – im Ort ist man bemüht, Leerstände im Zentrum zu vermeiden, ohne sich dabei auf Kebab, Pizza, Banken und Telefonshops zu beschränken.
Schaufenster im XXL-Format
Das Gesamtkonzept war einfach, es bestand lediglich darin, eine adäquate Hülle für anspruchsvolle Mode zu schaffen. Eigentlich ist es ein kleines Projekt mit nur 140 m² Nutzfläche, doch ein Entwurf von hoher Komplexität, wobei Struktur, Raum und Nutzung zu einer untrennbaren Einheit verschmelzen. Das aus Dreiecksflächen zusammengefügte Betondach ist außen mit schwarzem Lochblech überzogen und hat die Form einer verschobenen Pyramide. Es schwebt bis 7,3 m hoch über einer lichten, stützenfreien Halle, die aufsteigend ihre räumliche Wirkung entfaltet. Der zur Straße hin leicht abfallende Raum wird an zwei Seiten von tragenden Wänden begrenzt, die Fassade besteht aus nach außen gekippten, in verschiedene geometrische Formen gebrochenen Glasflächen, Hocker aus Gummigranulat verhindern, dass sich die Fußgänger versehentlich am Glas stoßen. Der Zugang erfolgt über einen breiten Gang vom Altbau her, die frühere Eingangssituation wurde nicht verändert. Nichts stört die Offenheit des Raums, der sich von innen heraus entwickelt und letztlich so etwas wie ein begehbares Schaufenster bildet. Den Blickfang bilden zwei, auf halber Höhe den Raum querende Stahlbetonträger, die sich im spitzen Winkel kreuzen. Das Betonkreuz ist nicht nur statische Notwendigkeit, sondern auch Grundlage des flexiblen Raumkonzepts, die Hülle bleibt gleich, die Inhalte können sich ohne Verlust der architektonischen Qualität ändern. An langen Edelstahlhaken schwingen die Gewänder frei im Raum, begleitet von an der Wand entlangziehenden Ablagen für exquisite Accessoires. Die kargen, nüchternen Materialien Rohbeton, Glas und Edelstahl kontrastieren mit der warmen Farbe des Natursteinbodens. Das große Raumvolumen und die harten Oberflächen erzeugen einen starken Nachhall und damit die Wirkung eines hohen großen Raums. Kein aufdringlicher Raumduft und kein nervtötender Klangteppich stören. Für Kühlung und Belüftung sorgen Schlitze entlang der Fassade und eine Bodenheizung. Durch die hohen Scheiben fällt natürliches Licht und betont die Farbechtheit, Fluoreszenz-Leuchten führen über und unter dem Betonkreuz entlang und verborgene LED-Lichtstreifen beleuchten die Regale. Dank der Lichtführung verwandelt sich der Raum nachts in ein leuchtendes Prisma.
Die Umkleidekabinen, bei denen auch die Sanitäranlage angesiedelt ist, liegen hinter der Kuppel. Mit Oberlichtern versehen, weichem Teppichboden und grüngolden schimmernden Mosaiken formen sie eine intimere Atmosphäre.
Kunstwerke
Die museale Anmutung zeigt mit der Art der Hängung kreative Wege in der Warenpräsentation und verleiht den Schaustücken die Aura eines Kunstwerks, was auch ihrem Wert entspricht. Die rohen Oberflächen ohne »Innenarchitektur« bieten wenig Möglichkeiten für Veränderungen und sind per se ein Beispiel für Zeitlosigkeit, falls das Material in Würde altert.
Der Neubau als großes Schaufenster bereitet eine Bühne für die Kundinnen, die diese neugierig begutachten, aber noch kaum nutzen. Ebenso wenig wie die großzügigen Umkleidekabinen, zu deren Nutzung sie von den Verkäuferinnen auch nicht ermuntert werden. Das Neue ist Kontrast und Ergänzung zum eleganten, »wohnlichen« Altbau mit seinen Nischen und Ecken, der innen unverändert blieb, nur die Oberflächen wurden aufpoliert und die Böden geschliffen, denn die Kundinnen sind eher konservativ. Der äußere Zusammenhang zwischen Alt und Neu ist subtil inszeniert. Die Glasfront zieht sich über beide Teile und das Giebelhaus aus den 50er Jahren bekam statt des weißen einen dunkelgrauen Anstrich.
Was im Entwurf eine einfache, klare Lösung schien, war bei der Umsetzung mit viel Energie und Kraftaufwand verbunden. Das, so weiß Reto Pedrocchi, passiert ihm öfter, denn unkonventionelle Lösungen gehen an die Grenzen des Könnens und der Motivation. Die Probleme begannen beim Rechnen; zu viel Armierungseisen sei verbaut worden, glaubt er. Erwiesen ist, dass sich mehrere Firmen eine Umsetzung nicht zutrauten und dass die Innsbrucker Technische Fakultät mit der Kontrolle der statischen Berechnungen betraut wurde. Zum Glück hat sich das ortsansässige Architekturbüro Walch bei der Bauleitung sehr engagiert. Über die Kosten breitet sich ein Mantel des Schweigens, aber für ein solides Einfamilienhaus hätte es wohl gereicht.
db, Mi., 2011.08.31
verknüpfte Zeitschriften
db 2011|09 Erlebnis Kaufraum