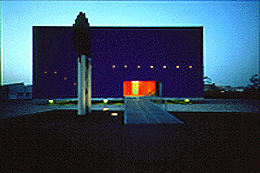Venedig, die Architektur und der Polterer
Einwendungen gegen die „mutwilligen Verbiegungen“ einer „innovativen“ Architektur, die den Ehrgeiz hat, so auszusehen, „als ob sie fliegen könnte“, als Erwiderung auf Wolf D. Prix' Biennale-Schelte („Architektur-Karneval in Venedig“, STANDARD, 1. 9.)
Einwendungen gegen die „mutwilligen Verbiegungen“ einer „innovativen“ Architektur, die den Ehrgeiz hat, so auszusehen, „als ob sie fliegen könnte“, als Erwiderung auf Wolf D. Prix' Biennale-Schelte („Architektur-Karneval in Venedig“, STANDARD, 1. 9.)
Chipperfield's Architekturbiennale - und die davor von Kazuyo Sejima - führen vor, dass sich die Auffassung, welche Gewichtung in der Architektur weiterführend bedeutsam sein wird, deutlich geändert hat. In den Mittelpunkt wird wieder der notwendige gesellschaftliche Konsens gerückt, der ja die Baukunst grundsätzlich von den freien Künsten trennt. Eine klare Absage an egomane Attitüden, deren Wille zum „innovativen“ Mut recht mutwillige Verbiegungen hervorbrachte. Ihr zuerst gepriesenes spektakuläres Äußeres war in der Regel ideell rasch verpufft und die Bauwerke vielfach materiell in Auflösung.
Dass diese Architektur den Ehrgeiz hat, so auszusehen „als ob sie fliegen könnte“, immer antritt gegen das Bestehende, lässt sich in der scheinbar unstillbaren Sucht nach Modernität und immerwährendem Neubeginn verstehen.
Zu ihrer Umsetzung muss aufwändige Technik herhalten, räumliche Qualitäten aber hinken weit hinter historischen Beispielen her. Stellt man beispielsweise einen Bau wie das 2000 Jahre alte Pantheon dagegen, wird klar, wie sehr sich unter modernistischem Vorzeichen die Kriterien der Architektur verzerrt haben.
Was nun versucht wird, ist herauszukommen aus diesem endlosen Probieren, die Architektur ständig neu zu erfinden. Wiens Dachausbauten der letzten 15 Jahre geben ein unübersehbares Zeugnis von diesem Bemühen, das vor allem die Architekturausbildung der Angewandten zu ihrem Programm erklärt hat.
Die Themen, denen man sich mit zunehmender Behutsamkeit zuwendet, geben Europas Metropolen vor:
Wie lässt sich grandioses Erbe mit den heutigen Anforderungen zu einer brillanten Einheit verbinden. Dieses Anknüpfen an Tradition, dieses Verbinden zu neuer Gemeinsamkeit ist nicht rückwärtsgewandt. Es ist politisch so wichtig wie architektonisch. Europäischer Stoff - sorry world - es gibt keinen besseren.
Prix's Äußerungen sollte man nicht auf die Goldschale legen. Die Biennale, die er so harsch kritisiert, kennt er allenfalls aus Zeitungen. In Venedig war er nicht. Chippi hat den Fehler gemacht, ihn nicht einzuladen. Dazu kommt, dass ausgerechnet Tschapeller, der ihm trotz handverlesener Jury den Umbau für die Angewandte wegschnappt, Österreich in Venedig besser vertritt als das in vergangenen Jahren geschehen ist. Und der Richtungswechsel, der immer deutlicher wird.....
Da kommt schon einiges zusammen, das den schwindenden Einfluss durch lautes Poltern wettmachen muss.
Der Standard, Sa., 2012.09.08