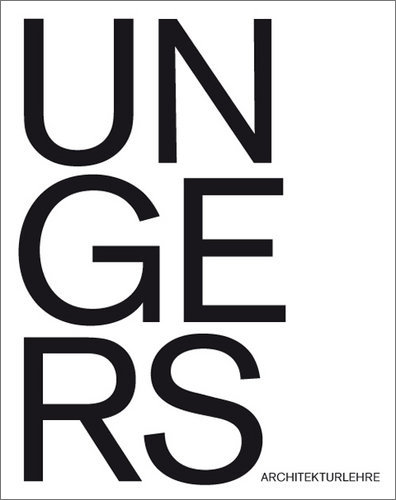Übersicht
Bauwerke
Artikel 12
Oswalt Mathias Ungers (1926-2007)
In den Nachrufen der Tageszeitungen wurden das Lebenswerk des Kölner Baumeisters, seine Sammelleidenschaft, seine Verdienste als Lehrer und auch sein lebenslanger Widerstand gegen die jeweils angesagten Trends hinreichend kommentiert. Nicht aber seine letzte Arbeit in Trier.
In den Nachrufen der Tageszeitungen wurden das Lebenswerk des Kölner Baumeisters, seine Sammelleidenschaft, seine Verdienste als Lehrer und auch sein lebenslanger Widerstand gegen die jeweils angesagten Trends hinreichend kommentiert. Nicht aber seine letzte Arbeit in Trier.
Vollständigen Artikel anssehen ![]()
verknüpfte Zeitschriften
Bauwelt 2007|40-41 Krankenhäuser
Rationalist der Architektur
Stilübungen oder Metaphorik waren nie die Sache von Oswald Mathias Ungers. Der deutsche Architekt erstrebte mit seinen Bauten keine Interpretation, die...
Stilübungen oder Metaphorik waren nie die Sache von Oswald Mathias Ungers. Der deutsche Architekt erstrebte mit seinen Bauten keine Interpretation, die...
Stilübungen oder Metaphorik waren nie die Sache von Oswald Mathias Ungers. Der deutsche Architekt erstrebte mit seinen Bauten keine Interpretation, die über die angelegte Raumordnung und ihre Funktion hinauswies. In der Konsequenz dieses Ansatzes wurde die elementare Form – Quadrat, Kubus, Kreis und rechter Winkel – zur konstruktiven Leitfigur des Architekten. So manifestiert sich in Ungers' Werken eine ästhetische Radikalität, die zu seinem – nicht unumstrittenen – Markenzeichen wurde.
Ungers, geboren 1926 in der Eifel, studierte in Karlsruhe bei Egon Eiermann und war selbst zeitlebens nicht nur Architekt, sondern auch Lehrer. So weist das Schaffen von Ungers, der zu den international einflussreichsten deutschen Architekten der Nachkriegszeit zählt, in der Lebensmitte eine ungewöhnlich lange baufreie Phase auf, in der er sich intensiv der Architekturtheorie widmete. 1977 erschien die – gemeinsam mit Rem Koolhaas und Hans Kollhoff – erarbeitete Studie «Die Stadt in der Stadt – Berlin, das grüne Städtearchipel», in der Ungers seinen massgebenden Begriff der dialektischen Metropole entwickelte. Dieser überlagerte die gegensätzlichen Entwürfe von Le Corbusier und Guy Debord in einem Grossstadt-Modell, das nicht auf eine Idealvorstellung abzielt, sondern die Identität einer Stadt in vielfachen Qualitäten sucht, um «eine Erhaltung und Verdeutlichung» zu rechtfertigen.
Vor allem an Ungers' berühmten Museumsbauten – dem Kölner Wallraf-Richartz-Museum (1975), dem Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt (1979–1984) und der Erweiterung der Hamburger Kunsthalle (1996) – lässt sich ablesen, wie der Baumeister im Spannungsfeld von räumlichen Ordnungsmustern und deren Brechung seine Idee von Architektur herausbildete. Ungers propagierte den interdisziplinären Ansatz in der Architektur. Allerdings darf man seinen Weg des Fächerübergreifenden durchaus als puristisch bezeichnen, da er in klassizistischer Rückbesinnung vor allem den gemeinsamen Wurzeln von Kunst und Architektur nachspürte. Die «soziale Frage» der Architektur hat Ungers, der Ende der sechziger Jahre deswegen von den Berliner Studenten heftig angegriffen wurde, denn auch lieber anderen überlassen. Er wollte den künstlerischen Rang der Architektur verteidigen und ihren überzeitlichen Geltungsdrang.
Über die Berliner Neue Nationalgalerie von Ludwig Mies van der Rohe schrieb Ungers einmal: «Es ist die Botschaft der Architektur als reine Kunst, als ein in sich abgeschlossenes Werk, losgelöst von aller Realität. Ein Ort, auf sich selbst bezogen. Eine geistige Akropolis, befreit von allen Zwängen und Niederungen der realen Welt.» Zeitlebens hatte er nicht weniger als die Unsterblichkeit der Baukunst im Blick. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Oswald Mathias Ungers am 30. September im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben.
Studenten-Unruhen
ANRISSE – Gespräch mit dem Dekan der Fakultät für Architektur, O.M. Ungers
ANRISSE – Gespräch mit dem Dekan der Fakultät für Architektur, O.M. Ungers
ANRISSE: Eine provokative These besagt, die starke Solidarisierung besonders seitens der TU-Studentenschaft mit den Trägern und Teilnehmern der Demonstration vom 2.6. sei unter anderem darauf zurückzuführen, daß infolge der günstigen örtlichen Gelegenheiten viele TU-Studenten ihr Informationsbedürfnis befriedigen wollten, und dabei in die von der Polizei offensichtlich gesuchte Konfrontation geraten seien – was stimmt daran?
O.M.Ungers: Das Motiv der Neugier mag einige Studenten bewogen haben, an der Demonstration am 2. Juni teilzunehmen. Teilweise war es Informationsbedürfnis und – auch das läßt sich nicht ausschließen – eine gewisse Sensationslust. Die informationsbedürftigen, die neugierigen und sensationshungrigen Studenten waren jedoch in der Minderzahl. Der weitaus größte Teil beteiligte sich nach meinen Beobachtungen an der Demonstration aus einem politischen Engagement heraus. Man kann diesen politisch engagierten Studenten nicht ohne weiteres Mitläufertum oder gar blinde Abhängigkeit von kleineren sogenannten radikalen Gruppen vorwerfen. Ein solcher Vorwurf ist zu billig und verkennt die kritische Wachsamkeit und politische Hellhörigkeit der meisten Studenten. Außerdem muß in einer freien Gesellschaftsordnung auch der Einfluß selbst extremer Gruppen hingenommen werden, so lange nicht die Grundregeln der Gesellschaft verletzt werden.
Die in der Demonstration gezeigte politische Haltung wandte sich einerseits gegen einen Herrscher, der sein Volk mit diktatorischen Methoden regiert, wie in durchaus substantiierten, von den Studenten verfaßten Berichten nachgewiesen wurde, und andererseits gegen die in diesem Fall gewiß übertriebene Form eines Staatsbesuchs. Beides mußte zu Protesten herausfordern.
Wie ich mich selbst überzeugen konnte, hat die Polizei durch bewußte Provokation, wie beispielsweise das Einfahren der sogenannten Jubelperser vor die Oper – die später auch als Schläger auf die Studenten losgelassen wurden – die Konfrontation gesucht. Man hatte den Eindruck, hier sollte in einer Denkzettelaktion ein abschreckendes Exempel statuiert werden.
ANRISSE: Was bewirkte die Bewußtseinsänderung auch in der Professorenschaft, die diese veranlaßte, sich institutionell – durch Erklärung des Akademischen Senats – wie auch personell – durch Ansprachen von der versammelten Studentenschaft – mit dem studentischen Aufbegehren gegen das Vorgehen der Polizei wie gegen das dieses Vorgehen deckende politische Verhalten der Exekutive solidarisch zu erklären?
O.M.Ungers: Man darf hier nicht von einer Bewußtseinsänderung in der Professorenschaft sprechen. Einer solchen hat es im einzelnen nicht bedurft. Es ist selbstverständlich für jedermann - und nicht nur für Professoren – daß man sich gegen brutale Gewaltanwendung und Menschenmißhandlung wendet. Diese Symptome ließ das Verhalten der Polizei gegenüber den demonstrierenden Studenten vor der Oper am 2. Juni 67 erkennen. Eine Solidaritätserklärung ist deshalb nicht eine Frage der Gruppenzugehörigkeit noch der Zivilcourage, sondern ganz einfach eine notwendige ethische Haltung innerhalb einer demokratischen Gesellschaftsordnung.
ANRISSE: Spätestens seit der SPIEGEL-Affäre wissen wir, daß der Bestand einer demokratisch-republikanischen Verfassung noch nicht unbedingte Gewähr für die Kongruenz von Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit verbürgt. Korrektive bei ihrem Auseinanderklaffen wären zunächst die etablierte Opposition, sodann die Öffentlichkeit, sprich Presse. Ist der Studentenprotest nicht Anmaßung?
O.M.Ungers: Verfolgt man aufmerksam die Entscheidungen der politischen Gremien, so ist man nicht nur enttäuscht über deren Wirkungslosigkeit. Mit Besorgnis stellt man fest, daß immer mehr politische Tabus entstehen und sich allmählich eine Erstarrung der politischen Aktivität ausbreitet, die zu katastrophalen Auswirkungen führen kann. Ein kritischer Protest gegen die Selbstherrlichkeit und Selbstgenügsamkeit politischer Instanzen, von welcher Seite auch immer, ist ein unbedingt notwendiges Korrektiv und für die Existenz einer demokratischen Gesellschaftsordnung lebenswichtig. Gerade wenn ein Großteil der öffentlichen Institutionen als kritischer Partner versagt, wie das besonders in unserer unmittelbaren Umgebung der Fall zu sein scheint, ist es nicht Anmaßung, sondern Verpflichtung der Studenten, zu protestieren. Hieraus sollte man jedoch nicht einen Selbstzweck ableiten. Ein Protest, der ohne Inhalt und Form vorgetragen wird, ist sinnlos. Den Studenten muß man sowohl die Berechtigung als auch die Möglichkeit zugestehen, den Weg des Protests als ein legitimes politisches Mittel zu wählen.
ANRISSE: Churchill soll einmal gesagt haben: Wer mit zwanzig nicht Sozialist ist, hat kein Herz, wer es mit dreißig noch ist, keinen Verstand. Viele loben das jugendlich-moralische Engagement des Studenten, noch mehr tadeln jedoch die einseitige politische Richtung, in welcher es sich manifestiert. Wo sehen Sie das Hauptmotiv für die Bereitschaft, sich politisch zu engagieren?
Zu allen Zeiten hatten die Hochschulen begrenzten Ausschnittcharakter, in der sich die verschiedenen geistigen Strömungen der Gesellschaft widerspiegeln. Insofern ist die Hochschule zwangsläufig auch politisch. Desinteresse, Lethargie, Unengagiertheit sind genausogut, wenn auch nur negative, politische Verhaltensweisen wie das Umgekehrte. Das Unbehagen an bestehenden Zuständen in den Hochschulen, wie auch in der Gesellschaft, ist eines der Motive für das politische Engagement des Akademikers. Das andere, unmittelbar damit zusammenhängende ist das Gefühl des Nichtverstandenwerdens in einer Institution, die den veränderten Verhältnissen (Massenprobleme) nicht voll gerecht wird und die man deshalb zu reformieren wünscht. Je größer das Mißverhältnis zwischen Hochschule und Student wird, umso mehr wird er in eine extreme Haltung gedrängt. In seiner Rolle als dem unmittelbar Betroffenen liegt das politische Engagement, das durchaus legitim ist.
ANRISSE: Der Student sieht sich zwei Forderungen gegenüber: 1 „Die Distanzierung von der Linken muß endlich aufhören!“ (E. Krippendorf am 24.1.67 im HE 101). 2 „Es gibt eine Grenze für die politische Betätigung, wo die demokratische Toleranz aufhört…“ (sinngemäß W. Tromp am 12.6.67 im EB 301). Der heutige Student, wehrfähig ab 18, beansprucht politische Mündigkeit. Hat er im Universitätsbereich genügend Spielraum zur Entwicklung eines autonomen politischen Urteils?
O.M.Ungers: Wenn die Universität Modellcharakter hat und haben soll, darf der Spielraum für die Entwicklung eines autonomen politischen Urteils nicht mehr eingeschränkt sein als auch in der übrigen Gesellschaft. Die Forderung nach einer Distanzierung von der sogenannten Linken bedeutet letzten Endes eine politische Reglementierung; es ist deshalb ein nicht zu vertretender Standpunkt. Es wird allzu leicht verkannt, daß unsere Gesellschaft gezwungen ist, in einem ständigen Konflikt zu leben, der sich realiter nicht beseitigen lässt und auch nicht beseitigt werden sollte, am allerwenigsten durch Maßnahmen, die auf einer Ideologie basieren.
ANRISSE: Welche Möglichkeiten und Wege sehen Sie, den akademischen Nachwuchs auf den verschiedenen Ausbildungsstufen verantwortlich an der kontinuierlichen Ausgestaltung einer Universität der Zukunft zu beteiligen? Konkret: Läßt sich durch vorwegnehmende Zugeständnisse an die Studentenund Assistentenschaft eine Zuspitzung der Interessengegensätze zwischen Studenten und Professoren im Sinne eines syndikalischen Selbstverständnisses umgehen?
O.M.Ungers: Aus meiner Sicht möchte ich drei Reformmöglichkeiten nennen: 1 die pragmatische Reform, 2 die diktierte Reform und 3 die gewaltsame Veränderung. Der pragmatische Weg kann mit Professoren und Studenten gemeinsam begangen werden.
Er bringt wertvolle Erfahrungen und Ergebnisse im einzelnen, die exemplarische Auswirkungen haben und so allmählich eine Umstrukturierung der Institution zur Folge haben können. Dieser Weg ist langwierig, aber aussichtsreich, und von großer Effizienz. Es verlangt die Bereitschaft zur Kooperation und vor allem Verständnis auf beiden Seiten. Es ist eine Art Reform von innen heraus. Hiermit ist nicht gemeint eine einseitige Kompromissbereitschaft oder ein Überspielen der aufgetretenen Spannungen.
Als zweites ergibt sich die Möglichkeit einer geplanten, von außerhalb stehenden Instanzen vorgeschriebenen Reform. Hierbei lassen sich, was den allgemeinen Status anbetrifft, relativ schnell Veränderungen erzielen. Zu weitgehende Vorschriften jedoch führen zu Verfahrensstreitigkeiten und Kompetenzschwierigkeiten und schließlich zur Blockierung jeglicher Reformbewegung. Gleichzeitig liegt aber in der geplanten Reform die Gefahr einer diktierten Reform. Endprodukt einer solchen Entwicklung ist eine Staatsuniversität, die in allen Einzelheiten reglementiert und bis ins Kleinste gesteuert wird, vielleicht funktionstüchtig, aber aus Gründen der freiheitlichen geistigen Existenz indiskutabel.
Eine dritte Reformmöglichkeit liegt in der gewaltsamen Veränderung mit den Mitteln einer offenen Revolte. Der Gedanke, unbrauchbare Einrichtungen abzuschaffen, um neuen Platz zu machen, ist in der Geschichte auf allen Ebenen – Natur, Religion, Kunst, Technik, Politik – nicht unbekannt. Es war oft – wie die Beispiele zeigen – der einzig wirkungsvolle Weg. Ein gewaltsamer Umbruch ist aber erst dann möglich und sinnvoll, wenn Ziele und Strategie zumindest den Initatoren bekannt sind und wenn feststeht, daß alle anderen Mittel zur Durchsetzung der Forderungen versagt haben. Zielloses Revoltieren, Revolte um ihrer selbst willen, ist Nonsens, romantische Stenka-Rasin-Mentalität und unverantwortliches Indianerspiel. Daß reformiert werden muß, ist allen wirklich Beteiligten klar. Der einzig richtige Weg läßt sich schwer benennen. Man sollte eine Reform nicht allzu abstrakt sehen, weil man sonst Gefahr läuft, das Eigentliche aus dem Auge zu verlieren. Faktische und rationelle Gründe sprechen dafür, daß eine modifizierte abgestufte Reform die wirkungsvollste ist.
verknüpfte Zeitschriften
archplus 181/182 Lernen von O. M. Ungers
Profil
Publikationen
Die Thematisierung der Architektur, Deutsches Institut für Stadtbaukunst, Walter A. Noebel, niggli
O. M. Ungers Architekturlehre, Redaktion ARCH+, ARCH+ Verlag GmbH
werk, bauen + wohnen, , Verlag Werk AG
ARCH+, Sabine Kraft, Nikolaus Kuhnert, Günther Uhlig, ARCH+ Verlag GmbH
O. M. Ungers, Andres Lepik, Hatje Cantz Verlag
ARCH+, Sabine Kraft, Nikolaus Kuhnert, Günther Uhlig, ARCH+ Verlag GmbH