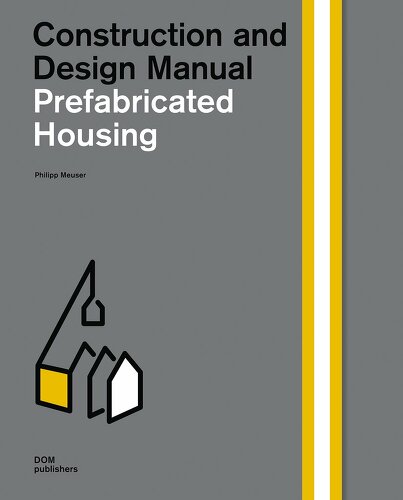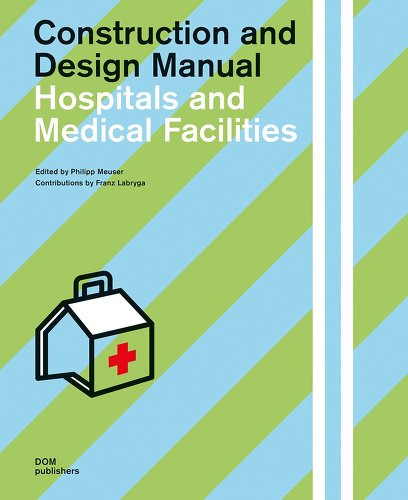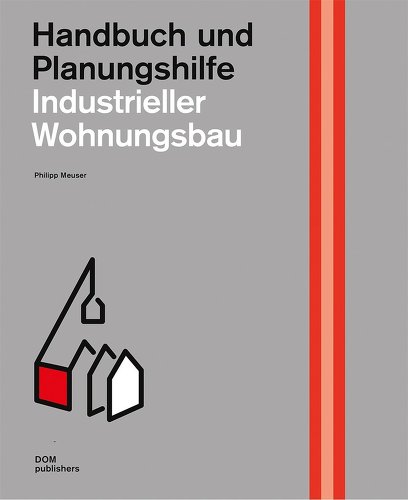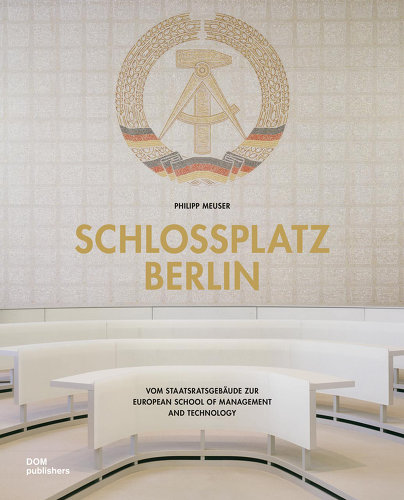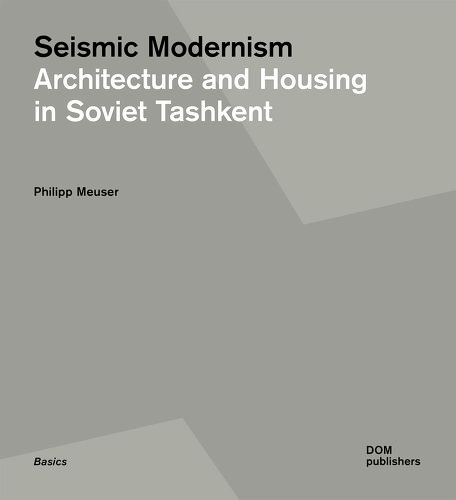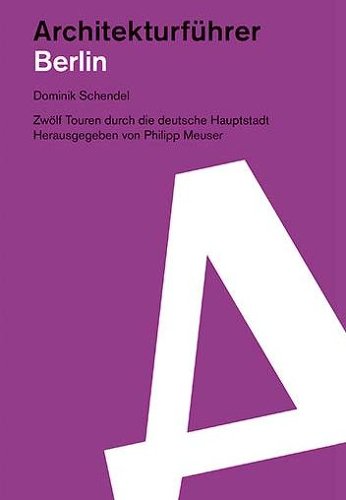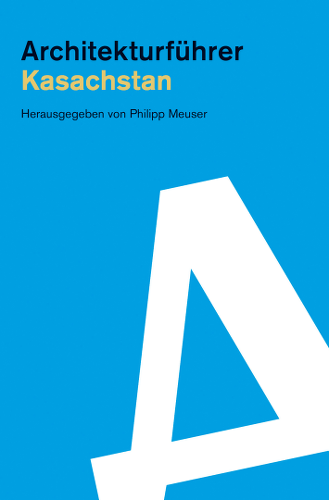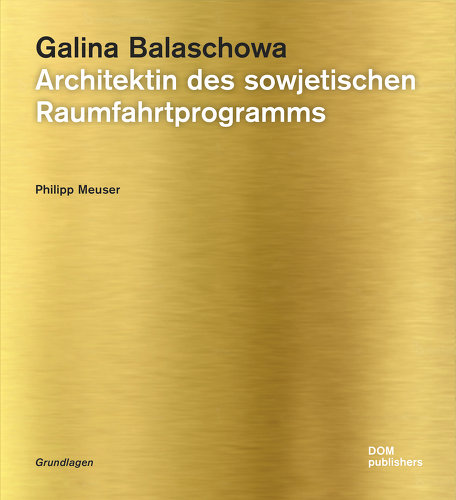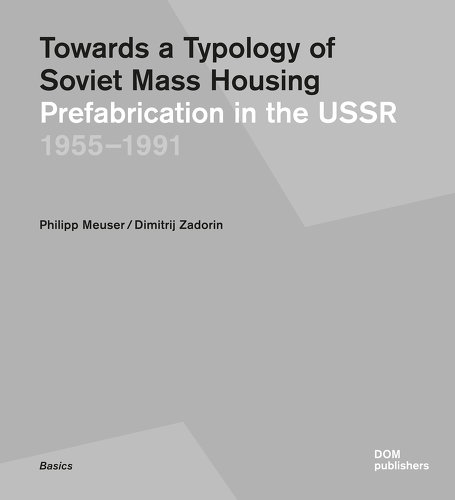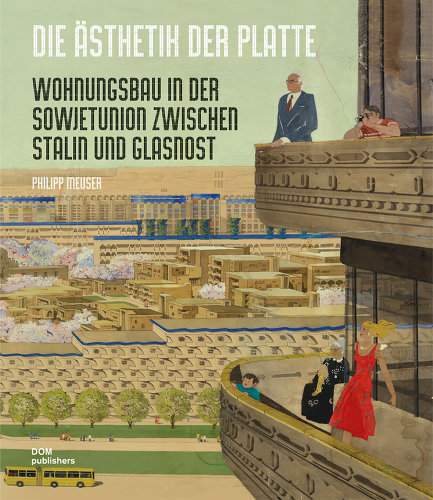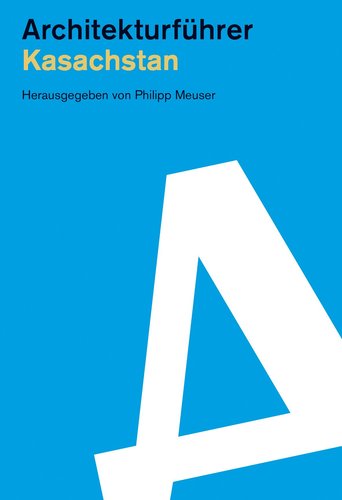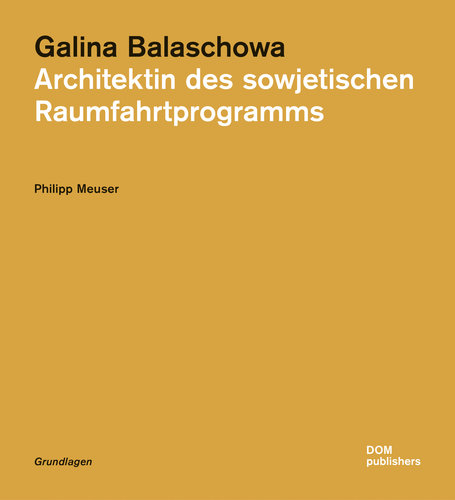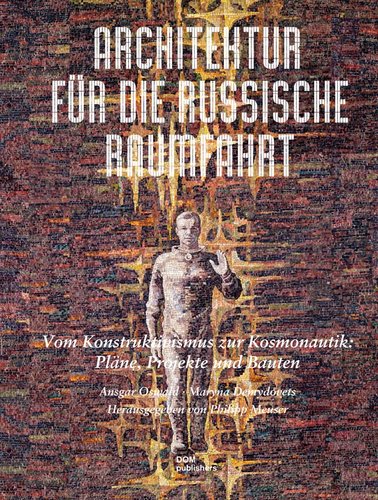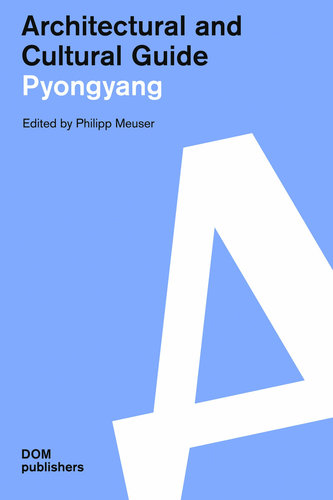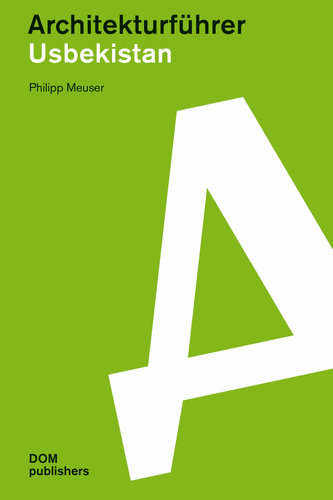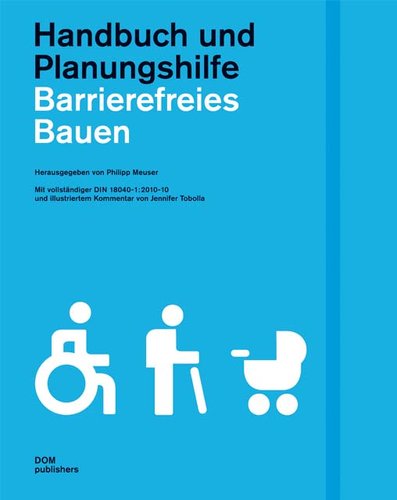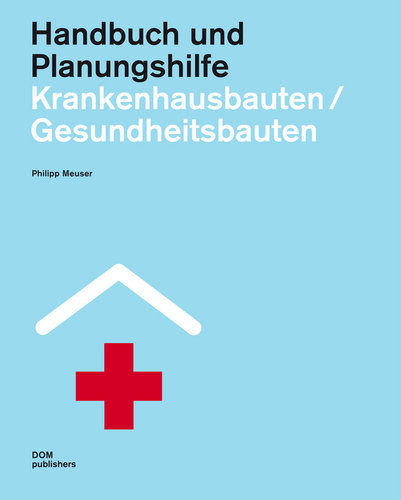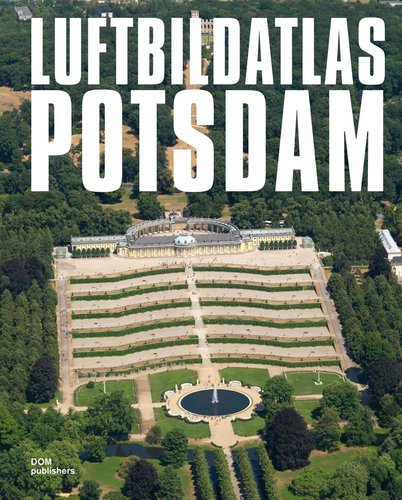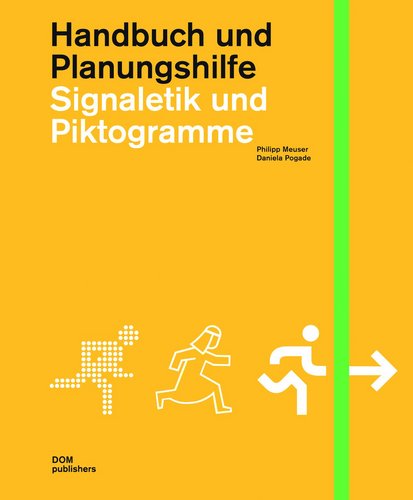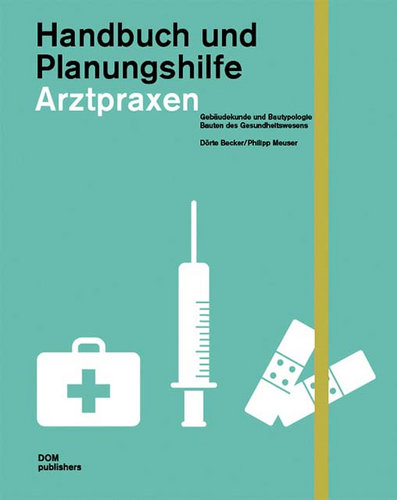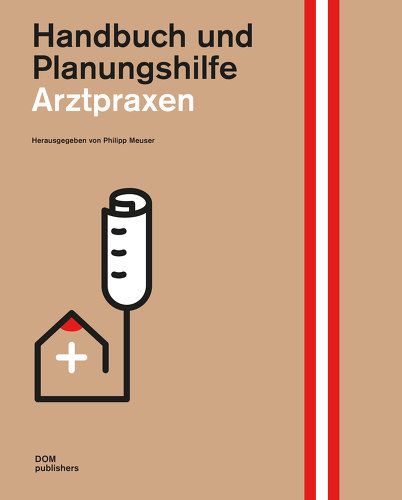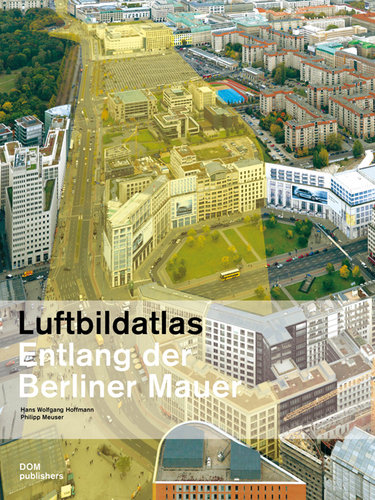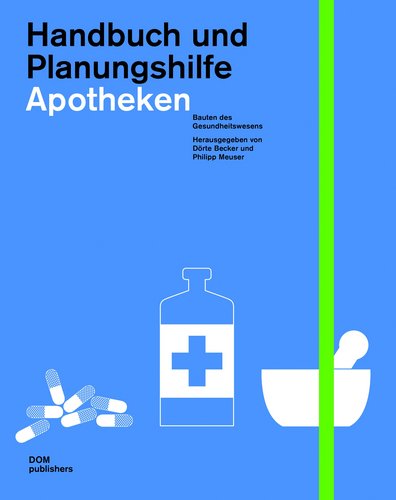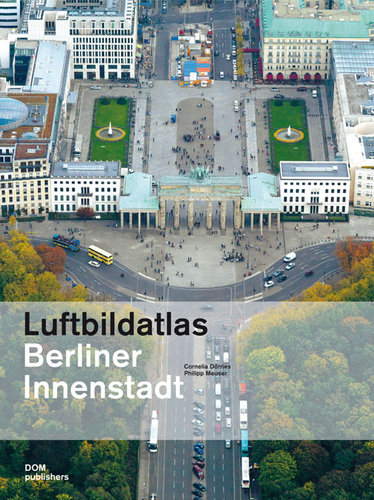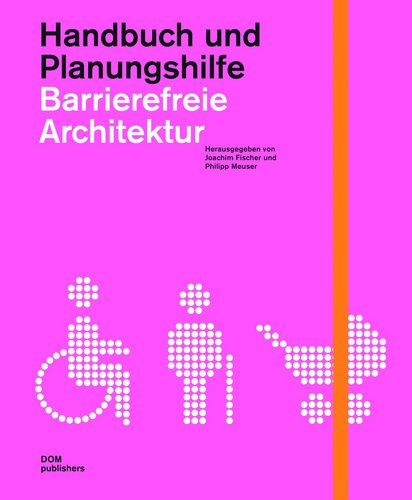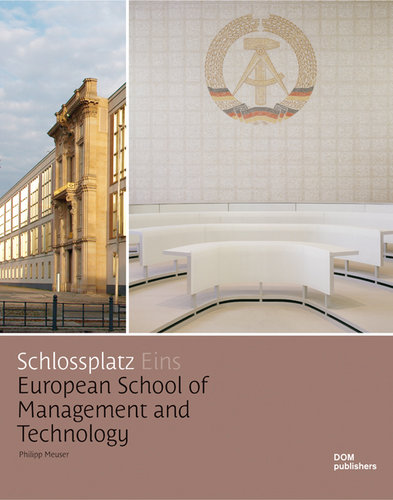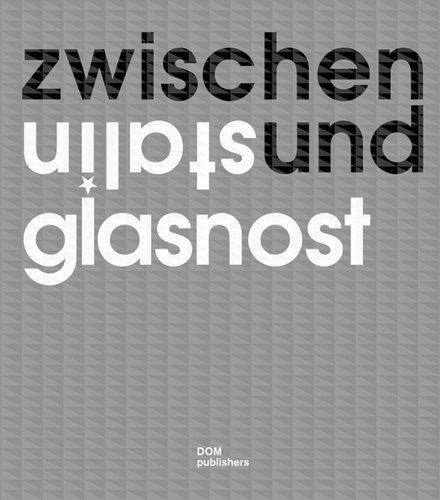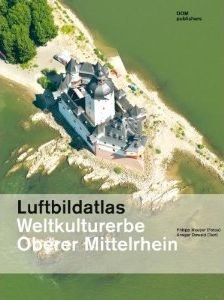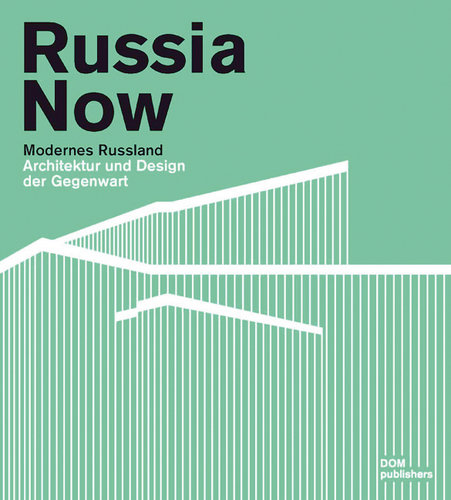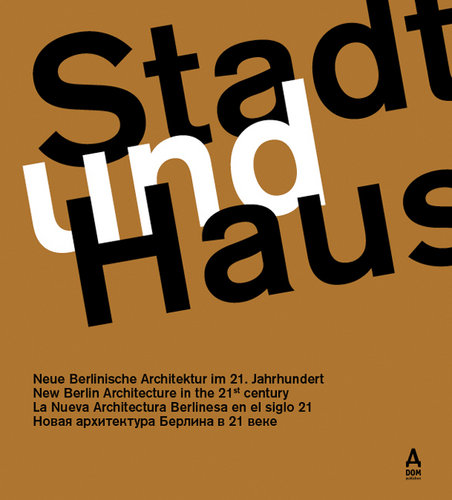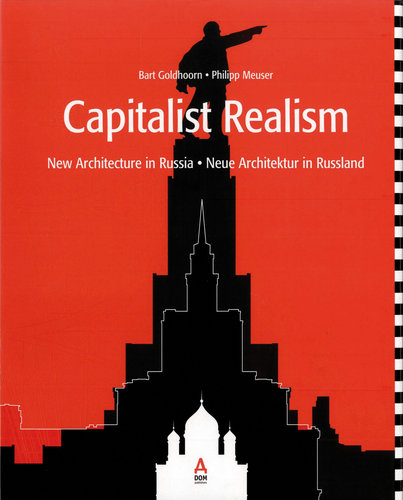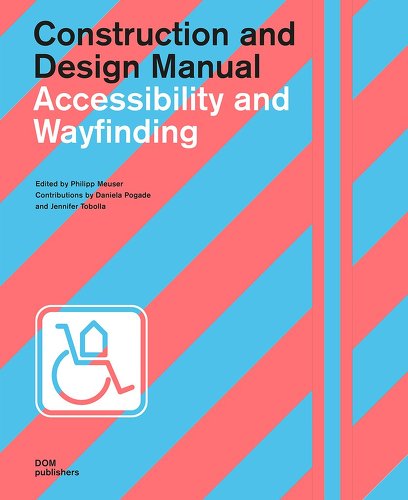Ein neuer Masterplan für die afghanische Hauptstadt
Die gegenwärtige politische Grosswetterlage mit drohendem Irak-Krieg und nur teilweise erfolgreicher Terrorismusbekämpfung im Hindukusch wirkt sich negativ auf Wiederaufbauhilfe in Afghanistan aus. Erst kürzlich beklagte sich der afghanische Aussenminister Abdullah Abdullah darüber, dass in anderen ehemaligen Bürgerkriegsregionen - etwa Rwanda, Kosovo oder Osttimor - pro Einwohner und Jahr durchschnittlich 250 Dollar an Hilfsgeldern zur Verfügung stünden, während in Afghanistan diese Zahl nur rund 60 Dollar betrage. Doch ohne verstärkte internationale Finanzhilfe drohten seinem Land neben ethnischen Konflikten auch soziale Spannungen, die eine Rückkehr zur Normalität behinderten. Etwas Hoffnung verbreiten die über 200 Nichtregierungsorganisationen (NGO), die sich inzwischen bei den Ministerien haben registrieren lassen, um mit Arbeit vor Ort zu helfen.
Unwirtliche Trümmerfelder
Wenn Mirajan Sahebi durch den immer dichter werdenden Verkehr von Kabul fährt, lässt ihn die Erinnerung an die Vergangenheit nicht los. Vor zehn Jahren stand der afghanische Geschäftsmann, der nach dem Einmarsch der Mujahedin 1992 seine Handelsgeschäfte im Ausland fortsetzen musste, das letzte Mal an der Strasse zum ehemaligen Königspalast. Damals, so weiss er zu erzählen, spielten hier unzählige Kinder. Sie suchten im Schatten der Bäume Schutz vor der Sonne oder versteckten sich im Garten des für seine Sammlung zentralasiatischer Kunst bekannten Kabul-Museums. Doch vom einstigen Idyll ist nichts geblieben. Der Stadtteil in Sichtweite des Darulaman-Palastes gleicht einem Trümmerfeld. Kein Haus hat sein Dach, geschweige denn seine Fenster behalten. Meist ragen nur noch Wände in den Himmel; und von den Bäumen am Strassenrand sind nur abgebrannte Stümpfe geblieben. Trotzdem hat der Bürgerkrieg hier im Süden Kabuls weniger gewütet als in Sahebis Heimatdorf im Westen Afghanistans: Dort überstand kein einziges Haus die Angriffe der Taliban.
In seinem frisch renovierten Haus im Kabuler Diplomatenviertel Wazir Akbar Khan hat der studierte Geologe ein knappes Dutzend Geschäftspartner versammelt: zwei Architekten aus dem usbekischen Taschkent, einen Bauingenieur aus der Türkei, einen Techniker aus dem pakistanischen Peshawar und Bekannte aus allen Landesteilen. Die Ausländer sind zum ersten Mal in Sahebis Haus, einem modernen Bungalow aus den sechziger Jahren. Dieser überstand den Bürgerkrieg und die Taliban-Diktatur wie durch ein Wunder ohne Schäden. Mit seinem betont europäischen Erscheinungsbild muss der Bau einst ebenso fremd gewirkt haben wie heute die Satellitenanlage, die Sahebi gerade installieren liess. Weil Natels nur eingeschränkt funktionieren und das Telefonnetz zeitweise ausfällt, ist die Anlage mit ihren 120 TV-Programmen die einzige zuverlässige Verbindung zur Aussenwelt.
Ein Masterplan zu Neujahr
Seit dem Einzug der internationalen Schutztruppen kehrt der Alltag zurück. Auf den Basaren werden wieder Produkte aus Pakistan angeboten, die Strassen im Zentrum sind nach Sonnenuntergang nicht mehr nur mit patrouillierenden Soldaten, sondern auch mit Passanten gefüllt, und überall zeugen Baustellen von der ungebrochenen Zuversicht hinsichtlich einer friedlichen Zukunft - auf die auch Sahebis Gäste hoffen. Denn sie sind nach Kabul gekommen, um hier an der ersten internationalen Wiederaufbaukonferenz teilzunehmen, zu der das Ministerium für Stadtentwicklung und Wohnungsbau knapp 200 Stadtplaner und Architekten aus 25 Ländern eingeladen hat.
Im Mittelpunkt der Tagung steht eine Diskussion über den neuen Masterplan, der in Kürze vorgelegt werden soll. Dafür hat Wiederaufbauminister Yousuf Pashtun den Karlsruher Städtebauprofessor und Exil-Afghanen Abdullah Breshna verpflichtet, der in seiner Heimatstadt den Abstimmungsprozess für den ersten Generalplan seit dem Einmarsch der Sowjets 1979 koordinieren soll. Breshna hat sich etwas vorgenommen, was in einer zur Hälfte zerstörten Stadt wie Kabul schier unmöglich erscheint. Der grauhaarige Professor, der wie Sahebi über zehn Jahre nicht mehr in seiner Heimat war, soll einen Plan erarbeiten, der Nothilfe und Kulturschutz zugleich ist. Einerseits gilt es, für den Alltag der Bevölkerung ein Wasser-, Strom- und Kommunikationssystem aufzubauen; anderseits muss der Masterplan aber auch eine Vision für die Zukunft der Stadt, ja eine Art Identifikation für alle Hauptstädter darstellen. Doch ist das in einer Gesellschaft, in der Frauen lange Zeit aus dem öffentlichen Leben verbannt, Cafés geschlossen und unterhaltende Radiosendungen durch religiöse Reden ersetzt waren, innerhalb eines Jahres möglich? Auch die Konferenz kann diese Frage kaum beantworten.
Stattdessen stellen Exil-Afghanen ihre Vorstellungen von einem zukünftigen Kabul vor, reden von einem mehrspurigen Autobahnring, der um die Zweimillionenstadt herum geführt werden soll. Ein Verkehrsexperte aus den USA referiert über den Sinn einer angemessenen Gestaltung von Autobahnabfahrten. Die Höflichkeit gebietet es den Gastgebern, zu den Vorschlägen freundlich zu nicken, wohl wissend, dass es sich doch eher um Luxusprobleme handelt. Wer das alles zahle, erkundigen sie sich immer wieder. So bleibt das Ergebnis der Konferenz ein offener Fragenkatalog, der eine mögliche Stadtentwicklung vorzeichnet und quasi nebenbei zu einer Art rotem Faden des neuen Masterplans avanciert.
Eine Diskussion kommt erst auf, als es um das bauliche Erbe Afghanistans geht. Zwei Themen stehen hier im Vordergrund: Wie erhaltenswert sind die Überreste der Denkmäler, und lassen sie sich überhaupt wieder aufbauen? Und wie kann man die Altstadt Kabuls vor anonymen Bürobauten bewahren? Während die Experten den Wiederaufbau des Königspalastes und des Kabul- Museums im Konsens erörtern, trifft die Debatte über den Erhalt der Altstadt zunächst auf Unverständnis. Warum sollten zufällig gewachsene Strukturen ohne Anschluss an die Kanalisation erhalten werden? Ohnehin sei nicht klar, wo die Altstadt anfange und wo sie aufhöre. Den Nerv trifft die Diskussion, als es um die bedeutenden Denkmäler in der Altstadt geht. Welche Strategie könne man verfolgen, fragt ein indischer Bauhistoriker, um die Monumente von illegal errichteten Wohnbauten zu befreien? Die Vertreter des Ministeriums nehmen die Frage interessiert entgegen, wissen aber nicht, wie sie ihren Landsleuten plausibel machen könnten, Wohnraum einer denkmalpflegerischen Idee zu opfern.
Auch die unkontrolliert entstandenen Siedlungen stehen auf der Tagesordnung: Überall in Kabul prägen die eingeschossigen Hofhäuser, die sich treppenartig immer höher um die baumlosen Hügel gelegt haben, das Stadtbild. Auch wenn einzelne Fassaden inzwischen einen farbenfrohen Anstrich aufweisen, bleiben die hygienischen Verhältnisse katastrophal. Viele Siedlungen verfügen weder über Wasserversorgung noch über Kanalisation. Kinder schöpfen zweimal am Tag Wasser aus den öffentlichen Brunnen, um es in Kanistern ins Elternhaus zu tragen. Vehement setzt sich eine Konferenzteilnehmerin dafür ein, die Spontanbehausungen in die Stadtstruktur zu integrieren und lebenswerter zu gestalten, statt die Bewohner in anonyme Viertel umzusiedeln.
Selbsthilfe
Überall in Kabul zeugen grosse Schilder von der Wiederaufbauhilfe ausländischer Organisationen. Alle öffentlichen Baustellen tragen das Logo mindestens einer internationalen Institution auf ihren Bauschildern. Die Mehrzahl der Projekte - von Kindergärten über Schulen bis zu Krankenhäusern - werden im Rahmen der Nothilfe realisiert, wodurch Antragsfristen und lange Genehmigungsphasen vermieden werden können. Doch Mirajan Sahebi will nicht nur auf die Hilfe von aussen bauen. Er hat damit begonnen, Baustoffe aus Usbekistan zu importieren. Auch denkt er darüber nach, eine stillgelegte Kalksandsteinfabrik in Deutschland zu kaufen und sie in Afghanistan wiederaufzubauen. Das Grundstück für die neue Produktion stellt ihm sein Cousin zur Verfügung: eine alte Lkw-Fabrik, die im Bürgerkrieg besonders heftig beschossen wurde. Auch das gehört zum Alltag einer wieder erwachenden Metropole.
Neue Zürcher Zeitung, Fr., 2003.01.31
![]()