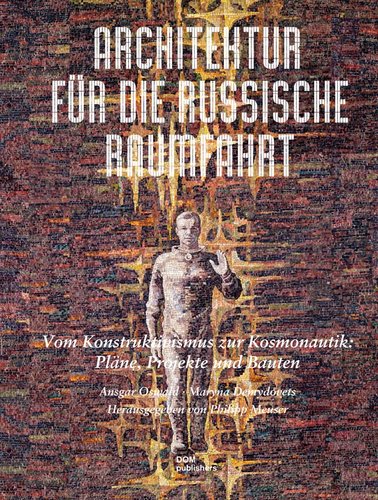In der Sowjetunion genossen die Raumfahrt und die mit ihr verbundene Raketentechnik oberste Priorität. Denn mit dem Start des ersten künstlichen Erdsatelliten Sputnik im Jahr 1957 und mehr noch mit dem ersten bemannten Raumflug durch Juri Gagarin vier Jahre später erreichte der Kalte Krieg eine neue Stufe: Es begann ein Wettstreit beider politischer Systeme um die Vorherrschaft im Weltraum, galt doch die Raumfahrt als Maßstab für gesellschaftliche Leistungsfähigkeit und Fortschrittlichkeit.
Doch neben den militärischen und politischen Aspekten stand auch der bis in die Antike zurückreichende Traum der Menschheit von der Überwindung der räumlichen Grenzen, der Eroberung des Himmels. Diese Sehnsucht schien nun Wirklichkeit zu werden. Die beispiellose Weltraumbegeisterung der kosmischen Ära zeigt sich auch im futuristischen Formenvokabular der sowjetischen Baukunst, in den Utopien der sogenannten Papierarchitekten – und in den Bauten für die sowjetische Raumfahrt in Baikonur, Kaluga oder den geschlossenen Städten bei Moskau.
Die Autoren haben einst als geheim eingestufte Materialien zur Raumfahrtarchitektur recherchiert, darunter den Plan der ersten jemals konzipierten Weltraumstadt, sowie erstmals autorisierte Zeitzeugenberichte gesammelt: Zu Wort kommen nicht nur Akteure der sowjetischen Raumfahrt, sondern auch Architekten wie etwa Viktor Asse, der Planer des bis zum Zerfall der Sowjetunion geheimen Sternenstädtchens, und Galina Balaschowa, die Innenarchitektin sowjetischer Raumkapseln.