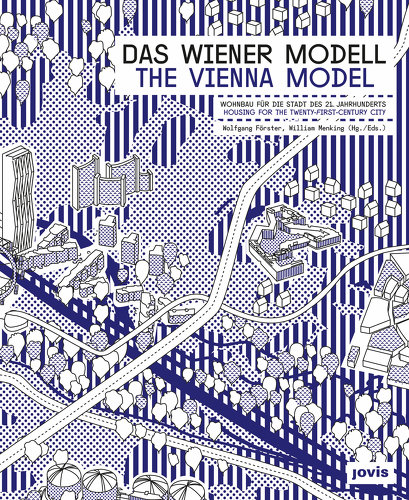Auf Basis urbanistischer und sozialer Aspekte entstanden in Wien nicht nur neue Wohnbauprojekte mit herausragenden Qualitäten, sondern auch Quartiersrevitalisierungen und neue Stadtteile. Diese Konzepte gehen historisch auf das „Rote Wien“ zurück und stehen für aktuelle dynamische Möglichkeiten, durch das Schaffen modellhafter Lebensumfelder die Lebensqualität in einer zeitgemäßen Metropole zu erhöhen.
Das Wiener Modell. Wohnbau für die Stadt des 21. Jahrhunderts rückt 60 typische Projekte der vergangenen 100 Jahre in den Mittelpunkt und legt zudem einen Fokus auf Kunst im öffentlichen Raum, die seit der Ersten Republik den städtischen Wohnbau komplettiert. Etwa 300 Abbildungen und begleitende Texte vermitteln einen Überblick über das „Wiener Modell“.