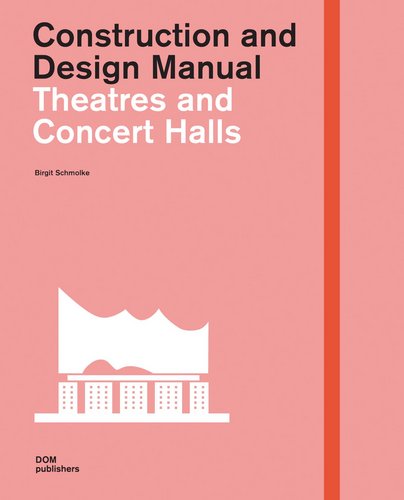Dieses Handbuch präsentiert die 50 besten Theaterbauten und Konzerthäuser, die in der jüngsten Vergangenheit in Europa entstanden sind. Spektakuläre Gebäude der Pritzker-Preisträger Zaha Hadid, Jean Nouvel, Herzog & de Meuron, Christian de Portzamparc und Rem Koolhaas sind ebenso vertreten wie Bauten der internationalen Stars UNStudio /Ben van Berkel, Dominique Perrault und Santiago Calatrava. Das neue Standardwerk zur zeitgenössischen Bühnenarchitektur mit umfassenden Zeichnungen und theoretischen Beiträgen zum Entwurf wird komplettiert durch kenntnisreiche Essays namhafter Koautoren wie Christian Bartenbach (Lichtgestaltung), Jürg Jecklin (Akustik) und Karl Habermann (Architekturkritik).