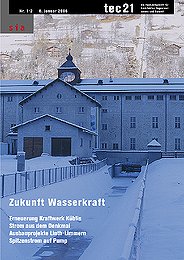Inhalt
Erneuerung Kraftwerk Küblis
Remo Baumann, Aldo Rota
Im Kraftwerk Küblis, einer der ersten Hochdruckanlagen Graubündens, wird umgebaut. Nach achtzig Jahren machte die Neukonzessionierung eine umfassende Erneuerung der elektromechanischen Ausrüstung nötig.
Kraftwerkzentrale Küblis – ein Zeitzeuge
Cordula Seger
Büros statt Trafos: In Küblis bleibt eine «Kathedrale der Elektrifizierung» erhalten, obwohl die neuen Maschinen viel weniger Platz brauchen. Nicolaus Hartmanns Architektur wird zur Corporate Identity für Raetia Energie.
Ausbauprojekte Linth-Limmern
Aldo Rota
Nachfrageschwankungen, hohe Strompreise und die Europäisierung des Strommarkts machen Pumpspeicherwerke immer attraktiver. Vergleichsweise weit fortgeschritten ist das Ausbauprojekt Linth-Limmern im Glarnerland.
Spitzenstrom auf Pump
Hanspeter Guggenbühl
Die Renaissance von Projekten für Wasserkraftwerke mit Pumpspeicherung ist umstritten. Es geht um den Zielkonflikt zwischen dem Verlust an Energiemenge und dem Gewinn von Spitzenleistung.
Wettbewerbe
Neue Ausschreibungen und Preise | Auch Interlaken baut sein Kongresszentrum aus | Zweiter Wettbewerb für die Universität
Luzern: Das Postbetriebsgebäude hinter dem KKL soll umgebaut werden
Magazin
Singendes und kalbendes Eis – Leben in der Kryosphäre | Flussökologische Defizite durch Abflussschwankungen | Innovation – mehr als der zündende Funke
Aus dem SIA
holz21: reiche Ernte für neue Ideen zum Werkstoff Holz | Z-Werte 2006 | Direktion: Verhandlungen zum KBOB-Planervertrag abgeschlossen
Produkte
Impressum
Veranstaltungen
Kraftwerkzentrale Küblis – ein Zeitzeuge
Die Rätia Energie ging 2000 aus den Kraftwerken Brusio, den Rhätischen Werken für Elektrizität und der AG Bündner Kraftwerke hervor. Dabei fiel ihr ein architektonisches Corporate Design in den Schoss. Denn die kraftvollen Zentralen im Prättigau und im Puschlav baute in den 1920er-Jahren derselbe Architekt, der St.Moritzer Nicolaus Hartmann jun. Gegenwärtig wird die Zentrale Küblis sorgfältig umgebaut.
Die riesigen Maschinenhallen faszinieren und werden als Kathedralen der Technik gefeiert. Der Kraftwerkbau in Graubünden musste sich vor achtzig Jahren jedoch vor allem der Frage stellen, wie diese stattlichen Volumen in die Landschaft eingepasst werden und doch technischen Fortschritt widerspiegeln können. Wie ernst diese Aufgabe genommen wurde, beweist der Wettbewerb, den die AG Bündner Kraftwerke 1920 unter den führenden Architekturbüros Valentin Koch & Ernst Seiler, Otto Schäfer & Martin Risch sowie Nicolaus Hartmann jun. durchführte. Schon damals entschieden die Ingenieure über die Disposition: Standort und die ideale Grundrissform eines Kreuzes waren vorgegeben, und doch verlangte die Bauherrschaft von den Architekten weit mehr als eine Hülle: «Es soll ein Bau geschaffen werden, der bestmöglich dem heimatlichen Stil entspricht und harmonisch in die Landschaft passt. Daneben ist eine zweite Hauptforderung zu berücksichtigen: die äussere Gestaltung soll dem inneren Zweck, dem technischen Charakter der ganzen Anlage entsprechen.»1 Die mit den Gebrüdern Pfister aus Zürich, ihrerseits prominente Kraftwerkbauer, gut besetzte Jury sprach sich für das Hartmann-Projekt aus. 1922 war der Bau vollendet. Insbesondere der Fassadenaufbau wird der doppelten Ausrichtung – regionale Einbindung und industrielles Selbstverständnis – gerecht: Über einem Stampfbetonsockel erhebt sich massiv gemauerter Tuffstein, der zwischen grobem Putz hervorscheint und auf traditionelle heimische Baukunst referiert.
Die Maschinenhalle als Herzstück
Das Herzstück der Anlage ist heute wie damals die Maschinenhalle. Deren schlichte Grösse, die Rundbogenfenster und die Holzdecke erinnern an eine Basilika. Schon der Kunsthistoriker Erwin Poeschel konnte sich der sakralen Wirkung der Anlage nicht entziehen, entsprechend aufgeladen und anspielungsreich er-scheint seine Beschreibung: «Das Langhaus ist nicht nur dem Volumen nach die Hauptmasse des Komplexes, es ist auch der Sitz des Lebens, wo in den gewaltigen Herzkammern der übermannsgrossen Turbinen der Puls des Wassers pocht, um in den Generatoren jene Energiemengen zu erzeugen, die dem Laienbegreifen ein phantastisches Märchen sind.»2 Nach achtzig Jahren Gebrauch aber haben die alten Maschinen aufgehört zu pochen.
Als die Konzession am Auslaufen war und auf allen Ebenen Investitionsbedarf bestand, stand auch die Maschinenhalle zur Disposition, war sie doch, gemäss dem leitenden Ingenieur Luciano Lardi, für die neuen zwei Maschinengruppen, die nun die Leistung der alten sechs Turbinen übernehmen und gar übertreffen, überdimensioniert. Grösse aber verpflichtet, und wie Kirchen nicht abgerissen werden, nur weil die Kirchgemeinden schrumpfen, so steht auch dieser Bau noch immer für den Glauben an die Technik, selbst wenn Letztere den Glauben überholt hat. Die Bauherrschaft hat schliesslich davon abgesehen, einen Neubau zu realisieren, und leistet sich den Luxus ungenutzten Raums.
Die Churer Architekten Cangemi & Tettamanti treten in Gestaltung und Farbkonzept auf die einmalige atmosphärische Wirkung der Halle ein und wahren diese über die notwendigen baulichen Veränderungen hinaus. Denn für die Platzierung der zeitgemässen schweren Maschinengruppen war eine Neufundierung unerlässlich. Der Hallenboden wurde komplett aufgerissen, und die neuen Katakomben könnten dichter armiert nicht sein. Darüber aber wird wieder der gleiche rote Tonplattenboden verlegt, der sich von den glatt weiss gestrichenen Wänden abhebt und mit der Holzdecke harmoniert. Wie von den Architekten bestimmt, werden die Turbinengehäuse schwarzgrau lackiert, während die übrigen Installationen wie Einlauf- und Düsenröhren, Generatoren usw. in Graualuminium gefärbt sind und so die Turbinengehäuse als klar voneinander getrennt erscheinen lassen.
Technische Notwendigkeit und Denkmalpflege
Mit der Erteilung der Baubewilligung hatte der Kanton gegenüber Rätia Energie denkmalpflegerische Anliegen geltend gemacht. So wurde die Materialisierung als wesentlich erkannt, dann sollte der Leitstand nicht innerhalb der Maschinenhalle platziert werden, und zudem wurde die von der Feuerpolizei und vom Arbeits-inspektorat verlangte Aussentreppe in Frage gestellt. In allen Punkten war es, auch dank dem Verständnis von Felix Vontobel, dem stellvertretenden Direktor der Rätia Energie, möglich, eine nicht nur befriedigende, sondern ansprechende Lösung zu finden.
Dank der Übernahme der angestammten Materialien bleibt die für den Bau wichtige Stimmung zwischen Abstraktion und Vertrautheit erhalten. Der neue Leitstand, der aus organisatorischen Gründen zwischen die Maschinengruppen zu liegen kommen musste, ist wie ein leichtes Gehäuse gestaltet, das seinerseits selbstverständlich als Objekt zwischen Objekten steht und durch die umfassend verglaste Gitterstruktur leicht und durchlässig wirkt. Die neue Fluchttreppe für die im Westflügel geplanten Arbeitsplätze konnte im Sinne eines Kompromisses zwischen denkmalpflegerischen und sicherheitsspezifischen Anliegen innerhalb eines Gebäudeversprungs entlang der Aussenmauer platziert werden.
Cangemi & Tettamanti zeigen mit ihrem Konzept jedoch, dass der Erhalt historischer Bausubstanz über das Augenfällige hinausgehen muss und gerade im Industriebau die Struktur einen wichtigen und integrativen Bestandteil darstellt. So konnten die Architekten etwa darauf hinwirken, dass im Eingangsbereich, um der hohen Belastung bei der Anlieferung der Maschinen standzuhalten, die tragende Decke im UG lediglich verstärkt und nicht die gesamte Tragstruktur ersetzt wurde.
Die Gliederung des geplanten Grossbüros im ersten Obergeschoss des Westflügels macht das vorhandene Stützenraster zum Thema und spielt zugleich die rhythmische Raumwirkung frei. Auch die mit der umfassenden Automatisierung überflüssig gewordene Kommandozentrale mit ihrer grosszügigen Verglasung auf die zu Füssen liegende Maschinenhalle wird in ihren ausgewogenen Proportionen erhalten und soll voraussichtlich als Schulungs- und Besucherraum dienen. Die notwendige Haustechnik wird in den bestehenden Schrankwänden und über dem Oblicht unsichtbar versorgt. So bleibt die Kraftwerkzentrale Küblis von innen heraus ein kraftvoller Zeitzeuge.TEC21, Fr., 2006.01.13
Anmerkungen
1 Zitiert nach Conradin Clavuot/Jürg Ragettli: Die Kraftwerkbauten im Kanton Graubünden. Chur 1991, S. 70.
2 Zitiert nach Leza Dosch: Kunst und Landschaft in Graubünden. Bilder und Bauten seit 1780. Zürich 2001, S. 211.
13. Januar 2006 Cordula Seger
Erneuerung Kraftwerk Küblis
Wasserkraftwerke haben eine lange Lebensdauer. So verrichteten die Maschinen im Kraftwerk Küblis im Prättigau, in einer der ersten grossen Hochdruckanlagen in Graubünden, während über 80 Jahren ohne nennenswerte Aktualisierungen zuverlässig ihren Dienst. Erst die vor einem Jahr erfolgte Neukonzessionierung bedingte die umfassende Erneuerung der elektromechanischen Ausrüstung, die gegenwärtig unter weitgehender Erhaltung der sakral wirkenden Architektur erfolgt.
Die Konzession für die Prättigauer Kraftwerke ist am 7. November 2001 nach 80 Jahren abgelaufen. Ein neuer Konzessionsvertrag, wiederum für die Dauer von 80 Jahren, wurde in der Folge mit den betroffenen Gemeinden ausgehandelt und Ende 2004 von der Bündner Regierung genehmigt. Darauf nahm die Werkeigentümerin Rätia Energie die Arbeiten am aktuellen Sanierungskonzept, das Investitionen von 58Mio.Fr. mit dem Schwerpunkt Erneuerung bzw. Umbau der Anlagen in Küblis vorsieht, in Angriff.
Kraftwerkstufe Klosters–Küblis
Die im Oktober 1922 nach nur zweieinhalbjähriger Planungs- und Bauzeit in Betrieb genommene Kraftwerkstufe Klosters–Küblis ist als Hochdruck-Laufwerk ausgelegt (Bild 1). Die Landquart wird unterhalb des Bahnhofs Klosters mit einem Wehr gefasst (Bild 2) und in einen Druckstollen geleitet, der 2005 gleichzeitig mit der Zentrale Küblis instand gesetzt wurde. Die Wasserfassung nimmt auch das Unterwasser der Zent-rale Klosters auf, die als Speicherwerk 11Mio.m3 Nutzinhalt des auf 1559mü.M. gelegenen Davoser Sees verarbeitet. Bei Volllast alimentiert die Zentrale Klosters die folgende Stufe Klosters–Küblis mit 5.5 m³/s, was einem Drittel ihrer Betriebswassermenge von 16.5 m³/s entspricht. Der betonierte, 10.5km lange Druckstollen von Klosters zum Wasserschloss Plävigin oberhalb Küblis weist ein Gefälle von 3‰ auf. Der Druckstollen von Klosters endet im Wasserschloss Plävigin auf ca. 1200mü.M. oberhalb Küblis, in das auch Wasser aus dem Schanielatobel zugeführt wird. Im Rahmen der laufenden Sanierung werden die Triebwasserwege und die Installationen der Stufe Klosters–Küblis bis Ende 2005 umfassend instand gesetzt und erneuert.
Vom Wasserschloss Plävigin fällt das Betriebswasser in einer offen verlegten einsträngigen Druckleitung, die sich bis zur Verteilleitung unten von 180cm auf 150cm Durchmesser verjüngt, über eine Höhendifferenz von rund 300 m zur Zentrale Küblis. Die heutige Druckleitung ersetzte 1978 die ursprüngliche dreisträngige Anlage und wird nach der Erneuerung der Zentrale unverändert weiterverwendet.
Zentrale Küblis
Das Gebäude der Zentrale Küblis weist einen kreuzförmigen Grundriss auf. Der Hauptarm dieses Kreuzes ist ca. 87 m lang und 16 m breit. Im Hauptarm ist der Maschinensaal mit einer Giebelhöhe über Boden von ca. 17 m untergebracht. Im westlichen Seitenarm befinden sich die Werkstatt und die Schmiede. In der Durchdringung der drei Gebäudearme sind alle für den Gesamtbetrieb notwendigen Anlagenteile, insbesondere der Kommandoraum, angeordnet. Auf der Ostseite des Hauptarmes ist das ca. 5 m breite, 70 m lange und maximal 8 m hohe Kugelschiebergebäude (Rohrhaus) mit Schrägdach angehängt. Gegen Osten wird das Schiebergebäude durch den 144 m langen Unterwasserkanal abgegrenzt (Titelbild).
Das Zentralengebäude steht auf Fundamentmauern aus Stampfbeton. Die tragenden Bauteile, wie Decken, Deckenbalken und Maschinenfundamente, sind in schwach bewehrtem Stahlbeton ausgeführt. Das Mauerwerk der Aussenwände wurde mit gemörtelten Tuffsteinen aus einer nahen Abbaustelle erstellt.
In der Zentrale Küblis standen im Endausbau sechs Maschinengruppen mit horizontalachsigen einstrahligen Peltonturbinen, die zusammen bei einem Bruttogefälle von 365 m und einer Betriebswassermenge von 16.5 m³/s eine Leistung von maximal 43.9MW ins Eisenbahn- und Industrienetz abgeben konnten.
Erneuerung der Zentrale Küblis
Die elektromechanischen und elektrotechnischen Anlagen des Kraftwerks Küblis sind im letzten Jahr vollständig erneuert worden. Die zentrale Massnahme ist der Ersatz der sechs bestehenden Maschinengruppen durch zwei horizontalachsige Maschinengruppen mit je zwei zweidüsigen, beidseits des Dreiphasengenerators angeordneten Peltonturbinen (Bilder 4 bis 7). Die neuen Maschinengruppen weisen, bei unverändertem Gefälle und Durchfluss, mit zusammen 45.6MW bei der Nenndrehzahl von 428.35min–1 eine um 4% höhere Leistung als die Gesamtleistung der alten Anlage auf. Zu den neuen Maschinengruppen gehören vier neue Kugelschieber und eine neue Verteilleitung im Rohrhaus.
Die zwei Synchrongeneratoren sind mit zwei neuen Maschinentransformatoren (Blocktransformatoren) von 26MVA Leistung verbunden, die ihre Ausgangsspannung von 8kV auf die Übertragungsspannung von 50kV transformieren. Es wird kein Einphasenstrom der Frequenz 162/3Hz für Bahnzwecke mehr produziert. An Stelle der Bahnstromanlage wird eine neue 50kV/50Hz-Schaltanlage für Dreiphasenstrom erstellt (Bild 8). Die gesamte neue Anlage kann ferngesteuert oder von einem zentralen, zwischen den Maschinengruppen in einer verglasten Kabine angeordneten Leitstand bedient werden.
Bauarbeiten
Bei der Demontage der alten Maschinen und Armaturen fielen ca. 950t Stahl, Grauguss, Kupfer und andere Metalle an. Bei zwei Maschinengruppen wurden PCB-haltige Materialien verwendet, sodass sie durch spezialisierte Unternehmen entsorgt werden mussten. Die neuen Maschinensätze wiegen je ca. 270t.
Für die Unterbringung der neuen Maschinengruppen und weiterer Komponenten mussten ca. 1700 m³ leicht bewehrter Stahlbeton und ca. 300 m³ Lockergestein abgebaut und abtransportiert werden (Bild 3). Für die Erstellung der neuen Maschinenfundamente mit den zugehörigen Unterwasserkanälen und weiterer Bauteile wurden ca. 2000 m³ normal bewehrter Stahlbeton mit ca. 220t Bewehrungsstahl und ca. 300 m³ Füll- und Magerbeton verbaut.
Neubeginn
Die Vorarbeiten für die Erneuerung der Zentrale Küblis begannen im Herbst 2004. Am 29.3.2005 wurde das gesamte Kraftwerk abgeschaltet und anschliessend mit dem Rückbau begonnen. Die Montage der beiden neuen Maschinengruppen begann im August 2005, ihre Inbetriebsetzung ist gestaffelt bis 23.12.2005 bzw. bis 13.2.2006 vorgesehen. Die Innenausbauarbeiten zur Wiederherstellung der ursprünglichen Charakteristik werden sich bis in den Frühling 2006 erstrecken.
Die alte Anlage produzierte im Mittel der Jahre 1976– 2002 177.5 GWh elektrische Energie, davon 55.5GWh (31%) im Winter. Für das erneuerte Kraftwerk Küblis sind Werte in derselben Grössenordnung zu erwarten.
Die neue Konzession beinhaltet verschiedene Umweltauflagen, insbesondere die Dotierwasserabgabe an den Wasserfassungen. Das ungenutzt fliessende Dotierwasser bewirkt eine jährliche Produktionseinbusse von 9% gegenüber dem Betrieb unter der alten Konzession. Die theoretische Minderproduktion wird durch den verbesserten Wirkungsgrad und die optimierte Steuerung der erneuerten Anlagen zu zwei Dritteln ausgeglichen.TEC21, Do., 2006.01.12
Literatur
Clavuot, C., und Ragettli, J.: Die Kraftwerkbauten im Kanton Graubünden. Verlag Bündner Monatsblatt, Chur 1991, S. 68–93. ISBN 3 905 241 07 2
12. Januar 2006 Remo Baumann, Aldo Rota