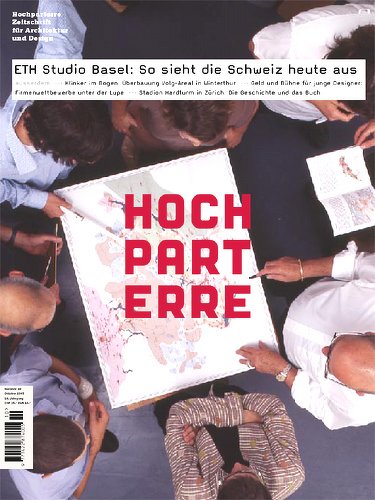Inhalt
6 Funde
9 Stadtwanderer: Leckt mehr Briefmarken
11 Jakobsnotizen: Missratene Architektur
13 Auf- und Abschwünge: Dauerbrenner Submission
Titelgeschichte
16 Das neue Schweizerbild
Brennpunkte
28 Volg-Areal Winterthur: Klinker am Gleisbogen
32 Anita Mosers Schuhe: Stöckeln auf sanften Sohlen
36 Kulturförderungsgesetz: Fordert Design mehr Förderung?
38 Kataloge von Hochschulen: Designschulen in Buchform
40 Wettbewerb: Ist die offene Ausschreibung gescheitert?
46 Hardturm-Stadion: Die Geschichte und das Buch
50 Firmenwettbewerb: Geld und Bühne für Jungdesigner
52 Jung und anderswo: Nuno Brandão Costa aus Porto
Leute
58 Geburtstagsfest des Architekturbüros Atelier 5 in Bern
Bücher
60 Über städtebauliche Strategie und städtisches Schlafen, Traumbilder von den Bergen und der Architektur und über Nike schuhe, Gebäudeschriften und Designtheorie
Fin de Chantier
62 Wohnsiedlungen in Zürich-Leimbach und Winterthur, Swisscom
Shop, Baden; Collège in Saint-Prex; Kantonsbibliothek Baselland in Liestal; Rebhaus-Sanierung in Biel
An der Barkante
67 Mit Kees Christiaanse im Restaurant Bauhaus in Zürich
Der Verlag spricht
71 Projekte, Impressum
Polisportiv heisst nur Fussball spielen
Meili Peter Architekten haben eine Zwischenbilanz gezogen. Ihr Projekt für ein Fussballstadion im Hardturm in Zürich ist zwar bewilligt, aber noch nicht gebaut. Fertig ist aber ein Buch über das Stadion. Eine gute Gelegenheit nachzufragen: Wie lief die Geschichte?
In den Achtzigerjahren schien alles noch klar: Der Fussball Club Zürich (FCZ) spielte im Stadion Letzigrund im Kreis 4, der Stadtrivale Grasshoppers Club (GC) im Stadion Hardturm auf der anderen Seite der Gleise im Kreis 5. Der Letzigrund gehörte der Stadt Zürich, der Hardturm war eine Privatliegenschaft der Albers-Gruppe. Der Letzi ist mythischer Grund, weil hier jährlich das berühmte Leichtathletik-Meeting der Weltrekorde stattfindet, der Hardturm ist ein Stadion wie ein anderes. Alt und renovationsbedürftig waren sie beide.
Der Bund, angeführt vom Sportminister Adolf Ogi, erfand das Nationale Sportanlagenkonzept, das den mythischen Letzigrund subventionswürdig machte. Doch Bundesgeld gab es nur für Stadien mit mindestens 25 000 Plätzen, der mürbe gewordene Letzigrund musste also saniert und erweitert werden. Wie so vieles in diesem Land, war es die Subventionshoffnung, die die Dinge in Bewegung setzte.
Polisportiv
Das Amt für Hochbauten der Stadt Zürich prüfte anfangs 1997, wägte ab und kam zur Lösung Abriss und Neubau. Damit aber war der Standort nicht mehr zwingend. Wo könnte ein neues Stadion auch noch gebaut werden? Gleichzeitig überlegte sich die Albers-Gruppe ihrerseits einen Ausbau des Stadions Hardturm auf 25 000 Zuschauer, den sie mit kräftiger Unterstützung der Credit Suisse privat finanzieren wollte. Es war eine nahe liegende Idee des Stadtrats, die beiden Projekte unter einen Hut zu bringen, ein polisportives Stadion für beide Fussballclubs zu planen, GC, FCZ und Leichtathletik im gleichen Kessel. Die Stadt prüfte 19 Standorte, übrig blieben drei: Leutschenbach im Norden der Stadt, Letzigrund und Hardturm. Die erst zögernde Albers-Gruppe liess sich im Herbst 1998 überzeugen und spannte mit der Stadt zusammen. Unter der Führung der Stadt sollte das Stadion Hardturm durch einen polisportiven Neubau ersetzt werden. Das Kreis-5-Fieber entschied die Standortwahl. Das neue Stadion sollte ein wichtiger Beitrag zum Ausbau des aufstrebenden Trendquartiers Zürich West werden. Darüber hinaus fliessen die Steuereinnahmen aus den Mantelnutzungen in die Stadt-kasse und nicht wie beim letzten Mitkonkurrenten Leutschenbach in die der Gemeinde Opfikon. Das knappe Grundstück, der hohe Grundwasserspiegel, die Erschliessung, die Nachbarn, viele der späteren Probleme hat man sich mit dem Standort aufgeladen.
Die Vorrunde
Die Stadtkasse war leer. Doch mit PPP (Public Privat Partnership) ist das kein Hindernis. Die PPP der Stadt und der Albers-Grupped beziehungsweise ihre Hardturm AG, an der auch die Credit Suisse mit vierzig Prozent beteiligt war, sollte es richten. Beide Partner scheuten das Risiko und suchten zuerst einen Developer. Neben Stadion und Mantelnutzungen waren nun auch ein Stadtquartier zu planen. Im Frühjahr 1999 wurden vier ausländische Entwicklungsteams zum Developer-Wettbewerb eingeladen, den die holländische Multi Developement Corporation (MDC) gewann. Sie hatte mit OMA zusammengespannt. Man rechnete mit einem Investitionsvolumen von einer Milliarde Franken. Leider hatte das Konzept einen grundsätzlichen Fehler: Die Leichtathletikbahn fehlte. Das polisportive Stadion war nur ein monofunktionales Fussballstadion. Noch störte das niemanden, die Holländer würden das korrigieren. Doch die Wetterlage verdüsterte sich. Die MCD-Leute drängten OMA aus dem Projekt, kannten die schweizerischen Eigenheiten zuwenig und liessen nicht mit sich reden. Die Zerrüttung nahm ihren Lauf, die Scheidung von Stadt und MDC erfolgte im März 2000. Nach knapp einem Jahr war der Traum vom Developer geplatzt. Die Stadt hatte etwas gelernt: Wer das Risiko andern übertragen will, ist nicht mehr Herr der Sache. Eine alte Weisheit allerdings. Der Developer-Wettbewerb war die Vorrunde. Sie endete ohne Sieger und mit einer Niederlage der Stadt, die in der PPP die Führungsrolle übernommen hatte.
Hauptrunde
Doch verlor die Stadt den Mut nicht und startete sofort in die Hauptrunde. Diesmal übernahmen Stadt, die Albers-Gruppe und Credit Suisse das Risiko selbst. Sie organisierten im Sommer 2000 ein zweistufiges Konkurrenzverfahren. Aus 19 Bewerbern wählten sie zehn Teams aus, zu denen neben den Architekten und Ingenieuren auch ein Generalunternehmer gehörte. Denn in der ersten Stufe mussten die Kosten auf fünf Prozent Genauigkeit und in der zweiten mit einem verbindlichen Preis offeriert werden. Ein polisportives Stadion mit 25.000 gedeckten Sitzplätzen, Mantelnutzung von 85.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche, plus generelle Vorschläge für ein Stadtquartier, inklusive Nachdenken über den Verkehr und die Freiräume: Das Programm war riesig. Doch nur ein Programmpunkt interessierte wirklich: Die Tribünen, genauer, wie verschiebt man sie? Anders herum: Wie bringt man die Aschenbahn zum Verschwinden? Denn es gilt als unumstösslicher Glaubenssatz der Fussballkunst, dass das Publikum nie durch die Aschenbahn vom Spielfeld getrennt werden darf. Hexenkessel heisst das Stichwort.
Zwei Projekte wurden zur Weiterbearbeitung ausgewählt: das von Dudler / Sawade und das von Meili Peter. Dudler /Sawade verschoben nur die Quertribünen, Meili Peter hingegen alle vier. Der Kostenrahmen war mit 300 Millionen festgelegt worden, Meili Peter schossen mit 800 Millionen weit darüber hinaus. Trotzdem überzeugte dieses Projekt die Jury am meisten, denn trotz der hohen Kosten war das Wertschöpfungspotenzial vorhanden, das die Architekten in einer zweiten Stufe hätten nachweisen sollen.
Dazu kam es nicht mehr, genauer, ganz anders. Mit den Ergebnissen der ersten Stufe änderten sich die Spielregeln radikal. Polisportiv ist, wenn man nur Fussball spielt. Die Credit Suisse und die Albers-Gruppe beschlossen, ein reines Fussballstadion zu bauen, privat finanziert, ohne Federführung, aber mit Unterstützung der Stadt, die nun plötzlich wieder den Letzigrund sanieren oder ersetzen musste. Doch das ist eine andere Geschichte. Wieder hiess es: Zurück auf Feld eins. Die Hauptrunde endete mit einem Spielabbruch und einer Niederlage der Stadt.
Finalspiel
Nun übernahm die Credit Suisse die Führung. Das Programm wurde abgespeckt und im September 2001 begann die Zweite Stufe des Gesamtleistungswettbewerbs, das Finalspiel. Während Dudler / Sawade ihr Konzept übernehmen konnten, begannen Meili Peter von vorn. Im März 2001 präsentierte die Bauherrschaft das Fünfeck von Meili Peter. Ein Jahr nach dem Debakel der Hauptrunde standen endlich die Sieger des Ausscheidungsmarathons fest. Das Stadion ist ein Wurf. Auf einem dem Grundstück eingepassten fünfeckigen Sockel mit Shoppingcenter und Parkgarage sitzt leicht verdreht die Krone des ebenfalls fünfeckigen Stadions. Die Form ist ein intelligentes Eingehen auf die Zwänge des engen Grundstücks, der internationalen Vorschriften über Fussballfelder und den Anforderungen der Mantelnutzung. Das Stadionprojekt macht die Massstabsverschiebung deutlich, die in Zürich stattgefunden hat. Neben der riesigen Stadtkrone stehen die putzigen Bernoulli-Häuser aus den Zwanzigerjahren. Der Grössenunterschied zeigt, wie fett die Stadt geworden ist.
Energieverschwendung
Blickt man auf die drei Wettbewerbe zurück, so drängen sich vier Festellungen auf: Erstens will es immer noch nicht recht einleuchten, warum zwei Stadien für Zürich wirklich nötig sind, vor allem wenn FCZ und GC auf demselben Platz spielen. Das polisportive Stadion ist möglich, Meili Peter haben eine Lösung gezeigt. Mit dem frei gewordenen Letzigrund hätte man die Defizite des umliegenden Quartiers lindern können. Zweitens haben alle diese Wettbewerbe einen erheblichen Selbstbetrugsanteil.
Man verlangt verbindliche Kosten von Projekten, die noch lange nicht weit genug definiert sind, dass das seriös möglich wäre. Die Änderungen sind programmiert, kein Gebäude von dieser Grösse entspricht am Schluss dem Wettbewerbsprojekt. Der Gesamtleistungswettbewerb ist für diese Aufgabe schlicht ungeeignet.
Was sich nicht endgültig definieren lässt, lässt sich nicht endgültig berechnen. Eine Bauherrschaft, die sich an solche Grossprojekte wagt, kann nicht mit einer Versicherungsmentalität operieren. Darüber hinaus frisst der Gesamtleistungswettbewerb drittens zu viel Energie. Die zweite Stufe kostete das siegreiche Team rund eine Million, 300.000 Franken war die Entschädigung. Die Teams machen das freiwillig, gewiss, doch störend ist, dass die Arbeit sinnlos ist, da sie weder zur Beurteilung der Projekte entscheidend sind, noch zu einer Preissicherheit führen. Viertens schliesslich darf es nicht sein, dass die Investoren als mitbewegte Beobachter dem Prozess zusehen und sich am Schluss an ihr Engagement des Anfangs nicht mehr erinnern. Wer innerlich entschlossen ist ein reines Fussballstadion zu bauen, soll keine Lippenbekenntnisse zum polisportiven abgeben. Anders herum: Mit dem Wettbewerb findet man ein Projekt, nicht die Zielsetzung. Zu Alternativen gibt es einfachere Wege.
Keine EM-Spiele ohne Zürich!
Das Projekt war gefunden. Der Weg zur Verwirklichung ist noch lang. Als erstes ordneten die Albers-Gruppe und die Credit Suisse ihren Bestand. Credit Suisse übernimmt die Hardturm AG zu hundert Prozent und somit alleine das Kommando über das Stadion. Die Albers-Gruppe konzentriert sich auf das angrenzende, neue Stadtquartier.
Im Dezember 2002 erhielten die Schweiz und Österreich gemeinsam den Zuschlag für die Europameisterschaften im Jahr 2008, damit musste das Stadion im Herbst 2006 fertig sein, wenn in Zürich EM-Spiele stattfinden sollten (vom Letzigrund sprach damals niemand). In Zürich brach mit voller Macht die EM-Hysterie aus, die Ehre und die Konkurrenzfähigkeit der Stadt war in Gefahr. Keine EM-Spiele ohne Zürich! war der Schlachtruf. Es ist jedoch daran zu erinnern, dass a) das Stadion nie für die EM geplant war und dass b) die Bauherrschaft von Anfang an wusste, dass ein Rekurs gegen den Gestaltungsplan, der bis zum Bundesgericht durchgezogen wird, mindestens zwei Jahre bis zum endgültigen Entscheid benötigt. Anders herum: Ohne EM-Hysterie hätte jedermann den gemächlichen Lauf der Dinge selbstverständlich gefunden.
Pause
Die EM wirkte als Brandbeschleuniger, 2008 stand in Flammenschrift an der Wand. Die Stadt hat mit einem beispiellosen Kraftakt die EM in Zürich doch noch möglich gemacht, allerdings im Letzigrund. Am Hardturm hingegen gings harzig weiter. Zwar stimmte das Volk im September 2003 dem Gestaltungsplan zu, doch die Einsprachen waren damit nicht erledigt. Die hartnäckigsten Stadiongegner waren der Verkehrsclub der Schweiz VCS und die zwei Anwohnergruppen. Ihre Rekurse richteten sich nicht gegen das Stadion, sondern die Mantelnutzungen, genauer, das Shopping Center und den Mehrverkehr. Regierungsrat, Verwaltungsgericht, Bundesgericht, vom Oktober 2003 bis Dezember 2004, ein Jahr nur brauchte der Rechtsweg, das ist ein Jahr weniger als erwartet. Doch zu spät wars für das Stadion Hardturm trotzdem. Das Ziel Europameisterschaft wurde aber erst im Juli 2005 endgültig aufgegeben. Der Gestaltungsplan trat im Januar 2005 in Kraft, die Baubewilligung lag im Mai 2005 vor.
Was ist der Stand der Dinge im September 2005? Die Planung wurde auf den ‹Stand 9› gebracht und dann kam die Pause. Genauer, das Warten auf die Gerichtsentscheide. Die Einsprachen gegen die Baubewilligung müssen behandelt werden. Man rechnet bis September 2007. Dann kommt die Stunde der Wahrheit. Credit Suisse wird vor dem Point of no Return stehen: bauen ja oder nein. Immer hat die Bank klar gemacht, dass eine Bruttorendite von 6,5 Prozent herausschauen müsse, sonst wird nicht gebaut.
Allerdings wird sie noch andere Faktoren in ihrer Rechnung berücksichtigen müssen. Wie hoch ist der Imageschaden? Was geschieht mit den rund 40 Millionen Franken, die die Bank bereits investierte? Was ist mit dem gültigen Gestaltungsplan? Ohne Stadion müsste die Planung wieder von vorn beginnen und ein neuer Gestaltungsplan mit einem Shopping Center zum Beispiel wäre kaum durch eine Volksabstimmung zu bringen. Der Landanteil der Stadt, der für den Bau des Stadions bestimmt war, fiele wieder an die Stadt zurück, was die Überbauung des Restgrundstücks erschweren würde. Doch das Stadion muss gebaut werden. Nicht wegen der Rendite, sondern wegen der Architektur. Es setzt den Merkpunkt für den Beginn des 21. Jahrhunderts in Zürich.hochparterre, So., 2005.10.16
---
Der Lauf der Dinge:
1996: Was tun mit dem Letzigrund? Renovieren, erweitern, abreissen? Ist ein anderer Standort möglich?
1997: Stadt sucht Standorte für ein polisportives Stadion. Erste, erfolglose Kontakte mit der Albers-Gruppe.
1998, Oktober: Die Stadt präsentiert ihre Standortevaluation. Es bleiben übrig: Letzigrund, Leutschenbach, Hardturm. Die Albers-Gruppe macht beim polisportiven Stadion mit.
1999, Januar: Entscheid für das Areal Hardturm.
1999, Juli: Entscheid Investorenwettbewerb: MDC / OMA gewinnen ohne Leichtathletikbahn.
2000, März: Bruch mit MDC. Gründung neuer Trägerschaft, Federführung hat die Stadt, die Albers-Gruppe und CS machen mit.
2000, Mai: Bestätigung: Wir bauen ein polisportives Stadion.
2000, Juli: Erster Anlauf Gesamtleistungsstudienauftrag erste Stufe. Zehn Teams nach Präqualifikation. Rekurse verzögern den Start bis Ende September.
2001, Mai: Die beiden Teams Meili Peter und Dudler / Sawade sollen überarbeiten. Gleichzeitig Kehrtwendung: Credit Suisse und Albers-Gruppe wollen reines Fussballstadion im Hardturm. Stadt beginnt mit Planung für Letzigrund.
2001, September: Start zweite Stufe Gesamtleistungswettbewerb.
2002, März: Meili Peter gewinnen die zweite Stufe. Auftrag zur Weiterbearbeitung.
2002, Mai: CS übernimmt das Projekt ganz.
2002, Dezember: EM an Schweiz, Österreich
2003, Februar: Mitwirkungsverfahren abgeschlossen, 333 Einwendungen
2003, Mai: Erste Stufe Gesamtplanungsstudienauftrag Letzigrund entschieden, vier überarbeiten.
2003, Juli: Der Gemeinderat genehmigt den Gestaltungsplan mit 89 zu 14 Stimmen.
2003, September: Das Stimmvolk sagt ja zum Gestaltungsplan und zur Landabtretung. Ein einig Volk von Fussballern.
2003, Oktober: Gegen den Gestaltungsplan gibt es sieben Rekurse.
2004, April: Der Regierungsrat stimmt dem Rekurs des VCS zu. Statt 3,4 Millionen Fahrten nur 2,7.
2004, April: Zweite Stufe Letzigrund: Bétrix & Consolscio / Frei & Ehrensperger gewinnen.
2004, Juli: Das Verwaltungsgericht entscheidet: 1,8 Millionen Fahrten.
2004, September: Stadt und CS künden an: Wir gehen vor Bundesgericht.
2004, Dezember: Das Bundesgericht hebt das Urteil des Verwaltungsgerichts auf und sagt: Regierungsrat hat Recht, 2,7 Millionen Fahrten.
2005, April: Wechsel des GU, statt Batigroup nun Zschokke.
2005, Mai: Baubewilligung erteilt.
2005, Juni: 75 Prozent Ja-Stimmen zum Neubau des Letzigrunds.
2005, Juni: Zwei Rekurse gegen Baubewilligung Stadion Hardturm.
2005, September: Das Projekt wird auf ‹Planungsstand 9› eingefroren, bis die Gerichte entschieden haben.
2005, November: Spatenstich am Stadion Letzigrund.
2007, September: Einweihung Stadion Letzigrund.
16. Oktober 2005 Benedikt Loderer
verknüpfte Bauwerke
Stadion Zürich
Dämme gegen Projektflut
Das offene Wettbewerbsverfahren steht in der Kritik. Architekten klagen über steigende Anforderungen, hohe Kosten und das Risiko, in den vielen Teilnehmern unterzugehen. Die Veranstalter fürchten sich vor der Flut von Projekten und misstrauen deren Qualität. Anhand von Verfahren in Jenaz und Bern fragen wir: Wankt der offene Wettbewerb?
Jenaz, im Juli. Zwei Turnhallen voller Projekte warten auf die Jurierung, Vorschläge für ein regionales Alters- und Pflegeheim mit 70 Betten. Die Flury-Stiftung, Schiers, Betreiberin von Spital, Spitex und Heimen im Prättigau, hat einen einstufigen, europaweiten Wettbewerb ausgeschrieben. Weshalb das offene Verfahren? «Wir wollten jungen wie einheimischen Büros eine Chance geben», sagt Heinz Brand, Präsident der Stiftung.
63 Projekte kamen als Antwort. Eine grosse Auswahl? Scheinbar. Das Siegerprojekt von Allemann Bauer Eigenmann, Zürich, überzeugte betrieblich und architektonisch als einziges aller 63 Arbeiten. Das durchschnittliche architektonische Niveau war nicht sehr hoch. Wer sind die anderen 62 Büros? 15 Lokale (Kanton Graubünden), 35 aus der übrigen Schweiz, 7 aus Deutschland und 2 aus Liechtenstein (3 konnten nicht juriert werden). Auffallend: Kein einziges der bekannten Bündner Büros – Bearth & Deplazes, Jüngling & Hagmann, Conradin Clavuot, Gion A. Caminada etc. – war unter den Teilnehmern. Ein zweites Beispiel: Der offene Wettbewerb ‹Wohnen im Schönbergpark›, Bern. Zwölf Wohnungen für «gehobene Ansprüche» sollten in einem Herrschaftsgarten erstellt und ein bestehendes Bauernhaus umgebaut werden, Baukosten unter 10 Millionen Franken. 130 Teams bemühten sich um den Auftrag. Eine gute architektonische Auswahl? Mitnichten. In der ersten Runde schieden 70 Projekte aus, «die keiner weiteren Betrachtung mehr bedürfen, weil sie weder einen Beitrag zur Identität des Ortes abgeben, noch Klärung erfolgt durch die Situierung der Baukörper», stellte die Jury resigniert fest. Gewonnen hat der Berner Architekt Ernst Gerber. Ähnlich wie in Jenaz nahmen 30 lokale Architekten, das heisst aus Bern und der Umgebung, teil, 35 aus Deutschland, 5 weitere aus Europa, der Rest aus der übrigen Schweiz – aber kaum Büros, die im Raum Deutschschweiz bekannt wären.
Keine Renommierten – ist das schlimm?
Das offene Verfahren ist die heilige Kuh des Schweizer Wettbewerbswesens. Der Sia wehrt sich dafür, alle rühmen es und alle beteuern, es dürfe niemals abgeschafft werden. Tatsache ist: Jedes Büro versucht, möglichst rasch von den offenen Verfahren los- und in die selektiven hineinzukommen. Wo blieben die bekannten Bündner in Jenaz? «Zuwenig Zeit», antwortet Andreas Hagmann. Bei Jüngling & Hagmann sind zwar gerade sieben Leute, die Hälfte der Belegschaft, mit Wettbewerben beschäftigt, aber alles sind selektive oder eingeladene. «Weniger Teilnehmer, grössere Chancen», sagt Hagmann. Zudem gibt es immerhin eine fixe Entschädigung, wenn die auch die Kosten niemals deckt. Denn Hagmann stört: «Die Anforderungen für die Abgaben sind in den letzten Jahren stetig gestiegen.» Früher sei der Aufwand vernünftig gewesen, heute müsse sein Büro in eine Aufgabe wie die Jenazer 50 000 Franken investieren. «Das können wir uns als Büro, das reguläre Löhne ausschütten muss, nicht immer leisten, besonders nicht bei kleiner Gewinnchance.» Daniel Ladner, Partner bei Bearth & Deplazes, sieht es gleich. Sechs bis acht Mal pro Jahr werden sie eingeladen oder können sich qualifizieren – was ihnen reicht. «Bei offenen Wettbewerben machen wir mit, wenn die Aufgabe spannend ist oder wir uns zu einem Beitrag verpflichtet fühlen.» Und es hängt weiter von der Kompetenz der Jury und davon ab, ob das Vorhaben versanden könnte – «muss das Projekt vors Volk, ist diese Gefahr im heutigen politischen und wirtschaftlichen Umfeld hoch», sagt Ladner.
Kaum Renommierte – ist das schlimm? Für die architekto-nische Qualität eines Wettbewerbs nicht, die hängt bekanntlich nicht von der Bekanntheit der Teilnehmer ab. Aber die Renommierten legen beispielhaft jenes Verhalten an den Tag, das einen Teufelskreis begünstigt: Alle drängeln sich um die selektiven Verfahren und überlassen unspektakuläre Wettbewerbe den Unerfahrenen und jenen, die sonst nicht zum Zug kommen, was zu eher durchschnittlicher Qualität führen kann oder zumindest das Gerücht bestärkt, dass dem so sei, und was die Veranstalter wiederum bestärkt, auf erfahrene Büros zu setzen, die sie dank Präqualifikation auch bekommen. Oft lautet das Argument auch, die Aufgabe sei komplex und nur wenige ihr gewachsen – bis hin zum Fall Kongresszentrum Zürich (HP 8/05), wo die Veranstalterin behauptet, es brauche Spitzenarchitektur, und die bekomme man nur bei den Stars. Hinzu kommt die Angst vor den Kosten: Die Büros müssen Zehntausende von Franken einsetzen bei geringer Aussicht auf Erfolg, die Veranstalter fürchten den administrativen Aufwand für zu viele Projekte.
Präqualifikation: fadenscheinig
Alles nicht nötig, sagt Thomas Urfer, Mitglied der Sia-Wettbewerbskommission. Sein Hauptargument gegen den selektiven Weg: «Es gibt kein vernünftiges Auswahlverfahren.» Präqualifikationen seien subjektiv gefärbt – wie anders wähle man zehn aus 50 Büros, die nach der Prüfung ihrer Bewerbung alle fähig wären? Urfer will den offenen Wettbewerb durchsetzen – überall. Sein Rezept: Mehr offene ausschreiben, sodass sich die Teilnehmer besser verteilen, und tiefere Anforderungen, sodass sich die Investition für die Teilnehmer in Grenzen hält. «Modell und Pläne im Massstab 1:500, keine unnötigen Bilder, kein Erläuterungsbericht», das reiche einer guten Jury zur Beurteilung. Belege wie kubische Berechnung oder Energienachweis hält Urfer für sinnlos, denn «die Vorprüfer müssen alles nachrechnen, und kontrollieren ist komplizierter, als neu zu rechnen.» Der Arbeitsaufwand für einen Wettbewerb sollte etwa zwei Wochen betragen, sagt Urfer.
Lässt sich mit Urfers bestechend einfachem Rezept kochen? Andrea Grolimund Iten von der Metron, einer erfahrenen Wettbewerbsorganisatorin, hält entgegen: «Der offene Wettbewerb ist ein guter, aber nicht der einzige Weg. Wir müssen das Verfahren der Bauherrschaft und der Aufgabe anpassen können.» Habe eine Veranstalterin wenig Bauerfahrung, sei es wichtig, dass der Prozess nachvollziehbar sei, etwa durch Zwischenbesprechungen. Jeremy Hoskyn, Leiter Projektentwicklung / Wettbewerbe beim Zürcher Amt für Hochbauten, bestätigt das. Von 10 bis 15 städtischen Verfahren sind pro Jahr etwa drei bis fünf offene. Auch Hoskyn begründet dies mit der Rücksicht auf ungeübte Bauträger wie Stiftungen oder Genossenschaften. Baue die Stadt selbst, gehe sie immer vom offenen Verfahren aus. «Obwohl», gibt Hoskyn zu bedenken, «die Stadt käme gut ohne offene Wettbewerbe aus.» Für Präqualifikationen bekomme sie bis zu 120 Bewerbungen, viele von sehr guten Büros. Dennoch sei das offene Verfahren unverzichtbar: «Es bringt architektonische Erneuerung und wir können den Nachwuchs fördern.»
Vom Vorschlag, die Anforderungen herunterzuschrauben, hält Hoskyn dagegen nichts. «Wir brauchen alles, was wir verlangen, um die Projekte beurteilen zu können.» Der berüchtigte Fassadenschnitt 1:20, den die Stadt immer will, sei elementar wegen seiner Aussagen zu Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Generell sagt Hoskyn: «Der Wettbewerb ist das geeignetste Vergabeverfahren für grössere Architekturaufträge, weil er Qualität sichert. Aber er ist nicht selbstverständlich. Politisch müssen wir ihn immer wieder rechtfertigen.» Für faire Verfahren fühle sich die Stadt verantwortlich – «für die gleichmässige Verteilung der Aufträge unter den Architekten dagegen nicht.»
Offen ist auch schneller und günstiger
So oder so: Der offene Wettbewerb muss weiterleben, eben weil er offen ist – für Teilnehmer, für Lösungen. Damit das gelingt, müssen einerseits die Büros verkraften, dass in den ersten Juryrunden nicht über jede der vielen Arbeiten ausführlich diskutiert wird. (Einschub: Warum gehen renommierte Büros statt von einer Blamage nicht selbstbewusst davon aus, auch im offenen Feld nicht auf mehr als zehn ernsthafte Konkurrenten zu treffen?) Andererseits müssen die Veranstalter ihre Angst vor der Masse überwinden – jedes Projekt trägt dazu bei, das geeignetste herauszufiltern. Weiter sollen Veranstalter genau überlegen, was sie verlangen, der Aufwand darf nicht in die Höhe schnellen. Vor allem aber muss das Gerücht vom Tisch, ein offener Wettbewerb sei teurer: Schätzungen der Metron sagen das Gegenteil. Noch dazu dauert der selektive Weg wegen der Zweistufigkeit und der Beschwerdefristen Monate länger. Zu guter Letzt braucht der offene Wettbewerb mehr Mut von allen Seiten – so wie Heinz Brand es in Jenaz vormacht. Die 63 Projekte waren kein Schreck für ihn, er würde wieder den offenen Weg gehen – schliesslich hat er bekommen, was er wollte: Ein funktionierendes, architektonisch gelungenes Projekt eines jungen Büros.hochparterre, So., 2005.10.16
16. Oktober 2005 Rahel Marti