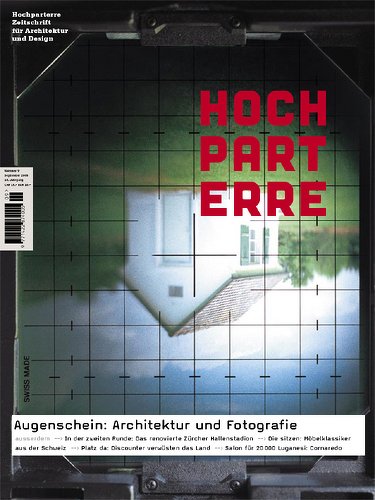Inhalt
6 Funde
9 Stadtwanderer: Die Entdeckung des Streifens
11 Jakobsnotizen: Man nennt ihn John
13 Auf- und Abschwünge: Der sorgfältige Baggerführer
Titelgeschichte
16 Architekturfotografie: Ein Bild von einem Bau
Brennpunkte
28 Raumplanung: Die Discounter verwüsten das Land
30 Hallenstadion: Ein Wädli-Tempel wird zur Event-Arena
38 Abschlussarbeiten HGKZ: Entwürfe mit Zukunft
40 Stadplanung: Ein Salon für 20 000 Luganesi
42 Jung und anderswo: Bureau des Mésarchitectures, Paris
48 Design: Schweizer Möbelklassiker
52 Brunel Award: Wie die SBB die Früchte ernten
58 Wettbewerb: Toni Webers Park im Spreebogen
62 Szene: Motorsänger aus Männedorf
Leute
68 Vernissage des Architekturführers in Biel
Bücher
70 Otto Scherers Schweiz; 100 Jahre Heimatstil; Frutigers
Universum, Bearth & Deplazes, Matthias Gnehms Prosa
Fin de Chantier
72 Stade de Suisse in Bern; Riviera in Meilen; Raiffeisenbank Bitsch VS; MFH Schaffhauserstrasse, Winterthur; MFH Zederpark, Genf; Kurhotel Sonnmatt, Luzern; IWC-Neubau
An der Barkante
77 Mit Brückenbauer Jürg Conzett im Hotel Stern in Chur
Der Verlag spricht
79 Projekte, Impressum
Der Radtempel wird zur Arena
Das bald siebzigjährige Hallenstadion in Zürich-Oerlikon hat eine Verjüngungskur hinter sich, die aus dem einstigen Radtempel eine zeitgemässe Veranstaltungshalle machte. Das denkmalgeschützte Haus blieb erhalten, Zusatznutzungen haben in einem Vorbau Platz gefunden. Eine Würdigung des neuen Hallenstadions als Match in drei Dritteln samt Schlusspfiff.
1. Drittel: Der Altbau
Die 1912 errichtete offene Radrennbahn in Oerlikon war der Stolz der damals noch selbstständigen, reichen Industriegemeinde vor den Toren Zürichs. Doch häufig vergällte der Regen das sonntägliche Vergnügen, und so tat sich 1932 ein Initiativkomitee zusammen, um eine gedeckte Rennbahn zu erstellen. 1938 – Oerlikon gehörte nun zur Stadt Zürich – war aus dem Initiativkomitee die Aktiengesellschaft Hallenstadion geworden, die dank Beiträgen von Bund, Stadt und Kanton Zürich im Frühling 1938 mit dem Bau des Hallenstadions beginnen konnte. Am 4. November 1939 eröffnete ein Fest ‹unter dem Protektorat des Stadtzürcherischen Verbandes für Leibesübungen› den von Architekt Karl Egender, den Ingenieuren Ernst Rathgeb und R. A. Naef erstellten Bau.
Dieser besteht aus zwei Teilen: der massiven ‹Schüssel› mit Rennbahn, Tribünen und Garderoben und dem stählernen ‹Deckel›. Die Schüssel ist als Betonrahmenstruktur konstruiert, an der die nur gerade acht Zentimeter dicken Betonplatten von einer Zeit zeugen, in der die Arbeit billig und das Material kostbar war. Unabhängig von der Schüssel steht, als Meisterleistung der Ingenieure, die Stahlkonstruktion des Daches auf vier Stützen an den äusseren Ecken der Tribüne. Zwei mal zwei Hauptbinder, je zehn Meter hoch, spannen ein Rechteck auf, in das vier weitere Binder eingehängt sind. Darauf liegt die 10 000 Quadratmeter grosse Dachfläche aus Holzsparren, Schalung und Kiesklebedach. Um das zu beheizende Volumen zu reduzieren, hängte man auf halber Höhe der Hauptträger eine Decke aus Eternitplatten an ein Holzgebälk. Die darin ‹versinkenden› Fachwerkträger der Haupttragebene haben den Raumeindruck geprägt.
Durch die zwischen die Schüssel und den Deckel gespannte Glashaut strömte viel Licht in die Halle, doch war diese lichte Atmosphäre nur noch auf alten Fotos zu bewundern. Längst waren die Glasflächen hinter grossen Vorhängen verschwunden, die das Tageslicht aussperrten. Denn obschon die Radrennen zunächst den Kalender dominierten, war das Hallenstadion von Beginn weg als Mehrzweckhalle geplant. So gab es Boxkämpfe, Reitwettbewerbe, Opernaufführungen oder Zirkusvorstellungen, und schliesslich erlebte das Hallenstadion am 18. November 1950 seinen ersten Eishockeymatch: ZSC gegen Arosa.
Zwischenresultat des 1. Drittels: Bei seiner Eröffnung war das Hallenstadion eine der grössten Veranstaltungshallen Europas. Die ‹Schildkröte›, wie das sechseckige Gebäude mit seinem nur minimal geneigten Dach genannt wurde, ist zu einem Wahrzeichen Oerlikons geworden. Seit der Eröffnung hat man es stets in Schuss gehalten, repariert, was nötig war, und hier und dort kleinere Umbauten durchgeführt. Doch mit den Jahren machten sich die Altersbeschwerden bemerkbar; das alte Haus genügte den Ansprüchen nicht mehr. So musste die Beleuchtung für jeden Anlass separat an der Decke befestigt werden, und in einer Zeit, wo die grossen Stars ihr Equipment in 40-Tönnern antransportieren, konnte bloss ein Gabelstapler von aussen ins Hallenstadion fahren. Zudem büsste der Radrennsport seine Bedeutung ein und die Rennbahn stand den meisten Veranstaltungen im Weg. Nach Aufgabe des Sechstagerennens war der Weg frei für eine zeitgemässe Mehrzweckhalle.
2. Drittel: Die Sanierung
In einer Bauzeit von nur einem guten Jahr haben Pfister Schiess Tropeano Architekten, Meier + Steinauer Partner und der Totalunternehmer Karl Steiner den Bau gründlich saniert und aufgerüstet. Die innere Betonstruktur, die Fassaden samt Fenster und Türen waren beim Umbau tabu, denn das Hallenstadion steht unter Denkmalschutz. Hingegen hat man die nicht mehr benötigte Radrennbahn ent-fernt und den Hallenboden mit dem Eisfeld um 1,50 Meter abgesenkt. Das erlaubte, eine Zu- und Wegfahrt für grosse Lastwagen durch die beiden seitlichen Tribünen in die Halle zu führen und an Stelle der einstigen Radrennbahn eine ansteigende Bestuhlung mit guten Sichtverhältnissen einzubauen.
Rund 13 000 Plätze zählt das Hallenstadion auf – je nach Rang – mehr oder weniger gepolsterten, blauen Sesseln; 19 verschiedene Varianten für die Bespielung des Raumes sind ausgearbeitet und feuerpolizeilich abgeklärt. Der markanteste Eingriff in der Halle ist der dreigeschossige Bau in der Südkudve, der zwanzig Logen und die Kabinen für Regie, Dolmetscher und Sprecher aufnimmt. Von hier aus können Gäste der Logenmieter (250 000 Franken pro Jahr) das Geschehen aus bester Perspektive verfolgen.
An der imposanten Stahlkonstruktion des Daches mussten die Ingenieure Walt + Galmarini sorgfältig rechnen, um den heutigen Vorschriften zu genügen. So brachte die Entfernung der abgehängten Decke die nötige Gewichtsersparnis, um die Dachfläche zu isolieren und neu einzudecken und um Videowände, Sprinkler und Beleuchtungseinrichtungen an die Stahlkonstruktion zu montieren. Den Veranstaltern steht eine Tragkraftreserve von 20 Tonnen zur Verfügung, die sie für eigene Installationen nutzen können. Die Dachkonstruktion, die 65 Jahre lang zur Hälfte verborgen war, ist nun sichtbar. Da fast alle Veranstalter eine dunkle Umgebung verlangen, ist die Decke dunkelblau und selbstverständlich sind Verdunkelungsvorhänge eingebaut. Immerhin lassen sich diese nun automatisch zuziehen.
Dunkelblau ist auch ein breites Betonband, das sich über den grossen Glasflächen der Deckenkante entlangzieht. Was auf den ersten Blick wie ein unverständliches Tragelement aussieht, ist der seinerzeit in fünf Zentimeter dickem Ortbeton erstellte Zuluftkanal. Diesen haben die Haustechniker zum Abluftkanal umgepolt und die Zuluft unter die Sitze verlegt. Die umfangreichen Lüftungsaggregate, welche die Halle im Normalbetrieb stündlich mit 200 000 Kubikmeter Luft versorgen, sind in Türmen untergebracht, die an den Längsseiten ausserhalb des Hallenstadions stehen und mit den neuen Fluchttreppen kombiniert sind. Die zunächst geplante Versenkung der Lüftung unter den Hallenboden scheiterte bald an Kosten und Terminen.
Zwischenresultat des 2. Drittels: Nach dem Umbau spielt das Hallenstadion wieder in der ersten Liga mit. Die geschwungene, weiss gestrichene Betonwand inmitten der Sitzreihen erinnert an die einstige Rennbahn und das Logenbauwerk setzt sich als eigenständiges Element vom Alten ab. Ein Wermutstropfen bleibt: die Decke. Nach Entfernung der Zwischendecke ist zwar die Stahlkonstruktion in ihrer ganzen Pracht zu sehen. Doch gerade die eigentümliche Zwischendecke war charakteristisch für den Raumeindruck. Als Ersatz hat man einen Gitterrost geprüft, musste die Idee aber wegen des Gewichts und der Kosten fallen lassen.
Nun fehlt im Mittelteil dieses Element völlig – und in den Randbereichen ist bloss der Holzrost übrig geblieben. So interessant die Konstruktion ist, die einheitliche dunkelblaue Farbe verunklärt deren Lesbarkeit. Zwar untersuchten die Architekten zusammen mit der Denkmalpflege verschiedene Farbvarianten, doch setzte sich der von der Bauherrschaft verlangte einheitliche dunkle Farbton durch. Der dunkelblaue Anstrich der Dachkonstruktion verwischt aber auch den ansonsten deutlichen Kontrast zwischen Alt und Neu: Mit ihrer Farbe verbindet sich die alte Stahlkonstruktion optisch mit der neuen Bestuhlung und setzt sich von der alten Betonstruktur ab.
3. Drittel: Der Vorbau
Bereits in ihrem Projekt von 1937 hatten die Architekten Egender und Müller vor dem Hallenbau ein viergeschossiges, konkav geschwungenes Gebäude mit Eingangshalle und Restaurant vorgeschlagen. Weil damals die Mittel für die Realisierung nicht vorhanden waren, fehlten dem Hallenstadion seither ein Foyer und ein richtiges Restaurant. Jetzt stand dieser Platz zur Verfügung, um Kassen, Restaurants, Konferenzräume und Büros zu erstellen. Die Architekten entwarfen einen viergeschossigen Riegel, der an die beiden seitlichen, weit vorstehenden Treppenhäuser des Altbaus andockt. Ein Knick in der Fassade markiert die Längsachse des Stadions und lässt den Bau gegenüber dem Portikus der benachbarten Messe etwas zurückweichen.
Gegen aussen verschliesst sich der Vorbau weitgehend. Nur die Kassen und Imbissstände im Erdgeschoss und einzelne Räume in den Obergeschossen öffnen sich zur Strasse hin. Weil das verbleibende Trottoir für grosse Menschenmassen zu schmal ist, führt der Hauptzugang nicht mehr frontal auf den Bau zu, sondern die beiden Haupteingänge liegen an den Stirnseiten des Vorbaus. Aus einer offenen Vorzone gelangt man über einen niedrigen Bereich, dessen Raumhöhe von der Kote des ersten Ranges im Altbau bestimmt ist, ins hohe, von Oberlichtkuppeln erhellte Foyer. Dieses ist die Überraschung des Umbaus und die Drehscheibe, die dem Stadion bis anhin fehlte. Vom Foyer aus führen die Treppen auf die Ränge oder in das grosse Restaurant im 1. Stock, das sich mit breiten Schiebetüren zum Foyer hin öffnen lässt. Die Besucher der VIP-Lounges gelangen via separaten Eingang direkt ins 2. Obergeschoss. Dort steht ihnen ein eigenes Restaurant zur Verfügung.
Damit der ehrgeizige Terminplan überhaupt einzuhalten war, wurde die gesamte Betonkonstruktion vorfabriziert und auf der Baustelle montiert. Ausgefacht ist die Tragstruktur aber nicht mit Backstein wie am Altbau, sondern mit Tafeln aus verzinktem Blech, die einen ähnlichen industriellen Touch vermitteln. Dazu gesellt sich der homogene Boden aus schwarzem Gummigranulat mit eingestreuten Aluminiumspänen, der sich durch das Foyer, über die Treppen und durch die Räume zieht.
Zwischenresultat des 3. Drittels: Ein Foyer, ein anständiges Restaurant, Konferenzsäle, ein VIP-Bereich sowie angemessene Räume für die Verwaltung – das ist für das Hallenstadion kein Luxus. Diese Räume haben bis anhin gefehlt und es ist nahe liegend, sie dort unterzubringen, wo die Architekten bereits vor fast siebzig Jahren ein Gebäude vorgesehen hatten. Mit ihrer Materialwahl haben die Architekten den Charakter des alten Hallenstadions aufgenommen, ohne sich mit einer simplen Übernahme der Materialpalette anzubiedern oder gar den Eindruck zu erwecken, der Vorbau habe schon immer hier gestanden. Als Folge des neuen Vorbaus ist aber das Hallenstadion als ‹Landmark› – das Rund der Südspitze über dem von den Treppenhäusern gefassten Platz – aus dem Stadtbild verschwunden. Ein Wiedersehen mit dem vertrauten Bau gibt es erst im Foyer. Doch da die Architekten aus Kostengründen kein Glasdach einbauen konnten, zerschneidet eine Betondecke den Blick auf die Fassade. Nur deren unterer Teil ist zu sehen – das Aha-Erlebnis bleibt in der Hälfte stecken.
Obschon der Neubau im grossen Ganzen das bereits von Egender vorgesehene Volumen umfasst, wirkt er zu klein. Denn die Umgebung des Hallenstadions hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert – insbesondere mit der benachbarten Messe und ihrem kolossalen Vordach. Haben sich vor dem Umbau des Hallenstadions die beiden Bauten zu einem grossmassstäblichen Ensemble verbunden, bringt nun der Vorbau einen kleineren Massstab ins Spiel. Dieser wird den beiden Hallenbauten, aber auch dem Hallenstadion allein und seiner Bedeutung nicht gerecht. Die Architekten hatten dieses Problem erkannt und gegenüber dem Amt für Hochbauten der Stadt Zürich die Ansicht vertreten, ein zusätzliches Geschoss wäre eine adäquate Antwort gewesen. Zu Recht, wie der fertige Bau zeigt.
Schlusspfiff
Den Schönheitsfehlern zum Trotz: der Umbau des Hallenstadions ist gelungen. Man mag es bedauern, dass der spröde Charme von einst dem zeitgemässen Komfort und der Effizienz hat Platz machen müssen. Doch muss man bedenken, dass das Hallenstadion, wie es war, keine Zukunft gehabt hätte. 2005 ist nicht 1939 und zeitweise stand sogar der Abbruch des Egender-Baus zur Debatte. Jetzt hat Zürich wieder eine Veranstaltungshalle, die auf der Höhe der Zeit ist und dennoch die Vergangenheit spüren lässt. Denn die Architektur des Altbaus hat unter dem Umbau kaum gelitten; das Gebäude mit seinen grossen Glasflächen blieb erhalten und die neuen Zutaten zerstörten vom Alten nur wenig. Nichts hindert künftige Generationen daran, die Stahlkonstruktion dereinst anders zu streichen, wieder eine Zwischendecke einzubauen, den Vorbau abzureissen – oder ihn aufzustocken, damit er das Gewicht erhält, das er an dieser Stelle braucht.
[ Zur Eröffnung ist ‹Das Hallenstadion – Arena der Emotionen›, herausgegeben von Heiner Spiess erschienen. Das Buch erzählt auf 282 Seiten und in 300 Bildern 65 Jahre Hallenstadion-Geschichte und schildert ausführlich den Umbau. CHF 78.– ]hochparterre, Fr., 2005.09.16
16. September 2005 Werner Huber
verknüpfte Bauwerke
Hallenstadion Zürich - Erweiterung, Umbau und Renovation
Wie die SBB die Früchte ernten
«Mir faared mit der SBB im schöne Schwyzerland», textete Walter Wild vor siebzig Jahren, und wir tun dies – meist – in guten Zügen ab gelungenen Bahnhöfen. Dies bestätigen die Brunel Awards, die Architektur- und Designpreise der Bahnen, immer wieder. 2005 mit besonders vielen Preisen.
Was für die Filmwelt die Oscars, das sind für die Welt der Bahnarchitektinnen und -designer die Brunel Awards. Seit 1985 zeichnet eine Jury alle paar Jahre die besten Werke in den Kategorien ‹Architektur›, ‹Grafik, In-dustriedesign und Kunst›, ‹Technische Infrastruktur und Umwelt› sowie ‹Rollmaterial› aus. Ein Preisregen geht in diesem Jahr auf die ohnehin Brunel Awards verwöhnten SBB nieder: Drei Awards, fünf Anerkennungen und den Spezial-preis der Jury dürfen sie von der Preisverleihung in Kopenhagen mit nach Hause tragen. Ein schöner Erfolg für Johannes Schaub, den Leiter der Abteilung Architektur der Infrastruktur SBB, der die Brunel Awards als Aufruf an die Sorgfalt versteht. «Damit möchte ich auch die von meinem Vorgänger Uli Huber begründete Tradition fortsetzen.»
Veranstalterin des Wettbewerbs ist die Watford-Gruppe, eine Vereinigung von Architekten und Designerinnen von 50 Eisenbahnverwaltungen aus 15 Ländern. Der Schwerpunkt der 1963 im südenglischen Watford gegründeten Vereinigung liegt in Europa, doch gehören ihr auch Eisenbahngesellschaften aus den USA, Kanada und Japan an. Namenspate der Auszeichnung ist der britische Ingenieur und Eisenbahnpionier Isambard Kingdom Brunel (1806–1859). Der Preis sollte in erster Linie ‹nach oben› wirken und die Bedeutung von Architektur und Design in die Chefetagen der Bahngesellschaften tragen. «Die Brunel Awards sollten auch ein Ansporn sein, den Wettstreit unter den Gestaltern der Bahnen zu fördern», erinnert sich Uli Huber. Zumindest bei den Schweizerischen Bundesbahnen erfüllen die Brunel Awards diese Absichten durchaus, wie Johannes Schaub feststellt: «Das Management sieht, dass sich die Leute engagieren, und mit den Preisen erhalten sie die Bestätigung für diese Leistungen.»
Ein Spezialpreis für die SBB
In diesem Jahr haben die SBB zwanzig Projekte auf je einer A0-Tafel in Bild und Text dokumentiert. Die Jury traf sich im Gastgeberland Dänemark, um aus den insgesamt 157 Eingaben die Auszeichnungen und die Anerkennungen zu bestimmen. Jurymitglied Uli Huber (der sich bei den SBB-Eingaben der Diskussion und Abstimmung enthielt) schildert die Eigenheiten der diesjährigen Brunel Awards: Obschon die letzte Preisverleihung bereits vier Jahre zurückliege – üblich war früher der Zwei- oder Dreijahresrhythmus –, wurden diesmal weniger Projekte eingereicht. In ihrem Bericht hält die Jury denn auch fest, sie vergebe diesmal weniger Preise. Für Uli Huber ist dies eine Folge des Neoliberalismus und der überhand nehmenden Kommerzialisierung: «Die British Rail, die früher eine Vorbildfunktion ausübte, gibt es nicht mehr, und ihre Nachfolgegesellschaften haben gar keine Projekte eingereicht.» Auch die Bahnleute aus Norwegen, die in früherern Jahren «so tolle Sachen» gemacht hätten, stellten nur eine Brücke vor.
Das ernüchternde Fazit der Jury traf auf die Schweizer Eingaben offenbar nicht zu. Denn für die «auf allen Stufen konsistenten, aber im Design vielfältigen Wettbewerbseingaben» erhielten die SBB den Spezialpreis der Jury. «Die SBB haben während Jahrzehnten ihren hohen Qualitätsstandard beibehalten und arbeiten mit den besten Architektinnen zusammen», heisst es dazu im Bericht. Erst zum fünften Mal überhaupt – und davon schon das zweite Mal an die SBB – vergibt die Jury diesen Spezialpreis. Das freut Johannes Schaub besonders: «Wie andere Bahngesellschaften wurden auch die SBB in mehrere Einheiten mit je eigener Bilanz aufgeteilt. Doch ich habe den Eindruck, dass in der Schweiz das System- und Verbunddenken noch immer vorhanden ist.» So haben die SBB-Architektinnen und -Designer ihre Objekte gemeinsam eingereicht, die Designabteilung hat die Eingaben gestaltet. «Die Zusammenarbeit funktioniert gut, auch wenn die Architekten zur Infrastruktur und wir zum Personenverkehr gehören», hält Ueli Thalmann, der Leiter der Designabteilung fest.
Städtebaulicher Beitrag der Bahn
Genugtuung herrscht ob dem Preissegen auch in der obersten Chefetage. Generaldirektor Benedikt Weibel freut sich, dass die SBB «einen wichtigen Beitrag zur allgemeinen Sensibilisierung für Architekturfragen leisten kann.» Bahn-Architektur müsse eben nicht allein rein funktionalen Kriterien genügen, sie könne auch einen nicht unwesentlichen städtebaulichen Beitrag leisten. Weibel weiter: «Seit jeher geniessen Architektur und Design bei uns einen hohen Stellenwert. Diese Haltung wurde mit den Awards auf internationalem Parkett einmal mehr von Spezialistenseite bestätigt. Auf nationaler Ebene schlug sie sich mit dem Erhalt des diesjährigen Wakkerpreises nieder.»
Besonders hell leuchten bei den diesjährigen Brunel Awards Zug und seine Stadtbahn: Als «sehr erfolgreiches architektonisches Projekt, in dem die Funktionalität und die räumliche Form zu einer wunderschönen Einheit finden», darf sich der Bahnhof Zug (HP 1-2/04) mit einem Award schmücken, zu dem sich gleich noch ein weiterer für James Turrells Lichtkunst gesellt – eine «konsequente, moderne und auf Raum, Architektur und Struktur bezogene Gestaltung», die den «Dialog mit dem städtischen Umfeld eröffnet». Den ‹Flirt›-Pendelzug, den auch die Zuger Stadtbahn einsetzt, würdigt die diesjährige Brunel-Jury in der Kategorie ‹Rollmaterial› als einzige Eingabe überhaupt mit einer Anerkennung für das «saubere, spielerische und inte-ressante Interieur». Als weiterer Bahnhof erhält die neue S-Bahn-Station Bern-Wankdorf einen Award für die «grosse skulpturale und künstlerische Qualität, die in Richtung einer neuen Typologie für Bahnhöfe weist». Zwei weiteren kleinen Stationen – Muntelier-Löwenberg und Längenbold – zollt die Jury ihre Anerkennung.
Überhaupt keine Awards gab es diesmal für ‹Rollmaterial› sowie für ‹Technische Infrastruktur und Umwelt›. Dafür dürfen sich die SBB mit zwei Anerkennungen schmücken: Die eine für die Landschaftsgestaltung Brunnmatten bei Langenthal entlang der Neubaustrecke Mattstetten–Rothrist, die andere für das Unterhaltszentrum in Genf. Dieser Bau wurde zum zweiten Mal eingereicht, was bei den Brunel Awards ausdrücklich erlaubt ist. Es kann also durchaus sein, dass Bauten, die diesmal keine Gnade fanden, etwa die Sanierung der Perronhalle in Lausanne oder die Passerelle und die Sanierung des Bahnhofs Basel, von der nächsten Jury als preiswürdig befunden werden.
Augenmerk auf Regionalbahnhöfe
Trotz des guten Abschneidens in diesem Jahr kann sich die Bahn nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Mit Sorge verfolgt Schaub die Folgen der Unternehmensreform: «Es besteht die Gefahr, dass jeder Bereich – Infrastruktur, Personenverkehr, Immobilien und Güterverkehr – seine eigenen Ziele verfolgt und der Blick aufs Ganze verloren geht. Darunter würde die Marke SBB leiden.» Mit der gemeinsamen Eingabe versuchen Johannes Schaub und Ueli Thalmann Gegensteuer zu geben, und sie legen Wert darauf, dass der ‹Flirt›-Pendelzug inmitten der baulichen Projekte gebührende Beachtung findet! Eine negative Folge des Auseinanderdividierens zeigt sich für Johannes Schaub auch bei den verwaisten Aufnahmegebäuden neben den gemäss Konzept ‹Faceliftung Stationen› umgestalteten Stationen: Für den eigentlichen Zugang zur Bahn ist die Infrastruktur zuständig, für die leer stehenden alten Bahnhöfe der Bereich Immobilien – für letztere sind sie Kostenfaktoren. Sie suchen nach Vermarktungsmöglichkeiten. Aber an vie-len abgelegenen Orten altern die Bahnhöfli dahin. «Dieses Problem ist noch nicht gelöst», stellt Johannes Schaub fest. «Immerhin macht man nichts kaputt», tröstet er sich und hofft auf Besserung. So werden die SBB in Zusammenarbeit mit der ETH untersuchen, welche vernetzten Möglichkeiten im ‹Bahnhof› noch stecken.
Generaldirektor Benedikt Weibel geht noch weiter: «Die Brunel Awards helfen uns, die Bahnhöfe weiterhin attraktiv und lebendig zu erhalten und ermöglichen so überhaupt erst eine gut durchmischte Mieterstruktur. So können Bahnkunden ihre Einkäufe während sieben Tagen in der Woche in den Stadtzentren tätigen.»
Die Verleihung des Wakkerpreises und der Brunel-Preis-segen bestätigen, was Bahnreisende immer wieder feststellen: Das gestalterische Niveau bei den SBB ist hoch. Das Augenmerk liegt hierzulande nicht nur bei den grossen Bahnhöfen und den schnellen Zügen, sondern auch bei den kleinen Stationen und den Regionalzügen. Wer kann da noch mithalten? «Dänemark», sagen Johannes Schaub und Uli Huber unisono.hochparterre, Fr., 2005.09.16
16. September 2005 Werner Huber
Stille Wucht der Geschichte
Im Herzen Berlins hat der Solothurner Landschaftsarchitekt Toni Weber einen Park gebaut. Im Spreebogen, wo die Preussen paradierten und wo sich Speers ‹Grosse Halle› hätte auftürmen sollen, waltet nun weite Leere. Toni Weber hat jedoch feine Bänder zur Vergangenheit gespannt.
So ruhig, wie Toni Weber von seinem grössten Auftrag erzählt, so ruhig ist der Park selbst. Weite, wenige Baumgruppen, grün. Eigentlich ist da nichts – bis auf zwei mit rostigem Stahl verkleidete Betonwände. Von Süden, also vom Abgeordnetenhaus und Kanzleramt her, sieht man sie aus dem Grund stossen und bedächtig die Erde anheben, bis sie zuvorderst, an der Spree, eine fast fünf Meter tiefe Grube aufgerissen haben. Dann ist wieder Ruhe, vorne dümpelt die Spree träge in ihrem Kanal.
Toni Webers Park ist ein stilles Land, aber ein tiefes. Heute flaniert man unbekümmert und freut sich an der Weite. Dabei hat es die Geschichte ernst gemeint mit diesem Ort im Herzen, ja im Mark Berlins. Immer wieder stilisierten ihn Machthaber zur politischen Mitte und Planer zur ideologischen Zelle, besonders seit dem Bau des Reichstags im Jahr 1894 (‹Geschichte des Spreebogens›). Was wollte ein Schweizer an diesem Ort dichter deutscher Geschichte? Sie zeigen, jedoch ohne Didaktik und ganz sicher ohne Romantik, sagt Toni Weber. «Die Geschichte selbst sollte Gestalt werden, der Entwurf selbstredend sein, sodass ich gar nichts würde erklären müssen.» Formen, das heisst für Toni Weber beschränken. «Grosszügigkeit und Zurückhaltung, gestaltet mit wenigen, aber ausdrucksstarken Elementen», schrieb er zu seinem Wettbewerbsprojekt von 1997. Noch heute, da um ihn herum längst wieder exzessiv geformt wird, verficht er den minimalen Ansatz: Mit Wenigem auskommen, damit dieses umso kräftiger wirkt. Am Spreebogen sei für ihn die Urbanität bestimmend gewesen, und mit Urbanität meint Weber die Gestalt des Bogens als seit Jahrhunderten menschgeprägtes Gelände. Also keine Idylle einfliegen, sondern mit dem arbeiten, was da ist.
Gespenstisches Loch
Da war nicht mehr viel ausser brachem Land. Toni Weber suchte das Wenige ab und fragte nach dessen Nutzen und Sinn für einen heutigen Park. Er kam auf zwei Dinge: Die Nord-Süd-Achse – unsichtbar im Brachland, doch jahrhundertelang bestimmend – und die Wege entlang der Spree, die während allen Epochen existiert hatten. Die Wege hat Toni Weber nur instand gesetzt. Der untere diente als Treichelpfad, man zog Schiffe spreeaufwärts; heute ist er wieder Teil der von der Jannowitzbrücke bis zum Schloss Charlottenburg reichenden Uferpromenade. Hinter ihr erhebt sich das ‹Deckwerk›, eine 3,5 Meter hohe und fast einen Kilometer lange Stützmauer, die den Spreebogen erst formt und festigt. Darauf verlief ebenfalls ein Geh- und Fahrweg. Wo das ‹Deckwerk› verfallen war, rekonstruierte Toni Weber es nicht, sondern beliess die gewachsenen Böschungen und führte den ‹Panoramaweg› mit Brücken darüber. Drei Abgänge verbinden ‹Uferpromenade› und den ‹Panoramaweg›: eine Treppe am Scheitel des Bogens und zwei Rampen an seinen Enden. Diese Rampen, Einschnitte ins Gelände, sah Weber als Grabungsorte. Gern hätte er den Schnitt durch das Erdreich, durch die geschichtete Geschichte zur Schau gestellt, doch gefiel dies der Bauherrschaft nicht. Also holte Weber die Vergangenheit mit Abbildern zurück. Im Einschnitt links des Scheitels, genannt ‹Spurengarten›, pflanzte er akkurat assortierte Blumenbeete, wie sie einst vor den Bürgerhäusern blühten. An dieser einzigen etwas üppigeren Stelle des Parks wird es fast «gärtelig», wie Weber selbst bemerkt. Für die einen irritierend in der sonst weiten Leere, für andere wohl der schönste, weil lieblichste Ort des Parks. Im Einschnitt rechts die ‹Gartenspur›: Eine kommune Blumenwiese bricht an einer Betonwand; eine Szene wie einst an der Berliner Mauer. Das mächtigste Abbild der Erinnerung jedoch ist der Graben in der Mitte des Parks. Perspektivisch überhöht und mit rostigem Stahl abstrahiert, führt er die Flucht der so oft bemühten, nie verwirklichten Nord-Süd-Achse vor. Toni Weber nennt die Kerbe verharmlosend ‹Landschaftsfenster›. Man hätte auf den Humboldthafen gegenüber schauen sollen. Die dortige neue Brücke machte Weber einen Strich durchs Bild, sie wurde höher als erwartet; jetzt blickt man geradeaus an die Brückenwange. Dennoch ist die Grube eindrücklich. Denn sie zeigt auf gespenstische Weise, wie all die euphorischen Planungen ins Leere liefen – was bleibt, ist ein Loch.
Picknick mit der Kanzlerin?
Seinen Anspruch, mit wenigen, umso stärkeren Mitteln zu gestalten, hat Toni Weber also eingelöst. Räumlich wie formal ist sein Konzept klar und streng. «Der Entwurf besticht durch Grosszügigkeit und Ruhe. Alle Bereiche sprechen die gleiche Sprache», schrieb 1997 die Jury, der unter anderen Dieter Kienast und Guido Hager angehörten. Vielleicht half nicht zuletzt diese Klarheit dem Projekt, die achtjährige Planungs- und Bauzeit fast unbeschadet zu überstehen. Verteilkämpfe um das immer knappere Geld, nicht enden wollende Diskussionen um die ‹Planungsprioritäten› in der Hauptstadt und unzählige ‹Stop-and-Goes› prägten die Ausführungsphase. Dass man ihn im rauen Berlin nicht wegmobbte, schreibt Weber auch dem Geleit zu, das er und das Projekt erhalten hätten. Am meisten freuten sich nämlich die Schweizer in Berlin über seinen Erfolg, unter ihnen der damalige Schweizer Botschafter Hans Widmer, der für die richtigen Kontakte sorgte.
Und wie steht es mit Toni Webers Wunsch, «nichts erklären» zu müssen? Von all den Bändern zwischen Gestalt und Geschichte erfährt man vor Ort nichts, es gibt eben keine Didaktik. Das ist einerseits schade, denn erst mit diesem Wissen durchmisst man die Tiefe dieser Landschaftsarchitektur. Andererseits stöhnten die Berliner: Nicht noch eine Gedenkstätte! Dieser Park sollte zum Vergnügen da sein. Vorne an der Spree eröffnet bald ein Café, auf den schiefen Rasenflächen sollen Konzerte stattfinden und die ‹Berliner Zeitung› freut sich auf Fussball mit dem Kanzler (oder auf ein Picknick mit der Kanzlerin?). Auch ist der Spreebogenpark im Rennen um den Platz, wo nächstes Jahr das Fussball-
WM-Fest stattfinden soll. Dafür ist dieser Ort jetzt da, damit die Weite neu gefüllt wird.hochparterre, Fr., 2005.09.16
16. September 2005 Rahel Marti
verknüpfte Bauwerke
Spreebogenpark