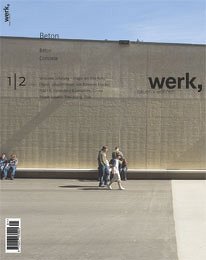Editorial
Beim Bau des Kolosseums (72-80 v.Chr.) und des Pantheons (118-121 n.Chr.) bedienten sich die römischen Bauleute einer Technik, die sie „opus caementitum“ nannten. Dieser Begriff bezeichtete gleichzeitig auch den Baustoff: eine Mischung aus Steinen, Sand, Wasser und gebranntem Kalkstein, die in freien Schalungsformen Bauteile von erstaunlicher Festigkeit zu giessen erlaubte. Im Mittelalter war diese Bauweise weniger geläufig, wenn auch besonders an der Wende zur Neuzeit das Giessen von Kunststeinen, die anschliessend zu feinen Masswerken bearbeitet wurden, eine kurze neue Blüte erfuhr. Bis der Gärtner und Baumeister Joseph Monier im Jahr 1848 mit seinen eisenbewehrten Blumentöpfen die Betontechnologie revolutionierte, vergingen Jahrhunderte. Seitdem ist Beton zum allgegenwärtigen Baustoff geworden, dem nicht nur in statischer, sondern auch in ästhetischer Hinsicht kaum Grenzen gesetzt ist.
Von der Vielfalt seiner spezifischen Eigenschaften zeugt allein schon die Tatsache, dass man den Beton heute nach seinen unterschiedlichen Rohdichten (Schwerbeton, Leichtbeton), nach der Art der Zuschlagstoffe (z.B. Kiesbeton, Bimsbeton, Schlackenbeton etc.) oder deren Körnung (Feinbeton, Grobbeton), nach der Art des Einbringens (Schüttbeton, Pumpbeton), des Verdichtens (Rüttelbeton, Stampfbeton, Schleuderbeton etc.) und nach der Art seiner Oberfläche (Sichtbeton, Waschbeton etc.) auseinander hält. Bleibt die Oberfläche sichtbar zeigt sie das Spiegelbild seiner Schalungshaut, die ihrerseits wiederum ganz unterschiedlich beschaffen sein kann. Bauen mit Fertigbetonelementen unterscheidet sich statisch, konstruktiv wie gestalterisch vom Bauen mit Ortbeton. Mit selbstverdichtendem Beton, dessen Innovationspotential weiter erforscht wird, ist sogar das Giessen komplizierter Formen und gegen die Schwerkraft möglich. In eingefärbtem, strukturiertem und vielgestaltig nachbearbeitetem Beton gibt es historische wie neue Beispiele, die beweisen, dass das Material mitnichten „stumpf und grau“ ist, sondern eine verfestigte Gussmasse, mit der Vieles möglich wird.
Mit Beton zu bauen ist ein komplexer Prozess, der ebenso von der naturwissenschaftlich exakt begründeten und erprobten Technologie wie vom stoffimmanenten Geheimnis lebt, das bis zum Ausschalen in der Magie der Mischung und auch im Zufälligen verborgen bleibt. Darin liegt auch ein Teil der Faszination des Baustoffs, der immer wieder zu neuem Experimentieren Anlass gibt. Dabei wurde und wird das Innenleben ebenso wie die äussere Erscheinung des Materials immer wieder aufs Neue ausgekundschaftet. Von diesem lustvollen Ausloten der Möglichkeiten handelt diese Nummer, in der wir alte und neue, hiesige und entfernte Bauten aus Beton vorstellen. Allen gemeinsam ist der Zauber, der ähnlich wie beim Glockenguss nach der Vollendung im Klang des gelungenen Werkes nachhallt. (Die Redaktion)
Inhalt
Thema
Ákos Moravánszky:
Verlorene Schalung?
Alois Diethelm:
Magie der Mischung
Die Zusammensetzung von Beton
Adrian Forty:
Ohne Zeit
Jacques Lucan:
Ganzheit und Unteilbarkeit
Haus K + N, Valerio Olgiati
Reto Gadola:
Ein Kleid aus Beton
Orientierungsschule in La-Tour-de-Trême, sabarchitekten
Arthur Rüegg:
Robuster Skelettbau, vorfabriziert
Betriebs-und Bürogebäude EW Buchs, von Ballmoos Krucker Architekten
Martin Tschanz:
Kein Streichelbeton
Bauzentrum München-Riem, Hild und K Architekten
Joseph Abram:
Volumen Masse Farbe
Psychiatrisches Spital in Yverdon-les-Bains, Patrick Devanthéry und Inès Lamunière
Hasan-Uddin Khan:
Vertikale Verzahnungen
Kanchanjunga Apartments Bombay, Charles Correa
Forum
Kolumne: Wolfgang Ullrich
EFH: Haus Wolf in Triesenberg, Märkli/Kühnis Architekten
Wettbewerb: Lugano
Wettbewerb: Maag-Tower in Zürich
Bauten: Zeitungsspedition Aarau | KVA Thun
bauen +rechten
Ausstellungen: Swiss Design 2004 | Licht-Raum x ArchiSkulptur x Panos Koulermos
Bücher: Architekturen des Augenblicks | FavelaMetropolis
Ausstellungen | Veranstaltungen | Wettbewerbe | Neuerscheinungen | Produkte
Vorschau | Impressum
werk-Material
Frei Architekten AG, Aarau: Neubau Zeitungsspedition, Aarau
Andrea Roost, dipl.Architekt BSA/SIA/SWB, Bern: Kehrichtverbrennungsanlage Thun, BE
Verlorene Schalung?
Verlorene Schalung nennt man jene Gussform, die nach dem Erhärten des eingefüllten Betons nicht entfernt wird, sondern dauerhaft und oft augenfällig an Ort und Stelle bleibt und nicht wieder benutzt wird. Für den weiteren Bauprozess ist die Schalung zwar verloren, am sichtbaren Bau jedoch nicht. Dies ist nur eine der Paradoxien der Schalung. Eine Betonoberfläche mit dem Abdruck der hölzernen Schalungsbretter erlaubt uns, die Widersprüchlichkeit der architektonischen Wahrheit ins Auge zu fassen. Die Holzstruktur der Betonoberfläche ist eine Täuschung, die einem technischen Objekt den Anschein der Natürlichkeit verleiht. Sie entspricht jedoch ganz der technischen Wahrheit des Bauens, weil sie als Dokument des Herstellungsprozesses die Spuren der verwendeten Schalbretter trägt.
Besonders in der frühen Phase des Betonbaus spürt man die Faszination eines Stoffes, welcher der Gestaltung keinen Widerstand leistet und keine eigentliche Identität zu haben scheint. Claude Lévi-Strauss bezeichnet in «Das wilde Denken» die rohe und oft zu unvorgesehenen Ergebnissen führende Tätigkeit des Giessens als «bricolage». Das wilde Basteln von Bauherren ohne technische Ausbildung erreichte seinen spektakulären Höhenpunkt in Henry Chapman Mercers Museumsgebäude in Doylestown, Pennsylvania. Lévi-Strauss' «mythopoetischer Charakter der Bastelei» trifft auch für die Werkstatt von Antoni Gaudí (1852-1926) zu, der die Schalung als Möglichkeit für die direkte Übertragung der Form ohne zeichnerische Projektion verstand. Irving Gill (1870-1936) fasste den Beton als natürliches Material auf und experimentierte mit einem «tilt-slab» genannten Schalungsverfahren, bei dem die Aussenmauern der Häuser an Ort und Stelle in horizontale Schalformen gegossen, und dann in die senkrechte Position gekippt wurden. Der ungarische Architekt Béla Sámsondi Kiss (1899-1972) erfand ein Verfahren mit gerippten Schalungen, die, unter drastischer Reduktion des Baugewichts, bei Betonbauten eine ähnlich präzise Bauweise wie im Stahlbau erlaubte. «Häuser können wie Keramikgefässe gegossen werden», sagt Paolo Soleri (*1919), der seit 1970 in der Wüste von Arizona an der visionären Stadt Arcosanti baut. Für den Guss riesiger Betonbögen nutzt er die Erkenntnisse aus der Keramikherstellung.
Heute werden Strukturelemente auch mit elastischen Schalungen hergestellt; das Spritzen von Glasfaserbeton in dreidimensionale Schalungen erlaubt frei geformte Fassadenschalen. Mit Computer ausgefräste Schalungen werden für «architectures non-standard» eingesetzt. Je umfassender und wirkungsvoller das System, desto grösser die technische Kontrolle über die Schalung und hinter der Schalung, die die Illusion des «non-standard» Einzelstücks produzieren soll. Das ist eine neue Funktion der Schalung, die – paradoxerweise – sichert, dass wir sie nie verlieren werden.werk, bauen + wohnen, Fr., 2005.01.14
14. Januar 2005 Ákos Moravánszky
Magie der Mischung
Die Zusammensetzung von Beton scheint simpel. Trotzdem wird weltweit intensiv geforscht, denn das Gelingen hängt von so vielen Faktoren ab, dass eine Rezeptur nur so gut ist wie der Erfahrungsbericht dazu. Ein Bericht, der nicht nur Aussagen zur Beschaffenheit und Dosierung der Zutaten macht, sondern auch den Weg vom Betonwerk zur Baustelle beschreibt, die Temperatur vom Frischbeton und der Aussenluft festhält oder die Verarbeitungsdauer erwähnt. Anhand von zwei neueren Mischungen, dem Konstruktionsdämmbeton und dem selbstverdichtenden Beton (SVB), wird dieser Sachverhalt erläutert. Das sind zwei Betonsorten, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Während mit der einen möglichst dicke Bauteile hergestellt werden, um einen guten Dämmwert zu erzielen, ist die andere für schlanke Konstruktionen prädestiniert.
SVB wurde um 1980 in Japan entwickelt, weil man sich immer häufiger mit einer schlechten Betonqualität konfrontiert sah, die auf mangelhafte Verdichtung zurückgeführt wurde. Seither haben sich die Anwendungsbereiche stetig ausgedehnt. So ist SVB in der Vorfabrikation weit verbreitet, und er findet überall dort Anwendung, wo der Bewehrungsgehalt aussergewöhnlich hoch ist. Da selbstverdichtender Beton nicht zwingend von oben in die Schalung eingebracht werden muss, bietet er sich auch für Umbauten und Sanierungen an. Ebenso können grössere Abschnitte aufs Mal betoniert werden als bis anhin, da Steighöhen von 8 m als normal gelten und das Fliessvermögen viel besser ist als bei herkömmlichem Beton.
Will man bei Aussenwänden beidseitig Sichtbeton, führte in der jüngsten Zeit kein Weg an einer zweischaligen Ausführung vorbei. Selbst wenn Beton nur aussen in Erscheinung treten soll, erweisen sich die bekannten Möglichkeiten als aufwändig. Deshalb stösst die Kunde von einem Beton, der die aktuellen Wärmedämmvorschriften ohne technische Kniffe erfüllt, bei Architekten auf offene Ohren. Denn es ist sehr viel erreicht, wenn das Bauen einfacher wird und sich auf der Baustelle Arbeitsschritte und Fehlerquellen reduzieren lassen. All dies vermögen die zeitgenössischen Konstruktionsdämmbetons zu leisten – solange die Wände übereinander stehen und die Fenster nicht zu gross sind. Denn es gilt: je poröser das Material, desto höher der Dämmwert, aber umso geringer die Festigkeit.werk, bauen + wohnen, Fr., 2005.01.14
14. Januar 2005 Alois Diethelm
Ohne Zeit
A concrete structure is very like a photograph. On its surface are fixed permanently the marks of its making – like Roland Barthes's definition of photography, it is a record of a moment that-has-been.
This similarity, between concrete as it sets, and photographic film as it is exposed, makes concrete different to other building materials, and puts it at a disadvantage when it comes to the representation of time. Conventional construction communicates time in various ways, most obviously through weathering. It is sometimes said that weathering completes the work – only when time and human use have either worn away the surface or added a patina to it does a building attain maturity.
Concrete does not lend itself to this kind of gradual and progressive ageing. Most concrete buildings are condemned either to permanent newness, or to instant decrepitude. Whatever visible ageing they undergo often happens within a very short time of their completion. Indeed, staining and shrinkage cracks can sometimes make a concrete building look old even before it is finished – after which there may be very little further change in the building's appearance for another half century. On the other hand, concrete can remain looking perpetually new. At Louis Kahn's Salk Institute, the concrete has hardly changed since it was cast, and all the evidence of ageing is concentrated upon the weathering of the untreated timber. But the everlasting newness of concrete is more than a matter of surface appearance: concrete architecture is fixated on the belief that concrete is a new material, a material without a history, a material entirely directed towards the future. The backward glance, the inevitability that the frozen present will become a past (which for Barthes gave photography its poignancy) rarely enters into the aesthetics of concrete. To treat concrete as a historical material (which would not be so unreasonable given that it has been around for well over a century) goes against all that we have been led to believe about it. Concrete limits a building to being eternally new.
For these reasons, concrete has not lent itself to showing time. Concrete is, we can say, untimely matter; it never speaks in more than one tense, generally the present, sometimes the future, and almost never the past. Yet for time to be present in a work of art, there must be an awareness of different temporalities. In the novel, characteristically this is achieved by the present time of the narration and the past time of the story being told. In a photograph (and here concrete is not so like photography) there is always a tension between the future implicit in the image, and our knowledge that that future is now past: this is what Barthes meant when he wrote „each photograph always contains this imperious sign of my future death“. And in architecture, while traditional materials can be used to create some of these temporal disjunctions, with concrete it is more or less impossible. Concrete does not easily make us aware of time, for it rarely deals with more than one temporality.
Can concrete be made to overcome this disability? Over the last half-century, there have been various experiments directed at concrete's untimeliness. One such was BBPR's Torre Velasca in Milan, but this was widely condemned; Tafuri described it as „impure“, „contaminated“ and „dirty“ because of the way past and present time were mixed in its appearance, and a similar mixing occurred in the various treatments of the concrete from which it was made. Yet a little „dirty time“ does us no harm, on the contrary, it is what allows us to recognise time and temporality.
Another, more recent, experiment is a house and office in North London, completed in 2000, designed by Sarah Wigglesworth and Jeremy Till for their own use. The site adjoins the mainline railway, and to insulate the office building from the noise of trains, it is protected by a wall of sandbags. The sandbags contain a sand, cement and lime mix which was wetted after they were laid, and set hard. In the four years since the building was completed, sunlight has rotted the bags away, and the wall has emerged as concrete; for a time, the marks of the bags were left imprinted on the surface, but now, rain and atmospheric conditions are breaking down the surface and it is being eroded. We can see the concrete of the wall as not simply the result of an instant, a frozen moment, but also as something that is made slowly, revealing itself as an unpredictable and long drawn out process. The architects write about it, „Most walls are detailed to shrug off the effects of time, but this is a wall that has been designed to allow time to pass through it, and thereby to modify it; an evolutionary architecture“. It is an attempt to overcome the photograph-like arrested moment that is the usual fate of concrete, and to extend concrete's vocabulary beyond the single tense to which it is normally restricted.
The office stands on piers and is cushioned by springs against the vibration of passing trains. The piers are gabions, filled with recycled crushed concrete. We are made aware of concrete as something that is not necessarily always bound to the present, but as a historical material, which had a previous life, maybe in a now demolished tower block. The structural system used here is new, for a domestic building, but the material is old, it comes with a history. The gabions suggest a double time - a past once filled with optimism but now discredited, and a present in which that past is not buried, but given a place.
The attempts of the Wigglesworth and Till house to overcome concrete's untimeliness show that rather than remaining restricted to the present tense, like the clumsy attempts of the novice learning a foreign language, concrete could be made to progress to a more varied vocabulary that includes some past tenses.werk, bauen + wohnen, Fr., 2005.01.14
14. Januar 2005 Adrian Forty