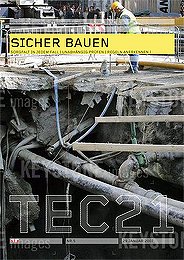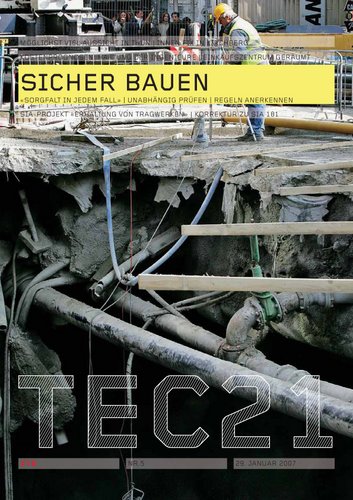Editorial
sicher bauen
Die Bilder der eingestürzten Eissporthalle in Bad Reichenhall, der Messehalle in Kattowitz oder der Markthalle in Moskau wurden durch Rückblicke zum Jahresende auf den schneereichen Winter letztes Jahr wieder ins Bewusstsein gerufen. Die Fachwelt beschäftigte sich jedoch auch während des Sommers mit den Einsturzursachen. Untersuchungen zeigten, dass zum Beispiel in Bad Reichenhall Schnee und Eis nur der Auslöser waren. Die Schneelast war geringer als die zur Berechnung herangezogenen Höchstwerte. Es führten vielmehr Konstruktionsfehler zum Einsturz. Hinzu kommt, dass bis heute keine Prüfstatik des Daches gefunden wurde. Hätte damit ein Einsturz verhindert werden können?
Neben Konstruktions- und Materialfehlern können auch Naturgefahren zu schwere Schäden an Bauwerken führen. Ob Lawinen, Erdbeben oder Überschwemmungen – sobald Menschen betroffen sind, wird in der Gesellschaft diskutiert. Weltweit finden Ereignisse solcher Art statt. Sie werden oft mit Schrecken, aber auch aus einer gewissen räumlichen Distanz wahrgenommen. Genauso ist aber das Gefahrenpotential in der Schweiz vorhanden. Wie sieht es mit nicht eingehaltenen Regeln der Baukunde aus, die keine Menschen gefährden, sehr wohl aber Schadenpotenzial beinhalten?
Sicher bauen fängt schon vor der Haustür an. Gefahren können im täglichen Bauablauf entdeckt werden. Nicht ausreichend gesicherte Gräben, zu steil abgeböschte Baugruben, Gerüste oder Abschrankungen, deren Aufbau nicht den Regeln entsprechen. Ganz allgemein: ungenügend berücksichtigte Gefährdungsbilder. Um sicher zu bauen, sind in jeder Phase des Planungs- und Bauablaufs Sorgfalt und Umsicht gefragt.
Im ersten Artikel diskutieren Fachleute über diese alltägliche Situationen und die Konsequenzen im Schadenfall. Darauf aufbauend sucht der zweite Artikel die Antwort auf die Frage, ob der Einsatz von Prüfingenieuren hilft, Schäden zu minimieren. Am Beispiel der Naturgefahr Erdbeben wird im dritten Artikel schliesslich die Einhaltung der technischen Normen diskutiert.
Der SIA vergab erstmals in diesem Jahr eine Auszeichung mit dem Titel «Umsicht – Regards – Sguardi», die im beigelegten Dossier TEC21 publiziert wird. Unter den insgesamt 59 Projekten wurden 10 ausgewählt, von denen 7 eine Auszeichnung, 2 eine Anerkennung erhielten. Ausserdem wurde ein Spezialpreis verliehen. Alle Ergebnisse werden in einer Ausstellung gezeigt, die in diesem Jahr durch die Schweiz tourt. Ab dem 15. März ist sie im ETH-Hauptgebäude Zürich zu sehen.
Clementine van Rooden, Daniela Dietsche
Inhalt
Wettbewerbe
Möglichst viel Aussicht in Thun / Innen fix in Kirchberg
Sorgfalt in jedem Fall
Clementine van Rooden, Daniela Dietsche
In einem Gespräch diskutieren der Jurist Jürg Gasche, der Architekt Werner Ramseier und der Bauingenieur Erich Ramer über die Abgrenzung der Verantwortung und die Gratwanderung der Beteiligten beim Bauen.
Unabhängig Prüfen
Martin Deuring, Carlo Galmarini
Die Frage, ob durch den Einsatz eines Prüfingenieurs vorhandene Defizite im Bauprozess beglichen werden können, gewinnt mit jedem veröffentlichten Schadensfall wieder mehr an Bedeutung. Eine Stellungnahme aus der Praxis.
Regeln anerkennen
Walter Maffioletti
Während dem Planen und Bauen taucht die Frage nach der Zuständigkeit der Planer für die Einhaltung der technischen Normen auf. Welche Normen dabei als anerkannte Regeln der Baukunde gelten und wie die Haftung geregelt ist, wird am Beispiel des Lastfalles Erdbeben beschrieben.
Magazin
Aus dem SIA
Produkte
Impressum
Veranstaltungen
«Sorgfalt in jedem Fall»
Bilder eingestürzter Brücken oder Gebäude werfen Fragen nach den Gründen, der Verantwortung und den Konsequenzen auf. Drei Fachleute diskutierten über die Abgrenzung der Verantwortung und die Gratwanderung der am Bau Beteilig-ten. Besteht ein Zusammenhang zwischen Schadenfällen und tiefen Honoraren? Welche Rolle spielen Fachkompetenz und Vertrauen? Inwiefern sind Technische Normen verbindliche Berechnungsgrundlage.
TEC21: Die Baubranche steht heute unter enormem Kosten- und Termindruck. Ist es unter solchen Bedingungen möglich, spontane Entscheidungen zu treffen, die den juristischen Gegebenheiten standhalten?
Erich Ramer: Grundsätzlich kann man solche Entscheidungen auf der Baustelle schon fällen. Aber gerade bei Grabenbauten sieht man regelmässig heikle Situationen. So kam mir auch schon ein Graben zu Gesicht, der unmittelbar neben den Gleisen senkrecht in den Baugrund «abgetieft» war. Er stand, aber es hätte auch genau anders sein können!
Wie kommt es zu diesen heiklen Situationen im Bauprozess?
Walter Ramseier: Wenn zum Beispiel die Planung in Frage oder auf den Kopf gestellt wird. Man plant etwas korrekt, und es ist sowohl ingenieurmässig als auch vom Bauablauf her abgesichert. Der Gesamtprojektleiter kennt zu diesem Zeitpunkt den Ablauf. Wird die Ausführung kurzfristig umgestellt, können die Unfälle passieren. In den meisten Fällen sind solche kurzfristigen Anpassungen Optimierungsangelegenheiten. Man will Kosten und Zeit einsparen. Das ist das tägliche Brot in einem Bauablauf: Wie können wir schneller und billiger bauen. Dieser Mechanismus von Änderungen technischer Abläufe findet auf der Baustelle oft statt. Die Schwierigkeit liegt darin, die richtige Einschätzung vorzunehmen. Es gehört zu den Aufgaben des Gesamtprojektleiters, hier den Finger aufzuheben und auf die Risiken aufmerksam zu machen.
Jürg Gasche: Auch aus meiner Sicht passiert immer dann etwas, wenn Abläufe geändert werden. Baustellen sind dynamisch. Dass die Beteiligten in einem solchen dynamischen Prozess Änderungen vornehmen können, ist natürlich zwingend. Für die Fachleute ist es darum eine Herausforderung, Änderungen in den dynamischen Abläufen so zu steuern, dass nichts passiert.
Trotzdem müssen die Regeln der Baukunde eingehalten werden. Kann diese Forderung in der Praxis umgesetzt werden?
Jürg Gasche: Wie man das macht, ohne dass Menschenleben gefährdet werden, müssen die Fachleute diskutieren. Auf jeden Fall müssen im Moment des Bauens die dann gültigen Regeln der Technik erfüllt sein. Dass sich diese immer weiter entwickeln, ist klar. Trotzdem kann man nicht alle Häuser im gleichen 10-Jahres-Takt, in dem technische Normen überarbeitet werden, nachrüsten. Wenn jedoch beispielsweise ein grosser Umbau vorgenommen wird, dann müssen sich die Planer damit auseinandersetzen, was der aktuelle Stand der Regeln der Technik ist. Es muss zwingend geklärt werden, was aus Sicherheitsgründen baulich angepasst werden muss.
Erich Ramer: Bei Umbau und/oder Nutzungsänderungen sind die neuen Normen einzuhalten. Wird aber weder an der Nutzung noch am Bauwerk etwas geändert, soll (ausser bei offensichtlichen Fehlern) das Bauwerk belassen werden, wie es seinerzeit dimensioniert wurde. Ein aktuelles Beispiel ist die Erdbebensicherheit. Nur wegen der Normen können wir nicht sämtliche Gebäude in der Schweiz erdbebentechnisch nachrüsten.
Jürg Gasche: In einem Fall beauftragte der Bauherr einen zweiten Ingenieur, weil der Erstbeauftragte gestorben war. Er überprüfte die Dimensionierung seines verstorbenen Kollegen und stellte fest, dass dieser mit den alten SIA-Normen gerechnet hatte. Die statische Berechnung der Tiefgarage entsprach somit nicht den gültigen Normen. Das Bauwerk war aber schon in der Ausführung. Die Haftpflichtversicherung des Verstorbenen übernahm die Mehrkosten der Anpassungen an die aktuelle Norm.
Erich Ramer: Das ist ja das Beste, was einem passieren kann. Aber wenn dieser nun nicht gestorben wäre?
Jürg Gasche: Dann hätte der Bauherr ein Bauwerk erhalten, das nicht den neuen Normen entsprechend dimensioniert gewesen wäre. Wahrscheinlich hätte auch das gehalten. Es ist eben beim Bauen so, solange etwas hält, auch wenn es gegen die Regeln der Technik verstösst, wird niemanden belastet: «Wo kein Kläger, da kein Richter». Zur Sorgfaltsspflicht des Fachmanns gehört aber, dass er seine Bauherrschaft darauf hinweist, wenn er eine Verletzung der Regeln der Technik bemerkt.
Wird man so nicht bei jedem Projekt «frecher» in der Dimensionierung? Sind Schäden eine Frage der Zeit, und häufen sich die Schadensfälle?
Erich Ramer: Frecher zu werden darf man sich als Ingenieur nicht leisten. Baustellen, auf denen nichts passiert, gelten nicht als Referenz. Man muss sich auf Erfahrungen stützen, die mit Berechnungen oder vielleicht sogar mit Kontrollmessungen gemacht wurden. Einstürze von fertigen Bauwerken sind übrigens eher die Ausnahme. Eine ungenügende Bemessung führt in der Regel nicht gleich zum Einsturz. Häufiger sind Einschränkungen der Gebrauchstauglichkeit. Ausserdem laufen Bauzustände eher Gefahr, bei der Bemessung vergessen zu werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, die einzelnen Bauzustände systematisch anzugehen und alle Gefährdungsbilder zu erfassen. Dies ist wiederum eine Termin- und Honorarfrage. Mehr Geld heisst mehr Zeit. Wenn ich die Zeit habe, sorgfältiger nachzudenken, dann komme ich auch auf die relevanten Gefährdungsbilder. Wenn ich aber alles in Rekordzeit durchpauken muss, dann ist das Risiko grösser, dass ich das eine oder andere Gefährdungsbild übersehe.
Jürg Gasche: Zu beachten ist, dass rein juristisch gesehen sogar der Fachmann, der gratis arbeitet, trotzdem verpflichtet ist, sorgfältig zu arbeiten. Die Relation zwischen Honorar und Denkkapazität gibt es aus rechtlicher Sicht nicht. Wenn etwas passiert und die Untersuchung beginnt, werden die Juristen nicht zuerst sagen: «Aha, er hat nur 50 % vom üblichen Honorar erhalten. In diesem Falle müssen wir das Auge um zwei Viertel zudrücken.» Im Gegenteil, die Gesellschaft erwartet volle Sorgfalt in jedem Fall. Aber um der Sorgfaltspflicht nachzukommen, muss das Honorar stimmen. Man kann auch nicht einen Esel dazu bringen, eine Karre zu ziehen, ohne ihm jemals zu saufen zu geben!
Wie beurteilen Sie die derzeitige Honorarsituation in Bezug auf die Denkkapazität?
Walter Ramseier: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man mit den Honoraransätzen nach SIA 102 und den seit 2005 geltenden z-Werten klar kommt. Mit dem für mein Büro ermittelten Stundenansatz können wir die erwartete Leistung erbringen. Bei Ansätzen, die mehr als 10 % darunter liegen, gibt es ein Problem.
Erich Ramer: Im Tiefbau liegen die Honorare manchmal um 50 % oder mehr unter jenen, die man nach Honorarordnung ermitteln würde. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu erreichen. Ich kann einerseits weniger Leistung anstreben. Andererseits kann ich die Löhne der Mitarbeiter drücken und von ihnen verlangen, dass sie Gratisstunden leisten. Dann komme ich mit weniger bezahlten Stunden durch. Wenn Bezahlungen von nur 20 bis 50 % der empfohlenen SIA-Honorare angeboten werden, kann der Aufwand nicht einfach mit Rationalisieren und Erfahrung reduziert werden. Das birgt Risiken. Das sind zusätzliche Kostenrisiken neben den bereits angesprochenen Fehlerrisiken. Oft wird versucht, Zeit und somit Geld zu sparen, indem einfach weniger optimiert und sicherer bemessen wird. Der Bauherr hat dann zwar die teuren Bauten, hat aber ein paar Franken Honorar gespart.
Jürg Gasche: Das ist ein ganz wichtiger Ansatz, den Sie ansprechen! Man tut ein wenig mehr Eisen rein und dann hält’s. Das ist eine wichtige Relation: Was ist die Ersparnis am Ingenieur-Honorar in Franken und was die Bauverteuerung, die damit ausgelöst wird. Wenn klar dargelegt werden könnte, dass hier quasi eine Hebelwirkung besteht: Ein Franken gespartes Honorar bedeutet beispielsweise drei Franken teureres Bauen, dann müsste der Bauherr ganz klar sagen: «Dann legen wir lieber einen Franken drauf. Wir investieren zwar mehr in die Planung, das Bauen hingegen kostet uns weniger. Am Schluss haben wir insgesamt weniger ausgegeben!»
Walter Ramseier: Da staune ich jedes Mal wieder. Warum reiten die Bauherren auf den Honoraren rum? Es ist der kleinste Teil, gemessen an der Bausumme. Wenn sie eine gute Planerleistung haben, können sie wirklich Geld sparen.
Sind für Schadensfälle die Honorare der Grund allen Übels?
Walter Ramseier: Die niedrigen Honorare und Werklöhne sind bestimmt mit eine Ursache für das hohe Tempo, das auf den Baustellen vorgelegt wird. Das lässt das Risiko steigen. Meines Erachtens hat aber auch der Unternehmer grossen Einfluss darauf, einen Schaden zu verhüten oder zu verursachen. Dort sehe ich ein viel grösseres Gefahrenpotenzial als bei den Planern. Es sind die komplexen Zusammenhänge, aber auch die Schnittstellen in den Bauabläufen, die Fehler, Bauschäden und Unfälle forcieren. Zudem ist jeder Bau ein Prototyp. Das macht die Sache auch nicht einfacher.
Jürg Gasche: Wie konfrontieren denn Architekten den Bauherrn mit einem innovativen Projekt, das Prototyp-Charakter hat? Sagen sie dem Bauherrn: «Wenn Sie diese Lösung wollen, dann haben Sie etwas Spezielles, tragen jedoch mehr eigene Verantwortung»? Angenommen die Verantwortung wird nicht übernommen, zieht der Architekt dann eine konventionelle Lösung vor?
Walter Ramseier: Das machen Architekten nie, denn Architekten sind so ehrgeizig, dass sie das Risiko eingehen. Sie versuchen, sich in einem solchen Fall vielmehr abzusichern.
Innovation ist ein Risikofaktor. Stellen die Normen und Regelwerke heute eine Innova-tionsbremse dar?
Walter Ramseier: Als Innovationsbremse würde ich die SIA-Normen nicht bezeichnen. Es ist vielleicht so, dass sie das Bauen manchmal verkomplizieren. Der Aufwand, ständig auf dem neusten Wissenstand zu sein, ist verhältnismässig gross und sollte nicht unterschätzt werden.
Erich Ramer: Man kann sich nach gewissen Regeln auch ausserhalb der Norm bewegen, durch Versuche und Berechnungen nachweisen, dass der Sicherheit trotzdem Genüge getan ist. Normen sind darum eindeutig keine Innovationsbremse.
Jürg Gasche: Zur juristischen Absicherung müssen die Vereinbarungen ein Kapitel zu «Abweichungen von den Normen» enhalten. Ich empfehle bei Innovationen den Abweichungsvorgang, den darüber geführten Dialog zwischen Planer und Bauherr sowie die vom Bauherrn gefällten Entscheidungen akribisch zu dokumentieren.
Ist ein Schaden eingetreten, wird der Schuldige gesucht. Wer übernimmt die Verantwortung?
Walter Ramseier: Klare Richtlinien regeln die Verantwortung. Fehlen solche Richtlinien, kann in einem Schadenfall jeder am Bau Beteiligte in die Pflicht genommen werden. Als verantwortlicher Gesamtprojektleiter kann ich mich nur schützen, indem ich mich bei Spezialisten absichere.
Jürg Gasche: Der Gesamtprojektleiter hat eine Führungs- und Managementfunktion. Er ist verpflichtet kritische Fragen zu stellen und sich seriöse Entscheidungsgrundlagen zu verschaffen. Er darf sich nicht ohne weiteres auf das Urteil eines Spezialisten verlassen, wenn er keine Schuldzuweisung riskieren will.
Erich Ramer: Ich bin oft als Gesamtprojektleiter tätig und habe mit Spezialisten aus Fachgebieten zu tun, von denen ich selbst wenig oder nichts verstehe. Es würde mich stören, wenn der Richter mir ein Fachurteil zumessen würde, auf einem Gebiet für dessen Fragen ich einen Spezialisten zugezogen habe.
Wenn ich mich in die Rolle des Spezialisten versetze, masse ich mir an, für mich zu entscheiden, ob ich aus Erfahrung oder aus dem Bauch die Sachlage beurteilen kann oder, ob ich eine Berechnung brauche, um den Sachverhalt nachzuweisen. Wenn ich am Tisch sage: «Das ist für mich sonnenklar, das muss ich nicht noch einmal rechnen!», dann erwarte ich, dass mir der Gesamtprojektleiter das auch abnimmt. Umgekehrt muss sich der Gesamtprojektleiter auch darauf verlassen können, wenn sein zugezogener Spezialist behauptet: «Jawohl, ich habe mir das jetzt gerade überlegt, es ist für mich klar.»
Sie haben schon recht, ich bin auch der Meinung, der Gesamtprojektleiter muss nachfragen. Wenn dieser dafür aber immer eine Berechnung auf Papier verlangen müsste, würde mir dies zu weit gehen.
Jürg Gasche: Würde es Ihnen als Spezialist zu weit gehen oder würden Sie als Gesamtprojektleiter nicht so weit gehen wollen?
Erich Ramer: In beiden Rollen. Ich bin der Meinung, der Spezialist muss in der Lage sein, zu entscheiden, ob er eine Berechnung braucht, um etwas zu beurteilen oder ob er es ohne Berechnung nachweisen kann.
Die fehlende Fachkenntnis ist die eine Seite. Wer übernimmt die Verantwortung, wenn Aufgaben aus Kapazitätsgründen abgegeben werden?
Jürg Gasche: Man kann ja niemals alles selber machen. Wenn man aber aus Kapazitätsgründen eine Aufgabe delegiert, so trägt man die volle Verantwortung. Immer.
Erich Ramer: Es kommt ausserdem darauf an, wie man das Arbeitsverhältnis mit dem Auftraggeber vertraglich geregelt hat. Werden separate Verträge abgeschlossen, ist in jedem Vertrag auch eine gewisse Verantwortung zugewiesen. Hoffentlich eindeutig und ohne Lücken und Überschneidungen. Im Auftragsrecht hafte ich hingegen nur für die sorgfältige Auswahl des erlaubterweise zugezogenen Subplaners.
Wie sehen Massnahmen gegen die vorhandenen Fehlerrisiken aus? Sind Prüfingenieure eine Lösung?
Erich Ramer: Das kann für den projektierenden Ingenieur sehr bequem sein, denn dann übernimmt der Prüfingenieur einen Teil der Verantwortung.
Jürg Gasche: Wollen Sie das wirklich?
Erich Ramer: Eigentlich nicht. Das hat natürlich zur Folge, dass man in einem Fall, in dem ein Prüfingenieur mitwirkt, seine Statik in einer ganz bestimmten Form aufbereiten und abgeben muss. Andererseits aber hat der Prüfingenieur ein Auge darauf, ob alle massgebenden Fälle berücksichtigt sind. Jeder Prüfingenieur hat seine primäre Aufgabe in der Plausibilitätskontrolle, die er auf verschiedene Arten durchführt. So gesehen gibt es eine gewisse grössere Sicherheit gegen Schadenfälle. Allerdings kostet ein Prüfingenieur wiederum Geld und ich persönlich ziehe es vor, als Projektverfasser die finanziellen Mittel für eine sorgfältige Planung zur Verfügung zu haben.
Neben den Prüfingenieuren sehe ich als Massnahme auch das Beseitigen der Hauptfehlerquellen. Vor allem den oft politisch bedingten Termindruck und die harte Selektion auf Grund des tiefsten Preises.TEC21, Mo., 2007.01.29
29. Januar 2007 Clementine Hegner-van Rooden, Daniela Dietsche
Unabhängig Prüfen
In den letzten Monaten haben Schadenfälle ein breites Interesse der Öffentlichkeit geweckt. Sie zeigen, dass in der Qualität der Ingenieurdienstleistung durchaus Unterschiede vorhanden sind. Es ist ein Irrtum zu glauben, Vorgaben in unseren Normen führten unabhängig von den Fachkenntnissen und der vertieften Auseinandersetzung mit der Aufgabe zu vergleichbaren Resultaten. Damit gewinnt die alte Frage, ob durch Einsatz eines Prüfingenieurs vorhandene Defizite ausgeglichen werden können, wieder an Bedeutung.
Die Meinungen in der Fachwelt gehen auseinander. Zwei extreme Standpunkte veranschaulichen dies. Eine Auffassung ist, dass Prüfingenieure überflüssig sind. Die Fachleute sind sehr gut ausgebildet, arbeiten nur in den Gebieten, in denen sie hoch kompetent sind, verfügen über ein Qualitätssicherungssystem mit einem funktionierenden Kontrollsystem und nehmen ihre Verantwortung wahr. Da sind keine Prüfingenieure gefragt. Eine andere Meinung hingegen lautet, dass Prüfingenieure sehr wohl notwendig sind. Bekannte und schlummernde Schadenfälle sprechen eine deutliche Sprache, eine unabhängige Prüfung ist notwendig. Das gegenseitige Unterbieten der bereits fraglich tiefen Honorare bei laufend grösserem Arbeitsaufwand lässt eine seriöse Bearbeitung nicht mehr zu. Jeder meint, Fachmann in allen Gebieten zu sein. Dank Einsatz von EDV-Programmen werden höchst komplexe Systeme umgesetzt, die der projektierende Ingenieur kaum mehr versteht und deren Plausibilität er sonst nicht beurteilen kann. Daher sind Prüfingenieure notwendig, die auch selber Verantwortung übernehmen müssen und dabei als Kollegen auch zur Optimierung beitragen. Diese beiden Standpunkte legen deutlich dar, dass die Frage betreffend der Notwendigkeit von Prüfingenieuren weder mit Ja noch mit Nein zu beantworten ist, eine differenzierte Betrachtung drängt sich auf.
Qualitätssicherung als integraler Bestandteil
Grundsätzlich dürfen wir festhalten, dass wir dank unseren Hoch- und Fachhochschulen gut ausgebildete Ingenieure in unseren Unternehmungen beschäftigen. Zudem gilt unser Normenwerk als fortschrittlich. Damit können Bauten projektiert werden, die bei angemessener Einpassung, Gestaltung und Zuverlässigkeit wirtschaftlich, robust und dauerhaft sind. Dabei setzt die Norm SIA 2606 in Art. 0.2 voraus, dass Projektierung und Ausführung unter der Leitung qualifizierter Fachleute erfolgen müssen. Für diese Qualifikation genügt jedoch die gute Ausbildung alleine noch nicht. Die Kenntnisse und Erfahrungen in Werkstoffkunde, Statik, Konstruktion, Baupraxis und weiteren relevanten Fachgebieten müssen der Bedeutung und der Komplexität des Bauvorhabens entsprechen. Daraus wird deutlich, dass Massnahmen zu ergreifen sind, falls diese Voraussetzungen nicht erfüllt werden können. Dies kann durch Zuzug weiterer Fachleute erfolgen, beispielsweise durch den Einsatz von Spezialisten, welche die Aufgabe innerhalb der ihnen bekannten Lösungen bearbeiten und somit interpolierend arbeiten können[1].
Gemäss Festlegung in unseren Normen sind Ausnahmen von diesen zulässig, wenn sie durch Theorie oder Versuche ausreichend begründet werden oder neue Entwicklungen und Erkenntnisse dies rechtfertigen. Hier wird nun von bekannten und bewährten Methoden extrapoliert. Art. 0.3 der Norm SIA 260 fordert richtigerweise, dass die Abweichungen in den Bauwerksakten nachvollziehbar zu begründen sind.
In oben zitierter Norm wird gefordert, dass geeignete Qualitätssicherungsmassnahmen während der Projektierung, Ausführung, Nutzung und Erhaltung vorgesehen und ergriffen werden müssen. Im Unterschied zu verschiedenen anderen Ländern mit aufgezwungenen Prüfungsprozeduren dürfen wir uns glücklich schätzen, dass wir diese Massnahmen weitgehend frei wählen können. Dies bedeutet aber keinesfalls, dass man sich mit der Qualitätssicherung nicht auseinanderzusetzen hätte. Gefordert werden geeignete Massnahmen, die sich nach Aufgabe und Art der Umsetzung richten und fallweise festzusetzen sind. Nach Ansicht des Verfassers sind solche Kontrollsysteme so auszulegen, dass die Eigenverantwortung als primäre Verantwortung den höchsten Stellenwert behält. Das Bewusstsein, dass entsprechend der eigenen Arbeit realisiert wird, muss zwingend vorhanden sein und dazu führen, dass jedes Resultat einer Plausibilitätsprüfung unterzogen wird. Das Wissen um eine Zweitprüfung im Rahmen eines internen Vier-Augen-Prinzipes oder durch einen externen Prüfingenieur darf niemals zu Nachlässigkeiten führen. So erwähnte ein junger Ingenieur in einem Nachbarland bezüglich eines nicht vollständig gelösten Details, der Prüfingenieur werde dies ja schon noch prüfen!
Die Folgen
einer solchen Haltung könnten fatal sein. Das Beispiel zeigt auf, dass die Selbstkontrolle das wichtigste Element der Qualitätssicherung sein muss. Trotzdem sind zusätzlich weitergehende Kontrollmechanismen unabdingbar. Eine Zweitprüfung soll sicherstellen, dass alle Vorgaben und Randbedingungen entsprechend den Regeln der Baukunde korrekt umgesetzt werden. Dies muss über einen unabhängigen Prozess erfolgen. Das simple Nachvollziehen vorhandener Dokumente ist nicht geeignet, weil die Gefahr gross ist, dass Überlegungsfehler nicht aufgedeckt werden. Über diese Zweitprüfung hinaus können Korreferate mit internen oder externen erfahrenen Fachleuten auf konzeptioneller Ebene mithelfen, für die entsprechende Aufgabe die Bestlösung zu finden.
Rolle des Prüfingenieurs
Eine amtliche Kontrolle soll in der Regel der Fehlervermeidung dienen. So muss der Prüfingenieur nach der hessischen Bauordnung2 sicherstellen, dass die rechnerische und die tatsächliche Standsicherheit eines Bauwerks und seiner Bauteile ausreichend gross sind. (In Deutschland muss je nach Landesbauordnung die statische Berechnung möglicherweise von einem zweiten Statiker [Prüfingenieur] geprüft werden.) Dazu sind auch die schlüssige Umsetzung in Ausführungszeichnungen und der Bauausführung zu überprüfen. Diese umfassende und somit aufwändige Prüfaufgabe kann, wie oben erwähnt, zu einem Abbau der Eigenverantwortung führen, ohne jedoch einen Mehrwert etwa eines optimierteren Projektes zu generieren. Es kann ja kaum eine amtliche Aufgabe sein, die Optimierung einer Aufgabe voranzutreiben. Wünschenswert ist aber, dass wenn sich eine weitere Fachperson mit der Aufgabe auseinandersetzt, Überlegungen für Optimierungen eingebracht werden. So erwähnt der mit Prüfingenieuren erfahrene Jürgen Schnell3, dass nicht Prüfingenieure gefragt seien, die ihre objektiv starke Rolle selbstherrlich ausspielen, auch nicht diejenigen, die es beim Abstempeln der eingereichten Unterlagen belassen. Gefragt sei hingegen der mitdenkende Kollege, der Hand in Hand zur Optimierung beitrage. So kann es durchaus für ausgewählte Aufgaben, beispielsweise bei einem hohen Schadenrisiko, sinnvoll sein, einen Prüfingenieur als Partner des Projektingenieurs zu berufen.
Gerade bei Anwendung des Ausnahmeartikels darf der Einsatz des Prüfingenieurs aber nicht zur Verhinderung der Innovation führen, indem nur Bekanntes geprüft und genehmigt und damit die Extrapolation nicht zugelassen wird.
Einzelne Aspekte zur Zusammenarbeit mit dem Prüfingenieur werden nachfolgend am Projekt der Grimselseebrücke vertieft.
Beispiel Grimselseebrücke
Im Rahmen des Investitionsvorhabens der Kraftwerke Oberhasli (KWO plus, 20064) soll das Stauziel um 23 m erhöht werden, damit künftig die aus natürlichen Zuläufen vorhandenen Wassermengen energetisch noch sinnvoller genutzt werden können. Die Umsetzung dieses ökologisch und ökonomisch wertvollen Projektes erfordert eine Umlegung der kantonalen Grimselpassstrasse. Als Bestvariante eines Variantenstudiums soll die Strasse künftig über den Grimselsee geführt werden. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Randbedingungen hat der renommierte Brückenbauer Christian Menn eine Schrägkabelbrücke entworfen, die mit einer leichten, modernen und transparenten Eleganz dem einzigartigen Umfeld der Grimsel Rechnung trägt (Bild 1).
Die Kraftwerke Oberhasli KWO sind Auftraggeberin für die erforderliche Strassenumlegung. Nach Bauabschluss werden die Bauwerke in den Besitz des Kantons Bern übergehen. Entsprechend sind die Verantwortlichen des Kantons daran interessiert, dass die Bauwerke den Regeln der Baukunde entsprechen. Die Ingenieurgemeinschaft Grimselbrücken Plus, bestehend aus Bänziger Partner AG, Walt Galmarini AG, Dr. Deuring Oehninger AG sowie Kissling Zbinden AG, begrüsst die Zusammenarbeit mit einem qualifizierten Experten. So ist die Berufung von Urs Meier als Prüfingenieur auf Antrag der Ingenieurgemeinschaft erfolgt. Das vom Kanton Bern gewählte Berufungsverfahren stellt eine ideale Basis für die künftige Zusammenarbeit dar, wurde doch der Prüfingenieur den Projektanten nicht einfach «vorgesetzt». Mit dem Auftrag an den Prüfingenieur sind dessen Aufgaben und Stellung insbesondere gegenüber den Projektingenieuren und den ausführenden Unternehmern genau zu regeln. Für die Grimselseebrücke wird die KWO als Auftraggeberin die zu prüfenden Dokumente dem Kanton Bern einreichen. Der Prüfingenieur prüft diese entsprechend den Vorgaben des Kantons (Bild 2). Im Rahmen eines solchen Vertrages kann ein Prüfingenieur verantwortlich und haftpflichtig werden, womit eine entsprechende Versicherung unabdingbar ist5. Auch nach der hessischen Bauordnung müssen Prüfingenieure mit einer Haftungssumme von mindestens je 500 000 Euro für Personen- sowie für Sach- und Vermögensschäden je Schadenfall haftpflichtversichert sein.[2]
Ideal ist es, wenn Pflichtenheft und Abläufe durch den Prüfingenieur und die Projektanten gemeinsam bereinigt werden. Prüfinhalte können sich beispielsweise nach dem Bauwerk oder speziellen Sicherheitsfragen für die Ausführung richten. Im Hochgebirge der Grimsel muss das Bauwerk im Blick auf die technischen Anforderungen bezüglich Sicherheit, Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit neben den üblichen, normierten Einwirkungen vor allem auch extremen lokalen Belastungen aus Wind, Schnee und Eis Rechnung tragen. Damit sind Einwirkungen festzulegen, die ausserhalb der durch die Norm SIA 2617 abgedeckten Bereiche liegen. Nebst der Zusammenarbeit mit entsprechenden Experten ist gerade auch hier von Interesse, dass das Vorgehen zur Ermittlung entsprechender Werte und die Überprüfung plausibler Annahmen mit einem Prüfingenieur rechtzeitig diskutiert werden können. Das Organigramm gemäss Bild 2 sieht daher vor, dass ein gegenseitiger Informationsaustausch möglich, ja erwünscht ist. Die
eigentliche Prüfung wird mit den Grundlagen für die Nutzungsvereinbarung sowie der Projektbasis und der Umsetzung im Tragwerkskonzept starten. Die Überprüfung von Gesamt- und Teilsystemen bezüglich Sicherheit, Robustheit und Dauerhaftigkeit sowie der Bauverfahren, Schutzmassnahmen, temporären Bauwerken und Kontrollen der Ausführung können weitere Prüfinhalte sein. Vor allem bei nicht professionellen Bauherrschaften können auch administrative Kontrollen an einen Prüfingenieur delegiert werden, beispielsweise die Kontrolle der Bauwerksdokumentation auf deren Vollständigkeit. Letztlich können die erforderlichen Dokumente für die Nutzung und Erhaltung im Rahmen eines Prüfauftrages beurteilt werden.
Die Abläufe und erforderlichen Zeiten sind so zu fixieren, dass wertvolle Vorschläge des Prüfingenieurs rechtzeitig berücksichtigt werden können. Interventionen müssen so einfliessen können, dass optimale Lösungen möglich sind, ohne inhaltliche oder zeitliche Projektziele zu gefährden.
Eigenverantwortung
Die fachlich oder zeitlich ungenügende Auseinandersetzung eines Projektanten mit seinem Projekt lässt sich durch Einsatz eines Prüfingenieurs nicht auffangen. Vielmehr stehen Auftraggeber und Ingenieurfirmen in der Verantwortung, entsprechend der Aufgabe geeignete Fachleute mit ausreichender Kapazität einzusetzen. Eine ausreichende Qualitätssicherung ist zwingend, wobei der Eigenverantwortung der höchste Stellenwert einzuräumen ist. Soll für eine komplexe Aufgabe dennoch und idealerweise auf Initiative der Projektanten ein Prüfingenieur eingesetzt werden, muss dieser unabhängig prüfen, Innovationen mittragen beziehungsweise fördern und selbst auch in der Verantwortung stehen[8].
TEC21, Mo., 2007.01.29
Literatur:
1 FBH, 2006: Fachgruppe für Brückenbau und Hochbau FBH des SIA, Podiumsdiskussion vom 14.09.2006 in Zürich. Teilnehmende: Anita Lutz, dipl. Bauing. ETH; Thomas Lang, dipl. Bauing. ETH; Dr. Urs Hess-Odoni, Rechtsanwalt und Notar; Prof. Dr. Michael Faber, dipl. Bauing. TU; Dr. Martin Deuring, dipl. Bauing. ETH (Podiumsleitung).
2 PPVO, 2005: Verordnung über Prüfberechtigte, Prüfsachverständige, technische Prüfungen und Zuständigkeiten nach der hessischen Bauordnung. Entwurf 2005.
3 Schnell, 1995: Die Baufirmen haben am Vier-Augen-Prinzip ein ausgeprägtes Interesse. Dr.-Ing. Jürgen Schnell. Der Prüfingenieur, April 1995.
4 KWO plus, 2006: Investitionsprogramm KWO plus. Kraftwerke Oberhasli KWO, Innertkirchen. www.kwo.ch, Newsletter vom 20.09.06.
5 Hess-Odoni, 1995: Rechtsfragen beim Einsatz von Prüfingenieuren. Dr. iur. Urs Hess-Odoni, Rechtsanwalt und Notar. Baurecht 1/95
6 Norm SIA 260, 2003: Einwirkungen auf Tragwerke. Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, Zürich
7 Norm SIA 261, 2003: Grundlagen der Projektierung von Tragwerken. Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, Zürich.
8 Menn, 2006: Persönliches Gespräch mit Prof. Dr, Christian Menn, 14.09.2006
29. Januar 2007