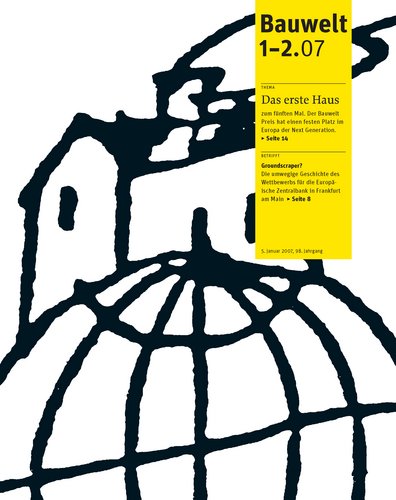Inhalt
WOCHENSCHAU
02 Verkehrszentrum des Deutschen Museums | Jochen Paul
02 Museum für zeitgenössische arabische Kunst | Carsten Steinmann
03 Sense of Architektur in Berlin | Brigitte Schultz
04 Ein Jahr phæno in Wolfsburg | Bettina Maria Brosowsky
04 10. Berliner Gespräch des BDA | Matthias Böttger
05 Verena-Dietrich-Werkschau in Frankfurt | Christiane Borgelt
05 Architektur der Nachkriegsmoderne in Dresden | Ulrich Brinkmann
BETRIFFT
08 Groundscraper? | Barbara Hoidn
WETTBEWERBE
10 ThyssenKrupp-Quartier in Essen | Ulrich Brinkmann
12 Entscheidungen
13 Auslobungen
THEMA
14 Bauwelt Preis 2007 | Felix Zwoch
16 Kategorie 1: Das private Wohnhaus
28 Kategorie 2: Der Garten
32 Kategorie 3: Innenräume
38 Kategorie 4: Bauten für die Gemeinschaft
48 Kategorie 5: Wohnungsbau
56 Kategorie 6: Konstruktionssysteme
62 Teilnehmer
REZENSIONEN
67 Design Like You Give A Damn | Susanne Schindler
RUBRIKEN
06 Leserbriefe
07 wer wo was wann
66 Kalender
68 Anzeigen