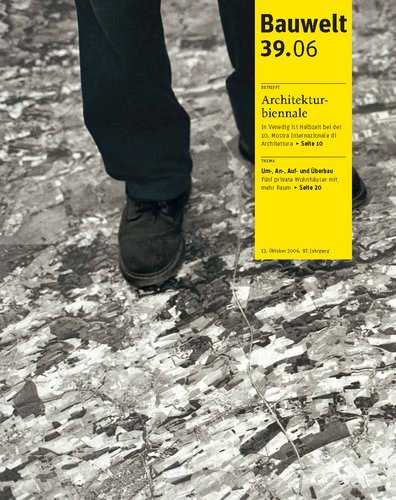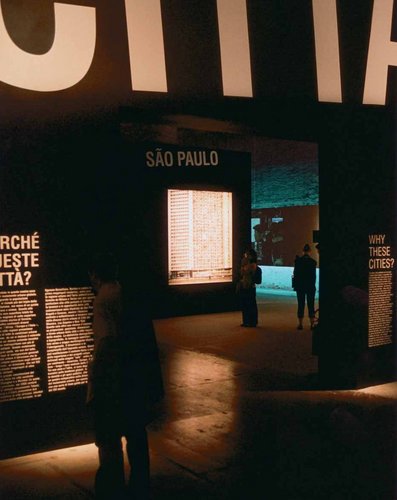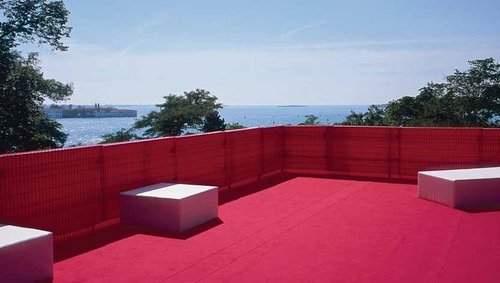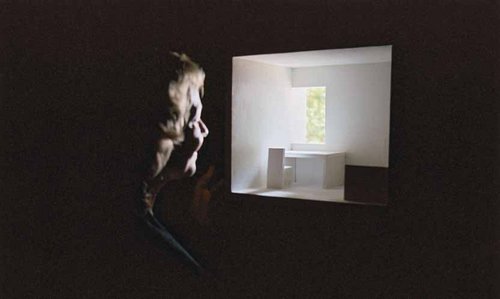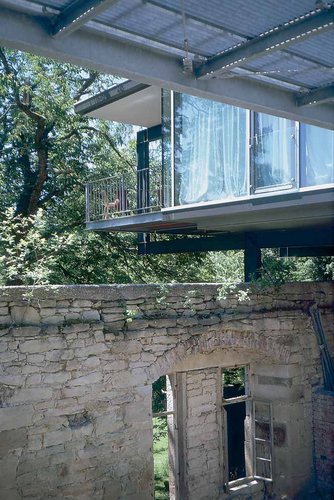Inhalt
WOCHENSCHAU
02 Guggenheim-Architektur in Bonn | Uta Winterhager
03 Neugestaltung des Jungfernstiegs in Hamburg | Heinrich Wähning
04 Tagung zum Humboldtforum in Berlin | Peter Rumpf
04 Wanderausstellung Holzbau der Moderne | Silke Reifenberg
06 Braunschweiger Architekturnetzwerke | Bettina Maria Brosowsky
06 SANAA-Werkschau im Bauhaus-Archiv | Urte Schmidt
BETRIFFT
10 10. Architekturbiennale Venedig | Martina Düttmann
WETTBEWERBE
16 Temporäre Gestaltung des Schlossareals in Berlin | Doris Kleilein
18 Auslobungen
THEMA
20 Haus Krohmer in Mauren | Brigitte Schultz
26 Baumhaus in Ludwigsburg
30 Penthouse in Neumünster
32 Haus Blick in Düsseldorf
36 Haus G. bei München
RUBRIKEN
07 wer wo was wann
40 Kalender
45 Anzeigen