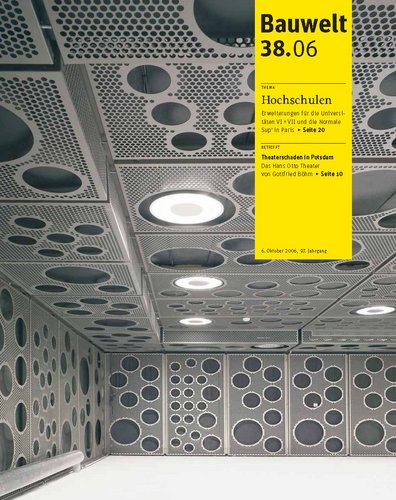Inhalt
WOCHENSCHAU
02 Neue Hülle für das Würzburger Heizkraftwerk | Enrico Santifaller
03 Ideal City – Invisible Cities | Michael Zajonz
04 Sauerbruch-Hutton-Werkschau | Jochen Paul
04 Design und Architektur für die Luftfahrt | Gudrun Escher
06 Aspekte des ungarischen Historismus | Oliver Hell
06 Haus im Haus | Ursula Baus
BETRIFFT
10 Theaterschaden in Potsdam | Michael Kasiske
WETTBEWERBE
14 Sternbrauerei-Areal in Salzburg | Doris Kleilein
16 Entscheidungen
18 Auslobungen
THEMA
20 Das Mehllager | Gabriel Sandwert
26 Normale Sup’ | Sebastian Redecke
32 Das Atrium in Jussieu | Sebastian Redecke
REZENSIONEN
42 Bürogebäude mit Zukunft | Karl J. Habermann
42 haus plus. Innovative Ideen für Anbau, Aufstockung und Erweiterung | Frank F. Drewes
42 db detailbuch. Band 3 | Karl J. Habermann
43 Harry Rosenthal. Architekt und Designer | Jürgen Tietz
43 Paul Zucker. Der vergessene Architekt | Jan Gympel
RUBRIKEN
08 wer wo was wann
40 Kalender
44 Anzeigen