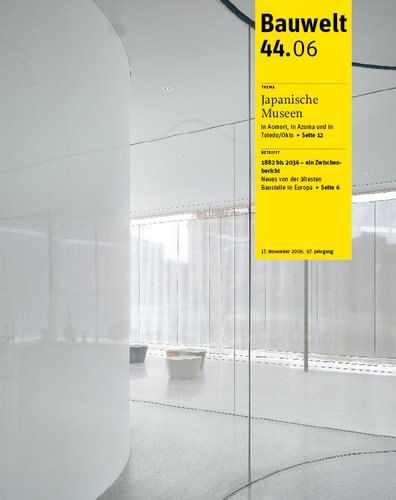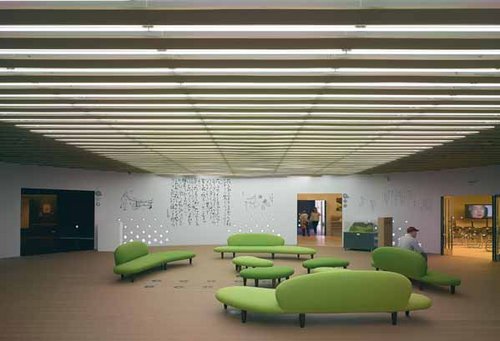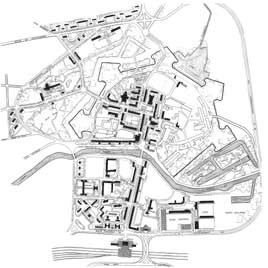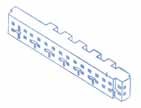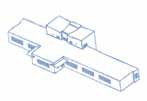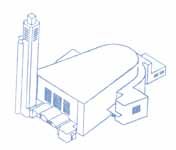Inhalt
WOCHENSCHAU
02 Possibilités – das Erbe André Lurçats in Maubeuge | Anne Kockelkorn
03 Lernen von Ungers | Ulrich Brinkmann
04 Traversinersteig II | Jochen Paul
BETRIFFT
06 1882 bis 2036 – ein Zwischenbericht von der ältesten Baustelle in Europa | Ingo Schrader
WETTBEWERBE
08 Ehemalige Synagoge/Michelsberg in Wiesbaden | Doris Kleilein
10 Entscheidungen
11 Auslobungen
THEMA
12 Annäherung an den japanischen Raum |Nils Ballhausen
14 Zylinderpaket | Jan Geipel
20 Transluzenter Mehrzeller | Nicolai Ouroussoff
26 Zwischen Erde und Luft: Aomori Art Museum | Nils Ballhausen
REZENSIONEN
34 Orhan Pamuk. Istanbul | Olaf Bartels
34 Architecture in the Netherlands 2005/06 | Wilhelm Klauser
35 Bauhaus-Tradition und DDR-Moderne. Der Architekt Richard Paulick | Eva-Maria Froschauer
35 Neues Leben, neues Bauen. Die Moderne in der SBZ/DDR 1945 bis 1951 | Susann Buttolo
RUBRIKEN
05 Leserbriefe
05 wer wo was wann
32 Kalender
36 Anzeigen