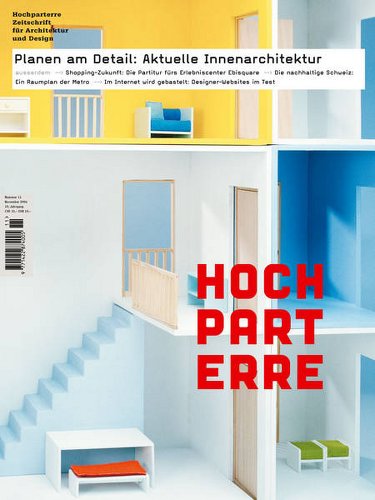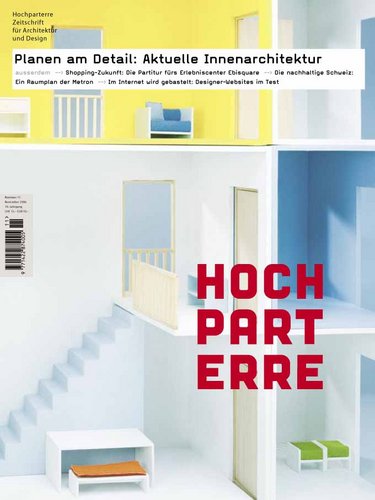Editorial
Nicht vergessen: In Langenthal ist Designers’ Saturday. Kommen Sie am 4. November nach dem langen Tag der Stoff-, Möbel- und anderer Vorführungen in die Hochparterre-Bar, die die Vereinigung Schweizer Innenarchitekten/architektinnen VSI.ASAI im Stall beim Designzentrum in der alten Mühle eingerichtet hat. Wir sind ab 18.30 Uhr Ihre Kellner und Barfrauen, Ihre Musiker und Barkeeper in der Designers’ Night. Inhaltlich können Sie sich mit dem Bericht ab Seite 18 dieser Ausgabe auf das bemerkenswerte Ereignis rüsten: Meret Ernst stellt den Stand der Innenarchitektur vor. Auf Seite 30 präsentiert Roderick Hönig ein spektakuläres Vorhaben zum Thema: Die Partitur, die entlang des Einkaufs- und Freizeitcenters Ebisquare bei Luzern inszeniert werden soll.
Nicht um Innenraum, aber um Innenstadt kümmert sich die nächste Ausgabe von hochparterre.wettbewerbe:
--› Stadtraum HB I, Zürich: Studienauftrag Umbau Sihlpost
--› Stadtraum HB II, Zürich: Studienauftrag für die Gestaltung des öffentlichen Raums
--› Offener Wettbewerb für das Strafjustizzentrum in Muttenz
--› Studienauftrag für die Weihnachtsbeleuchtung in Uster
Ein Stück Hochparterre feiert seinen ersten Geburtstag: www.hochparterre.ch/international. Dieses Panorama der Nachrichten, Bilder und Kommentare von Amsterdam über Dubai bis Peking interessiert über tausend Besucherinnen und Besucher pro Tag. Unter ‹Dubai› kann man nachlesen, wie die Menschen in den Arabischen Emiraten auf die Ausstellung ‹Inventioneering Architecture› der Schweizer Architekturschulen reagieren. Und Falk Kagelmacher berichtet aus Peking, wie dort Architektur für einen anderen Geburtstag herausgeputzt wird: Die Volksrepublik China wurde im Oktober fast auf den Tag genau 56 Jahre vor Hochparterre.international gegründet. Köbi Gantenbein
Inhalt
Funde
Stadtwanderer: Es herrscht der Zustand
Jakobsnotizen: Ferienhaus in Andermatt
Estermann: Metropoly
Titelgeschichte
Innenarchitektur: Eingriffe mit Auswirkung
Brennpunkte
– Ebisquare: Einkauf mit dem Kick im Nacken
– Not Vital: Der Künstler als Architekt
– Distinction romande 2006: Bauen in der Westschweiz
– Raumplanungskonzept: Die nachhaltige Schweiz
– ‹100% Design›, London: Designförderung auf britische Art
– Kilchbergs Architekturberg: ‹Geschwister›-Häuser
– Websites bewertet: Im Internet wird gebastelt
– Wettbewerb: Wird Brünnen bei Bern zur Stadt?
Leute
Novartis-Campus-Bauten im Architekturmuseum Basel
Bücher
Peter Erni mit einem seltenen Viersterne-Buch
Siebensachen
Die Kombination von Beistelltisch und Hocker, eine Birne, die leuchtet, und alles fürs perfekte Hörerlebnis
Fin de Chantier
Schulhäuser in Buochs und Frick, ein Gebärsaal, der zum Hörsaal wird, ein Altbau ganz in Weiss, eine umgebaute Siebzigerjahre-Siedlung, neue Holzbauten und mehr
An der Barkante
Mit Adrian Knüsel im Hotel ‹Rosenlaui› in Meiringen
Altbau in Weiss
Das Haus am Zürcher Lindenhof wurde 1876 erbaut und in den Sechzigerjahren zu Büros umfunktioniert mit PVC-Belägen und Akustikplatten. Wie verwandeln wir den Büromief wieder in Wohnungen, fragte die Stadt in einem Plan-erwahlverfahren. Michael Meier und Marius Hug schlugen trotz Bedenken der Denkmalpflege vor, das Treppenhaus zu verkürzen und die obersten beiden Geschosse zu einer 5-Zimmer-Maisonette mit interner Treppe zu verschmelzen. Ein kluger Schritt: Die Wohnung scheint endlos, sie ist zu einem Haus im Haus geworden. Die Innentreppe modellierten die Architekten zu einer eleganten, weissen Figur. Überhaupt das Weiss: Wände, Decken, Holzwerk, Türen oder Küchenfronten, alles strahlt weiss, jedes Material in einem eigenen, leicht gebrochenen Ton. Selbst der Boden: Meier Hug liessen überall einen hellen, fugenlosen Polyurethan – eine Art Gummibelag – ausgiessen. Dadurch kippt die Stimmung zuweilen ins Klinische, zumindest in den noch leeren Wohnungen. Das irritiert, weil man in diesem Haus altbauliche Wärme erwartet. Aber hinter dem Weiss steht ein mutiger Entschluss: Weil die Substanz nicht zu retten war, ergriffen die Architekten die Flucht nach vorn: Experiment statt Ersatz.hochparterre, Mo., 2006.11.27
27. November 2006 Rahel Marti
Begegnung im Zentrum
Die psychiatrische Klinik Königsfelden besteht aus dem Klinikgebäude aus dem 19. Jahrhundert, der campusartigen Anlage mit Pavillons aus den Sechzigerjahren und der Klosterkirche mit den berühmten Fensterscheiben. Der neuste Blickpunkt ist das Begegnungszentrum mit Kaffee, das die Patienten empfängt. Der Neubau bildet den Auftakt der Pavillonanlage und übernimmt deren Körnung. Um dessen öffentlichen Charakter zu unterstreichen, entwarfen die Architekten ein grosses, auf schlanken Stützen ruhendes Dach, unter dem sie drei hölzerne und zwei gemauerte Kuben versorgten, die eine Halle umschliessen. Im Erdgeschoss liegen die Räume mit viel Publikumsverkehr, im Obergeschoss der Coiffeur sowie der Mehrzweckraum und Sitzungszimmer. Zu den rohen Materialien des Äussern und der Halle – Beton, Klinker und Holz – setzten die Architekten in den Raumzellen die ‹künstlichen› Materialien des Epoxydharzbodens, der Metalldecken und der gestrichenen Glasfasertapete. Teil der Architektur ist auch die Kunst: Roland Fässlers ‹Zug der Mutanten›, dessen Fabelwesen der Dachkante entlang schleichen.hochparterre, Mo., 2006.11.27
27. November 2006 Werner Huber
Licht im Untergrund
Die SBB-Flughafenlinie brachte 1980 nicht nur den Zug zum Flug, sie bescherte Opfikon auch den unterirdischen Bahnhof an der Linie Zürich-Winterthur. Die S-Bahn Zürich nahm damals erst auf dem Papier Gestalt an und ein Regionalbahnhof war ein Zweckbauwerk, in dessen Gestaltung niemand investieren wollte. Das Resultat: eine spärlich beleuchtete und ungastliche Betonschachtel; ein Reich der Sprayer und Vandalen. 25 Jahre später hat sich das hässliche Entlein zum stolzen Schwan gemausert. Nun liegt am Boden Granit statt Asphalt, an den Wänden decken weisse Paneele den versprayten Beton ab und an der Decke reflektieren weisse Platten das Licht. Gläserne Kuben, auf denen der Stationsname ‹Opfikon› klein und unendlich oft aufgedruckt ist, stellen die Verbindung zur Oberfläche her – als Treppe, Lift oder Lichtschacht. 80 Prozent der Kosten übernahm die Gemeinde. Der Bahnhof als Visitenkarte soll die Bevölkerung zum Umsteigen animieren. Wenige Kilometer entfernt macht die Stadt Dübendorf in der Station ‹Stettbach› das Gegenteil: Sie lässt drei vom Künstler Gottfried Honegger gestaltete Emailtafeln an den Wänden demontieren. Eine Kapitulation vor den Sprayern – und eine Einladung zugleich.hochparterre, Mo., 2006.11.27
27. November 2006 Werner Huber