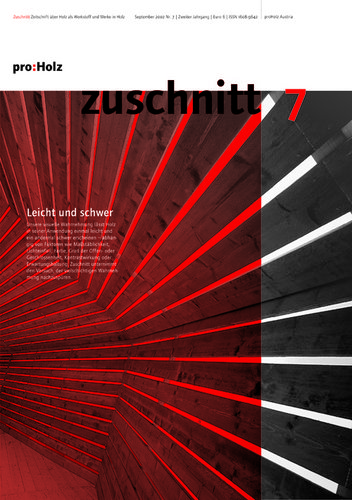Editorial
Es war schnell hingesagt: Leicht und Schwer als Thema für das vorliegende Heft. Nur: Was ist leicht im Holzbau, was ist schwer? Oder: Ist Holzbau immer Leichtbau?
Früher war alles ganz einfach oder – ganz leicht. Holzbau war Leichtbau, weil Holz ein Material mit vergleichsweise geringem spezifischen Gewicht ist. Nicht erst seit der Entwicklung der Holzmassivbauweise in Platten (siehe Zuschnitt 6, Brettsperrholz) muss diese Definition relativiert und differenziert werden. Hallenkonstruktionen in Holz mit weitgespannten Dächern und hohen dynamischen Lastannahmen, etwa bei Schneelasten im alpinen Raum, wirken nur dann nicht schwer, wenn massive Träger gekonnt in Fachwerkträger oder räumliche Tragwerke aufgelöst werden. Tatsächlich benötigen diese oft einen erheblichen Anteil an Stahl für Knoten und Aussteifung. In so mancher Dachkonstruktion soll der (versteckte) Stahlanteil das Gewicht der Holzkonstruktion übertreffen.
Grundsätzlich gilt für die Wahl einer Konstruktion, herauszufinden, wieviel Materie – und damit Gewicht – erforderlich, sinnvoll und wirtschaftlich vertretbar ist, um ihre Funktion und Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Immer schon ging es dem Konstrukteur darum, ein Tragwerk zwischen »gefährlich leicht« und »unnötig schwer« auszuloten. Und Holz erwies sich beim Versuch, Gewicht zu minimieren, als geeignetes Material. Genau deshalb wurde in den Dreißigerjahren nicht nur im Segelflug die amerikanische Neuentwicklung Sperrholz sofort eingesetzt, um formschöne, elegante und vor allem leichte Flugzeuge zu konstruieren. Die schnittige de Havilland Albatross, ein Verkehrsflugzeug mit vier 525 PS-Motoren, war mit einem geschichteten Rumpf aus Zedernholz und einem Kern aus Balsa komplett aus Holz.
Etwa zur selben Zeit suchte die Moderne, durch Ausmagerung des Tragwerks und durch Dematerialisierung der Baustoffe, leicht zu bauen. Dem überkommenen, tradierten Modell des schweren Bauens als Ausdruck von Macht und Repräsentation sollte eine neue Ethik, ein neuer Weltentwurf entgegengesetzt werden. Leichtigkeit und Transparenz als architektonische Mittel stellten diese Absicht dar.
John Rajchman, der amerikanischer Philosoph und Kunsttheoretiker erhofft sich eine neue »leichte« Erde mit einem Konzept, das »selbst die schwersten Materialien bewegt und die zartesten Transparenzen langsam und schwer werden lässt« und er fragt: »Können wir von leichten Materialitäten sprechen und von schweren Transparenzen?«
Ebenso muss einer differenzierten Betrachtung des Holzbaus eine Neubestimmung von leicht und schwer, von statisch und dynamisch folgen. Was bei Rajchman theoretischer Diskurs bleibt, ist am Beispiel der in diesem Heft vorgestellten »Dynamischen Brücke«, dem Ergebnis einer Entwurfsarbeit von Architekturstudenten unter Betreuung von Prof. Wolfdietrich Ziesel, intelligent umgesetzt. Der Fußgängersteg reagiert aktiv auf Belastung und nützt die einwirkenden Kräfte zur Erzeugung von Gegenkräften, die das Tragwerk stabilisieren. Was bedeutet, dass solch ein dynamisches System eine Minimierung der Querschnitte – also Leichtigkeit der Konstruktion – möglich macht.
Allerdings: Die Wahrnehmung von Holzkonstruktionen als leicht oder schwer hängt auch vom Kontext ab, in dem sie stehen – von Faktoren wie Maßstäblichkeit, Lichteinfall, Farbe, Grad der Offen- oder Geschlossenheit, der Relation zu anderen Materialien oder der Erwartungshaltung des Betrachters.
Ein an sich schweres, massives Dachtragwerk mit einer weiten Auskragung, wie jenes am Einkaufszentrum Lustenau von Marques + Zurkirchen, wird durch eine vollflächige Ummantelung mit transparenten Kunststoffplatten abstrahiert und wirkt dadurch leicht. Andererseits kann das Schwere gewollter optischer Effekt sein, wie im neuen Foyer der Schweizer Rückversicherung in Zürich. Schwere Holzleimbinder geben dort den großen vertikalen Glasflächen Halt und evozieren das visuelle Spiel zwischen Schwere und Leichtigkeit im Raum.
Eines lässt sich sagen: Leicht im Sinn von einfach ist es nicht, eine Zuordnung des Holzbaus zu leicht oder schwer vorzunehmen. Doch braucht es Kategorisierungen? Man schaue und erlebe und lasse auf sich wirken – und finde das Leichte oder das Schwere jedesmal von neuem für sich selbst. Karin Tschavgova
Inhalt
Zum Thema
Editorial
Text: Karin Tschavgova
Leichte Last - Parasitäre Bauten als funktionelle und ästhetische Bereicherung
Text: Karin Tschavgova
Dynamik oder Statik - Zwischen gefährlich leicht und unnötig schwer
Text: Wolfdietrich Ziesel
Weit spannen in Holz - Lasten verteilen, Festigkeit bündeln
Text: Herbert Markert
Projekte
Luzide Haut über massigem Körperbau
Einkaufszentrum Kirchpark, Lustenau, Vorarlberg
von Daniele Marques und Bruno Zurkirchen
Angemessene Schwere
Swiss Re Centre for Global Dialogue, Rüschlikon, Schweiz von Marcel Meili und Markus Peter
Leichte Last - Parasitäre Bauten als funktionelle und ästhetische Bereicherung
Dachaufbauten, Implantate und Zubauten – ihnen allen ist eines gemein: Sie nützen bestehende Strukturen, an die sie andocken. Sie nisten sich ein, zapfen die Infrastruktur ihres Wirtes an und hängen sich an vorhandene Systeme für Wasser- und Stromleitungen. Mit geringem Aufwand für die Aufschließung sind sie ressourcenschonend und leisten, ebenso wie Dachbodenausbauten, einen wertvollen Beitrag zur Stadtverdichtung. Als An- oder Aufbauten behaupten sie sich im Gegensatz zu diesen jedoch durch optische Präsenz und formale Eigenständigkeit. Auch als nichtautonome Strukturen verweisen sie im besten Fall – wenn nicht versucht wird, die nachträgliche bauliche Adaption zu vertuschen – auf ihre Entstehungszeit, fügen dem Bestand eine neue, klar ablesbare Zeitschicht hinzu.
Holz erweist sich für all diese Bauaufgaben als ganz besonders geeignet.
_Holzbau ist Trockenbau, es gibt keine Austrocknungszeit und damit keine Verzögerungen auf der Baustelle.
_Als leichtes Baumaterial belastet es die Tragstrukturen nicht übermäßig und lässt sich, etwa bei Dachaufbauten, als Ersatz für eine abzutragende Dachkonstruktion und unter Einbeziehung einer Berechnungsreserve ohne Verstärkung des bestehenden Stützenrasters montieren. Am Dachaufbau des Bundesrealgymnasiums Stainach von Alfred Bramberger schuf der statische Nachweis der Festigkeitszunahme des Betons infolge von Alterung die Voraussetzung für die Aufstockung. Die ausgeführte Holzkonstruktion mit verleimtem Brettschichtholz (KLH-Platten) bedingt lediglich eine Laststeigerung um 8 bis 9 Prozent am bestehenden Altbau. Diese Belastung ist durch die altersbedingte Festigkeitszunahme des Betons, die bei diesem Bauwerk um die 20% beträgt, abgedeckt.
_Als Baumaterial, das sich zur Vorfertigung ganzer Wand- und Deckenelemente in der Werkstatt eignet, ist Holz prädestiniert für eine schnelle, Substanz schonende Montage. Offengelegte oberste Geschoßdecken können bei der Verwendung vorgefertigter Wand- und Deckentafeln in wenigen Tagen wieder verschlossen werden. Die Montagezeit für den gesamten Rohbau in Stainach betrug 3 Wochen. Dadurch minimierte sich die lärmintensive Montagezeit und der Innenausbau konnte in dem abgeschlossenen Aufbau ohne Beeinträchtigung des laufenden Schulbetriebes vor sich gehen. Die gewählte Form des Zubaues als Aufstockung beanspruchte nicht den wertvollen Freiraum als Platz für die Baustelleneinrichtung und Baustellenzufahrt.
_Als leichtes Baumaterial ist Holz bestens geeignet, eine Klimahülle zu schaffen, die raumabschließend wirkt, die vorhandene Struktur jedoch weitgehend unangetastet lässt. Angedockt an den Bestand wird nur, wo Übergänge notwendig sind. Am Beispiel der Adaptierung eines Stadels in Kärnten in ein Wohnhaus wird das »Haus im Haus« – Prinzip deutlich. Markus Pernthaler schreibt dem ortstypischen, im Obergeschoß offenen Bauwerk mit mächtigem Dach und schwerem Bruchsteinmauerwerk eine leichte nichttragende Struktur aus Holz ein. Die offene luftige Loggia, zwischen Steinpfeilern und Wohnraum als wettergeschützte Pufferzone platziert, kontrastiert Alt und Neu in einem reizvollen Nebeneinander.
_Als Baumaterial ist Holz in vorgefertigten Tafelelementen mit einem (Leicht-)baukastensystem vergleichbar – relativ unaufwändig und platzsparend transportierbar, mittels intelligenter Verbindungstechnik schnell montierbar, ebenso demontabel und damit mobil. Temporäre Bauten wie der »Parasit« auf dem Liftschacht eines ehemaligen Werkstattgebäudes in Rotterdam, ein unkonventioneller Wohnraum, der von den holländischen Architekten Mechthold Stuhlmacher und Rien Korteknie entworfen und in Massivholz ausgeführt wurde, können zur Stadtverdichtung beitragen. Sie sollen das Potential von Orten erkunden, die als unbewohnbar gelten, oder Behelfsquartiere darstellen an Orten mit akuter Raumnot. Der ungewöhnliche Holzbau ist der erste einer Reihe von Prototypen, die die Parasite Foundation Rotterdam an verschiedenen Standorten in den Niederlanden errichten will. Ein leichtes Aperçu, gelandet am Dach der »Las Palmas« Halle, einem ehemaligen Industriebau, bereit zum Abflug in andere Gefilde – auf der Suche nach einem neuen Wirtsbau.zuschnitt, So., 2002.09.15
15. September 2002 Karin Tschavgova
Dynamik oder Statik - Zwischen gefährlich leicht und unnötig schwer
Es ist eine Grundsatzfrage: Wünschen wir uns leichte Konstruktionen, die den Eindruck großer Transparenz erwecken, die aber auch eine gewisse Risikofreudigkeit und Erfindungsreichtum suggerieren oder ist unser Sicherheitsdenken so groß, dass uns schwere, dichte und massive Tragwerke mehr Sicherheitsgefühl und Wohlbefinden vermitteln? Oder gibt es – vielleicht sogar viele – Menschen, die eine Konstruktion nach ganz anderen Kriterien wie Ästhetik, Farbe, Licht, Oberfläche, Bearbeitungsqualität beurteilen?
Wir bewundern immer wieder die leichten Tragwerkskonstruktionen im Stahlbau und stellen fest, dass im Holzbau – obwohl ein leichtes Material mit geringem spezifischen Gewicht zu Verfügung steht – die Tragwerke immer etwas massiver und schwerfälliger wirken. Die Kenntnisse der Tragwerkslehre und die Technik der Verarbeitung haben jedoch auch den Holzbau sehr stark weiterentwickelt und verfeinert, so dass wir heute doch wesentlich schlankere Konstruktionen zustande bringen.
Leichtigkeit verbinden wir auch mit dem Begriff RISIKO. Sich diesem Risiko nicht zu verschließen ist eine Herausforderung für uns Ingenieure. Während Schlankheit und filigrane Bauweise zu beunruhigen scheinen, vermitteln viele Holzbauten trotz ihres geringen Gewichts, allein durch Massigkeit ein Gefühl der Sicherheit und Stabilität. Dieses Gefühl hat für mich manchmal fraglos den Beigeschmack großer Ängstlichkeit im Umgang mit Material und Tragwerk. Vielen Holzkonstruktionen fehlt daher die Leichtigkeit und technische Eleganz anderer Materialien.
Das Material Holz leidet infolge seines geringen spezifischen Gewichtes darunter, dass der Einfluss von wechselnden Lasten (Nutzlasten) noch größer wird als bei anderen Materialien.
Beispielsweise ist der Einfluss wechselnder Windkräfte oder erheblicher Schneelasten im Gebirge bei einem Tragwerk aus Holz wesentlich größer als das entsprechende Eigengewicht der Konstruktion.
Dabei könnte man von der Natur lernen: Jeder Vogel, jedes Tier, jedes Lebewesen spannt die Muskeln nur dann, wenn es sie benötigt – warum auch nicht unsere Konstruktionen? Wir müssten daher über das rein statische Denken eine dynamische Betrachtungsweise der Vorgänge an einem Tragwerk vornehmen. Gerade beim Holz wegen seiner großen Bereitschaft zur Verformung wäre das möglich und zweckmäßig. Denken wir nur an Pfeil und Bogen.
Die dynamische Brücke entstand 1987 als Studentenarbeit von Josef Habeler, Kurt Schmid und Ulrich Semler an der Akademie der bildenden Künste in Wien im Modell. Für die Ausstellung »Ingenieur – Bau – Kunst« wurde sie 1989 mit Unterstützung von Prof. Wolfdietrich Ziesel 1:1 realisiert.
Ein mobiles Tragwerk
Ausgangspunkt der Architekturstudenten, die im Zuge des Tragwerkslehreunterrichts ein mobiles Tragwerk entwickelt haben, war die Idee, eine Brückenkonstruktion zu entwerfen, die auf wechselnde Belastung reagiert. Sie sollte sich selbständig auf jede neue Beanspruchung einstellen und ihre Form entsprechend den wechselnden Spannungen verändern. Eine Struktur also, die sich vorerst selbst trägt und bei Bedarf zu einem stabilen Tragwerk ausbildet.
Es galt, eine Konstruktion zu finden, die bei steigender (wechselnder) Belastung vorerst starke Verformungen erfährt, welche sodann auf kinematischem Weg das endgültige Tragwerk ausfalten. Sie durchläuft somit sehr verschiedene Verformungs- und Spannungszustände, wobei wichtig ist, dass diese immer innerhalb der für die Baustoffe zulässigen Werte bleiben.
Man kann es auch anders sagen: Die Grundgesetze der Statik, nämlich das vollkommene Gleichgewicht aller Kräfte und Drehmomente, erhalten eine zusätzliche dynamische Komponente, welche erst die gewünschte Anpassung der Konstruktion an die Belastung bewirkt.
Die erste experimentelle Annäherung an die Problematik erfolgte mit Modellen. Vorerst engten einfache Stabmodelle die Fragen weiter ein und es gelang, ein zwei Meter langes, voll funktionsfähiges Brückenmodell aus Holz mit einer Mechanik aus Stahl zu bauen. An diesem konnte man bereits sehr gut das Verhalten des Tragwerks unter wechselnder Beanspruchung durch stationäre oder bewegliche Lasten beobachten.
Danach wurde eine sechs Meter lange, begehbare Brücke nach den gleichen Prinzipien entworfen und bis ins kleinste Detail geplant. Die Auswahl von Material, Dimension und technischer Durchführung des begehbaren Bogens im Hinblick auf gewünschte Verformung und Haltbarkeit war erst nach mehrmaligen Rechenversuchen möglich. Es ist auch zu beachten, dass bei Tragwerken dieser Art die Einzelteile bei sehr unterschiedlichen Lastfällen ihre ungünstigste Beanspruchung erfahren.
Für das Herstellen des bogenförmigen Brettträgers waren mehrere Versuche notwendig. Ausgeführt wurde dann eine schichtverleimte Laufplatte aus Lärchenholz mit Glasfaserverstärkung mit den Abmessungen 600/55/2,9cm. Solch ein Aufbau ist dem Querschnitt eines Alpinschis ähnlich. An der Unterseite dieses Holzbogens sind Gelenkspfannen montiert, in denen Stahlstäbe geführt werden. Betritt man die Brücke, beginnt sich die Laufplatte durchzubiegen.
Die dabei auftretende Längenänderung der Bogensehne führt mittels einer mechanischen Umlenkung zum Ausklappen der Stahlstäbe. An ihren Enden wird ein Stahlseil mitgeführt. Erreicht man die Mitte der Brücke und damit die größte Belastung, sind die Stäbe voll ausgeklappt, das mitgeführte Seil unterspannt die Konstruktion. Die Stahlstäbe wirken als Druckstäbe. Dieser Zustand bildet sich bei Verlassen des mobilen Tragwerkes sukzessive zurück. Die mechanischen Teile sind gefräst aus Duraluminium und Stahl und genügen neben ihren funktionellen Aufgaben auch höchsten ästhetischen Ansprüchen. Alle Anschlussdetails sind gleich und sind daher nach einem EDV-Programm für gleiche Knoten mit verschieden dimensionierten Zwischenstücken gefertigt. Die Laufplatte ist zwischen zwei Auflagern aus Stahlblech beweglich gelagert. Die Ausbildung der Widerlager folgte mehr formalen Gesichtspunkten, um eine gestalterische Einheit mit dem mobilen Tragwerk zu erreichen. Zum Schluss erfolgte das sehr langwierige und komplizierte Justieren der Gesamtkonstruktion: Ein Problem war z.B. das Erzeugen einer gewissen Vorspannung, um bei Be- und Entlastung eine einwandfreie Beweglichkeit zu garantieren.
Das Brückentragwerk wurde auf vielen Ausstellungen unter großer Anteilnahme des Publikums gezeigt. Viele Menschen sind darüber gegangen und haben mit großem Interesse festgestellt, dass sie zum ersten Mal das Funktionieren einer Tragkonstruktion körperlich erlebt und gespürt haben.
Zieht man nach Abschluss einer derartigen Arbeit Bilanz, stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines solchen Unternehmens und der Möglichkeit von Folgerungen und Weiterentwicklungen. Eine denkbare Anwendung dieses Tragwerkprinzips läge bei allen Konstruktionen, die großen wechselnden oder dynamischen Belastungen ausgesetzt sind, etwa bei weitgespannten Hallenkonstruktionen mit einseitig auftretenden Wind- und Schneelasten oder bei unterfahrbaren Brücken mit geringer Höhe. Auch bei Druckgliedern in Tragwerken ist eine Veränderung der Konstruktion zur Erhöhung der Knicksteifigkeit bei steigender Belastung vorstellbar.
Es ist ein innerer Antrieb jedes Kreativen, Ideen und Überlegungen festzuhalten und diese in eine konkrete Form zu bringen. Die beschriebene, technisch wertvolle innovative Arbeit hat auch natürliche Vorbilder. Ich vergleiche sie mit einem Vogel in freier Natur. Sitzt er auf einem Baum, so sind seine Flügel in Ruhestellung, ihr Tragwerk ist unbelastet und daher eingezogen. Nur wenn der Vogel fliegen möchte und die Tragfähigkeit seiner Flügel benötigt, entfalten sie sich zu einem beeindruckenden und zweckmäßigen Tragwerk.zuschnitt, So., 2002.09.15
15. September 2002 Wolfdietrich Ziesel
Weit spannen in Holz - Lasten verteilen, Festigkeit bündeln
Unsere frühen Vorfahren hatten es leicht. Bei Entwurf und Bau ihrer Versammlungsstätten war der Baum Maß aller Dinge. Die Tragfähigkeit und Abmessung des Holzes bestimmte auch die Spannweite. Heute scheint es schwer zu sein, überhaupt Grenzen zu finden. So entstand in jüngster Zeit eine beachtliche Zahl sehr großer stützenfreier Hallen in Holz, vor allem Sportarenen in den USA und Japan, die immer weiter in neue Dimensionen vorstoßen.
Das Bestreben, für die Ansammlung von Menschenmassen angemessene Räumlichkeiten zu schaffen, hat mit der Möglichkeit, Tragwerke zu berechnen, durch neue Materialien ein weitgefächertes Anwendungsspektrum erhalten. In der Folge löste sich das Schwere der massiven Kuppeln oder Gewölbe auf in Konstruktionen, die leicht und gebrechlich erscheinen. Licht kann nun die Grenzen von Raum und Hülle verwischen. Es werden Räume geschaffen, die mit ungewöhnlicher Größe und Volumen neue Maßstäbe setzen. Es wird soviel Luft umbaut, dass einem dieselbe beim Betreten wegbleibt. Das große Volumen ist im doppelten Sinn nicht »begreifbar«. Zum einen ist das Dach, die Hülle, zu weit entrückt, um sie berühren oder begehen zu können. Es wird eine eigene Hemisphäre geschaffen. Zum anderen ist die Funktionsweise des Tragwerkes für den Laien nicht immer verständlich und daher kaum vertrauensbildend.
Die Dachkonstruktion ist bei Hallen mit großen Spannweiten direkter als bei anderen Bauten prägend für Form und Funktionen mit all ihren Wechselwirkungen.
Wie bei einem Weitsprung ist bei der Überwindung der Gravitation von einem Auflager zum anderen Kraft und Leichtigkeit erforderlich. Die Eigenlast wird zum wichtigsten Kriterium, je größer die Spannweite ist. Hierbei bemisst sich eine leichte Konstruktion durch das Verhältnis des Eigengewichtes zu der von ihr getragenen Nutzlast. Jede intelligent und verantwortungsbewusst entworfene Tragkonstruktion will so leicht wie möglich sein. Das Leichte ist aber schwer, weil es die Grenzen der Theorie, Technik und Fertigung auslotet. Gut Konstruieren heißt, Verhältnisse schaffen, in denen die Tragwerke in ihrer günstigsten Form und Struktur, und die Materialien mit ihren besten Eigenschaften eingesetzt werden. Wissen, Erfahrung und Intuition sind notwendig, damit eine vollkommene Konstruktion entsteht.
Dabei ist bemerkenswert, wie groß die Vielfalt der Konstruktionssysteme auch bei extremen Spannweiten ist. Es gibt nicht »das optimale Tragwerk«, das bei zunehmender Spannweite zwangsläufig entsteht. Unterschieden werden kann zwischen Tragsystemen, die überwiegend biegemoment-, druck- oder zugbeansprucht sind.
Biegebeanspruchte Tragwerke
Der einfache Biegebalken aus Holz, Stahl oder Beton, also monolithische und massive Tragwerke, die ihre Lasten und ihr Eigengewicht über Biegung abtragen, sind ungeeignet für extreme Spannweiten. Die Auflösung in Druck- und Zugelemente führt zu wesentlich leichteren Konstruktionen, wie z.B. dem unterspannten Träger oder dem Fachwerkträger. Da die einzelnen Stäbe nur Normalkräfte, also Druck oder Zug aufweisen, können sie entsprechend den Materialeigenschaften optimiert werden. Dazu kann ein maximierter Abstand zwischen den Zug- und Druckelementen Kräfte und somit den Materialaufwand minimieren.
Beim Pavillon der Utopie auf der Expo 98 in Lissabon von Regino Cruz und SOM werden Fachwerkträger, deren Tragsysteme zwischen Bogen und Rahmen liegen, linear addiert. Die verschieden großen Träger über einem ovalen Grundriss spannen bis zu 115 m.
Mit Fachwerkträgern ließen sich noch weit größere Strecken überbrücken. Da jedoch die Beanspruchung in der Mitte immer am größten ist, wird dort mit zunehmenden Abständen der Auflager eine immer größere Tragwerkshöhe erforderlich, was für den umschlossenen Raum von Nachteil sein kann.
Die Auflösung einer Platte, somit eine Tragwirkung in zwei Richtungen, lässt sich über Trägerroste und Raumfachwerke erzielen. Der Oguni Dome in Japan vom Yoh Design Office zeigt dies auf sehr leichte Weise.
Druckbeanspruchte Tragwerke
Bogensysteme und Kuppeln nutzen die gesamte Raumhöhe statisch. Die Lasten werden über Druckkraft in der Bogenachse abgetragen. Dies ist ideal für die Verwendung von Materialien ohne große Zugfestigkeit. Hier kann Holz seine Stärken ausspielen. Druckbeanspruchte Bereiche sind aber knickgefährdet, so dass die Querschnitte und seitlichen Stabilisierungen angepasst werden müssen. Schon 1966 erreichte der Dreigelenkbogen der Messehalle in Klagenfurt von O. Loider aus Wien beachtliche 96 m.
Die für sehr große Spannweiten notwendige Reduzierung des Eigengewichtes wird erreicht durch die Verwendung von leichteren Materialien und wiederum durch die Auflösung des Bogens in einen Fachwerkbogen oder die der Kuppel in ein räumliches Fachwerk. Der Odate-Dome in Japan (1992) von Toyo Ito entwickelt sein Tragwerk aus Zedernholz-Fachwerkbögen, die sich zur Seite hin neigen und mittels senkrecht dazu verlaufenden Holzbögen stabilisiert werden. Der Stahl wird nur zur Aussteifung benutzt. Die Ausbildung der Hülle mit einer Membran unterstützt die Leichtigkeit dieser Baseball-Arena.
Die 178 m weit gespannte Holzkonstruktion lagert auf einem abgesetzten Stahlbetonring und zeigt eine ausnehmend klare Gesamtform.
Bei der Arena Nova in Wien (1995) von Wolfgang Brunbauer , werden mittels einer als Raumfachwerk aufgelösten Tonnenschale 63 m überspannt. Die Profile sind hier alle konsequent aus Brettschichtholz. Eine geschlossene Deckung mindert leider die ursprünglich transparente Wirkung.
Eine andere Art der kleinteiligen Auflösung einer Tonnenschale schlug schon 1910 Herr Zollinger mit der nach ihm benannten Lamellenbauweise vor.
Die neuen Messehallen in Rimini (2001), Rostock und Friedrichshafen (2002) von Gerkan, Marg und Partner nehmen die Art der Lamellendächer – rhombenförmige Maschen mit gleichen kurzen Brettschichtholzrippen – wieder auf, mit Spannweiten von 60 – 65 m.
Bei Dachformen, die eine doppelte Krümmung aufweisen, wie bei einer Kuppel, liegt es nahe, die Schalenwirkung auszunutzen. Dazu müssen die Bögen untereinander durch Verstrebungen oder Kreuze schubsteif verbunden werden. Die dadurch entstehende Stabwerksschale ist stabiler gegen Knicken und steifer gegenüber ungleichen Lasten als Einzelbögen und kann deshalb wiederum wesentlich leichter sein. Entsprechend bildet der Izumo Dome in Japan (1992) seine Kuppelgeometrie mit radialen Holzbögen bei einem Durchmesser von 143 m. Die schubsteife Ausbildung zur Kuppel wird ausschließlich von Stahlprofilen übernommen. Die Hülle muss nicht mittragen und kann somit leicht und transparent ausfallen. Die Strukturierung der Kuppelfläche ist auf verschiedene Weise möglich. Meist sind Holzkuppeln aus dreiläufigen Stabnetzwerken – durch die Unterteilung der Kalottenfläche in gleichseitige Dreiecke – gebaut.
Der Tacoma Dome in Washington – USA (1982) ist mit einem Durchmesser von 162 m bei einer Scheitelhöhe von 48 m die größte Holzkuppel der Welt. Heute können Holzkuppeln so groß wie Beton- und Stahlkonstruktionen sein, mit einem Durchmesser bis 200 m.
Zugbeanspruchte Tragwerke
Zeigen Bogen- oder Kuppelformen sehr große Querschnitte und entsprechende Hallenvolumen, können Hängedachkonstruktionen die Konditionen des umbauten Raumes besser optimieren. Bei Belastung auf Zug können die Materialquerschnitte auf der gesamten Länge gleich bleiben.
Schon 1964 begeisterte die Festhalle der Expo in Lausanne mit ihrem Hängedach aus Sperrholzbändern an einem 87 m weit gespannten Holzbogen. Neue Beispiele, wie das Dach des Werkhofs in Hohenems (siehe Zuschnitt 6) oder die Nagano Olympic Speed Skating Arena (1998), die 70 m mit einem Verbund aus Stahlplatten und Lärchenholzlamellen überspannt, zeigen neue Möglichkeiten von Struktur und Material auf.
Da überwiegend zugbeanspruchte Konstruktionen geringste Eigengewichte aufweisen, sind die größten Spannweiten auch mit Konstruktionen verwirklicht, die dem Prinzip des Speichenrades nahe kommen, d.h. die Horizontalkräfte einer Seilkonstruktion werden über einen massiven Druckring kurzgeschlossen. So hat der Georgia Dome in Atlanta mit 240 m eines der weitgespanntesten Dachtragwerke. Folglich bedeutet es, dass ein Tragwerk um so leichter ist, je mehr Elemente zugbeansprucht und je weniger druckbeansprucht sind.
Zusammen geht besser
Die optimierte Umsetzung von Tragkonstruktionen zeigt sehr wohl, dass es in vielerlei Hinsicht lohnenswert ist, unterschiedliche Elemente mit dem jeweils entsprechenden Material und seinen spezifischen Eigenschaften einzusetzen. Synergie bedeutet ein Zusammenwirken verschiedener Kräfte zu einer gesamtheitlichen Leistung. Hier gilt derselbe Grundsatz wie bei der Arbeit von allen Planungsbeteiligten: Allein ist es schwer, zusammen geht es leichter.zuschnitt, So., 2002.09.15
15. September 2002 Herber Markert