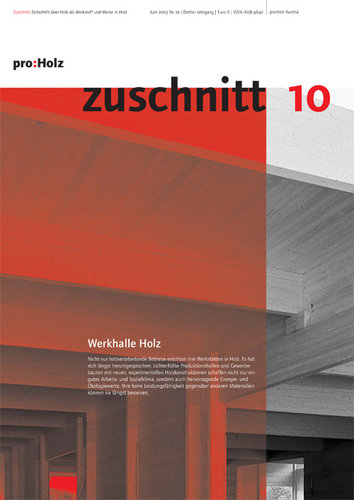Editorial
Bedeutung und Wirkungsgrad des gegenwärtigen Holzbaus in der Schweiz konnte man bei der EXPO 2002 an der Anzahl der »Holzbeiträge« ermessen. Charles von Büren ist als Mitbegründer und langjähriger Begleiter des Schweizer Holzverbands Lignum ein profunder Kenner der Szene. Für den Zuschnitt beleuchtet er Hintergründe, Schwerpunkte und strategische Zielsetzungen für eine erfolgreiche Performance des Baustoffs Holz - nicht nur in den Architektur-Highlights der Schweiz.
Holz bricht, brennt und fault. Und für so etwas soll man sich gegenüber Konsumenten, Bauherren, Architekten und Designern mit Erfolg stark machen? Ein Bau- und Werkstoff, der Probleme schafft, nicht dauerhaft und schon gar nicht sicher ist? Nun ja, jede Münze hat zwei Seiten. Denn Holz bricht, brennt und fault ganz eindeutig nur dann, wenn es nicht seinen Eigenschaften, Möglichkeiten und Grenzen entsprechend verwendet wird. Für Holz sprechen Dutzende von Gründen, die hinreichend bekannt sind: Holz ist ein nachwachsendes Leichtgewicht mit hohem Leistungsvermögen, es lässt sich mit eigentlich geringem Energieverbrauch verarbeiten. Holz weckt Sympathien und die Palette der Produkte, die auf Holz zurückgehen, ist riesig. Holz ist sogar Mode geworden - für Bau, Ausbau und Möbel. Das ist die andere Seite der Medaille und jeder Werbemensch wird sich mit Blick darauf die Hände reiben. Bevor das Händereiben beginnt, wäre ein bisschen Nachdenken angebracht. Denn welches sind die besten Argumente für Holz und Holzbauten? Der Erfahrung entsprechend vor allem die Tatsache, dass wegweisende Bauwerke Vorbilder sind und Bauherren wie Architekten überzeugen und zur Nachahmung verführen. In der Schweiz war dies mit ein wichtiger Grund für den ab den Achtzigerjahren einsetzenden Höhenflug von Holz. In Presse und Fernsehen gezeigte Referenzbauten, vor allem moderne Sporthallen, machten mit ihren imposanten Holztragwerken den Anfang.
Neue technische Entwicklungen wurden gefördert. Für die Architektur wurde in der Schweiz die »Vorarlberger Schule« rasch ein Begriff. Vergessen waren die betulichen Häuschen der Fünfzigerjahre mit ihren unsäglichen Camouflagen aus Brettern, welche Fachwerk imitieren. Die neuartige, sogenannte »ehrliche Materialisierung« von Holzbauten machten uns die Vorarlberger mitsamt ihren mutigen Bauherren und Banken vor. Spürbar wurde dieser Einfluss im 1984 ausgeschriebenen Wettbewerb der Lignum (Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für das Holz) für Holzbau. Die Bauten strahlten etwas Neuartiges aus und waren gleichzeitig technisch korrekt konstruiert. Das Resultat des 1999 ausgeschriebenen »prix lignum«: 185 Dokumentationen gingen ein, wieder wurde ein umfangreiches Buch mit zusätzlichen Bauten publiziert.
Der Unterschied zu 1984: Nicht wenige dieser Holzbauten entsprachen dem in Mode gekommenen Begriff der »Schweizer Kiste«. Was ist geschehen? Holzbau ist in der Schweiz förmlich Mode geworden. Nicht mehr die phantasievolle und doch pragmatische Bauweise, wie sie Vorarlberg vormachte, dient nun als Vorbild, sondern allzu oft bloß die Erfüllung photogener Wunschträume. Das müsste nicht sein, denn es sind hervorragende, auf praktischen Nutzen hin ausgerichtete Forschungsresultate greifbar, die zeigen, was mit Holz geht und was eben nicht. Die Lignum hat vor rund zehn Jahren ein grundlegendes Werk über den Brandschutz im Holzbau herausgegeben, das besonders dem mehrgeschoßigen Holzbau Auftrieb verliehen hat.
Mit den periodisch erscheinenden Heften »Lignatec« entsteht seit 1995 eine Sammlung von praktisch anwendbaren, technischen Informationen zu Holz. In solchen Publikationen sind die besten Argumente für Holz zu finden, abgesichertes und deshalb glaubwürdig wirkendes Wissen. Zudem belegen eine Studie über Entscheidungsmotive und Kenntnisse zu Holz (1) und eine Tiefenerhebung (2), dass Architekten wie Bauherren einen ausgeprägt emotionalen Zugang zum Holz haben. Die Architekten orientieren sich bei der Ausführung zudem stark an Referenzbauten und verfügbaren technischen Informationen.
Damit wird klar: Sowohl der technisch korrekte und gleichzeitig auch ästhetisch hochwertige Holzbau muss gefördert und als Vor-Bild propagiert werden. Vorbild deshalb, weil das, was man vor Augen hat, im Gedächtnis hängen bleibt. Beispielgebende Bauwerke der öffentlichen Hand sind, genauso wie jene der Privaten, durch Publikationen bekannt zu machen.
Dies geschieht in der Tagespresse, vor allem aber in den von der Fachwelt ernst genommenen Publikationen mit Langzeitwirkung, gerade so, wie es die Zeitschrift Zuschnitt vormacht: Emotional ansprechend und technisch korrekt. Werbung und Information müssen direkt wirken - auf den Kopf und ins Herz treffen. Für den Stahlbau werben nicht Hochöfen, für Mauerwerk nicht Ziegelöfen, für Beton nicht Zementwerke. Auch diese Baustoffe lassen Bauwerke sprechen. Genauso ist es beim Holzbau: Ein gutes Beispiel wirkt oftmals überzeugender als viele Argumente. Allenfalls kann der Gesetzgeber steuernd eingreifen und über den Begriff der »Nachhaltigkeit« dem Holzbau Vorschub leisten. Aber entscheidend ist und bleibt als direkter Gesprächspartner im Bauprozess der Architekt als Vertrauensperson. Architekten treten dann wirksam für den Holzbau ein, wenn sie selber gut informiert und voll überzeugt sind - eben auch durch Vorbilder. Sie sind im besten Sinne des Wortes »Nachahmungstäter«. Charles von Büren
Inhalt
Zum Thema
Editorial und Gastkommentar
Karin Tschavgova, Charles von Büren
Statement
Ingenieurholzbau – strategisch betrachtet
Text: Christian Haidinger
Gegenrede – Antworten auf das Statement von Christian Haidinger
von Michael Flach, Hermann Kaufmann, Andreas Orgler, Wolfgang Pöschl, Johann Riebenbauer
Projekte
Gewerbehalle in Lorch (D)
von Christoph Bijok
Sutterlüty Markt in Weiler (A)
von Hermann Kaufmann
Produktionshalle Trisa in Triengen (CH)
von Marc-Thomas Steger
Bürohaus und Druckhalle Gugler in Prielach (A)
von Ablinger, Vedral & Partner
Produktionshalle Ökohaus in Ludesch (A)
von Christian Walch
Theorie
Technisch-konstruktive Entwicklungen
im Hallenbau
Text: Helmut Stingl
Energiesparend und ökologisch
Die Gewerbehalle wurde als Großraum mit anpassungsfähigen Leichtbautrennwänden konzipiert. Das Bauwerk ist ein Nurdachgebäude, das außen wie innen geprägt ist von einem Tonnendach. Die wechselnden Höhen im Raum werden mit unterschiedlichen Nutzungen belegt. Sieben gebogene Brettschichtholzbinder mit einer Dimension von 20/ 58cm bilden im Abstand von 7,20 m das rund 6 m hohe Skelett des Tonnendaches. Die als Dreigelenkrahmen ausgeführten Bögen überspannen 29 m und stützen sich auf Stahlbetonwiderlagern ab. Die Binder sind durch Brettschichtholz-Koppelpfetten miteinander verbunden. Die aussteifenden Dachelemente wurden vorgefertigt. Unter Verwendung der Schablone für die Herstellung der gebogenen Binder konnten die Rahmen der Dachschalenelemente ohne Zusatzkosten ebenfalls aus BSH vorgefertigt werden. Die Innenseiten der Dachschalen aus OSB-Platten wirken zugleich als Dampfbremse....
Ein Versandhaus für Philatelisten benötigte ein neues Lager- und Ausfertigungsgebäude. Das Planungskonzept sah einen ressourcenschonenden Bau unter Verwendung erneuerbarer Rohstoffe vor. Der Bauherr verlangte ein im Betrieb kostengünstiges sowie flexibel nutzbares Gebäude, das zunächst hauptsächlich zur Lagerung gedacht war. Holz sollte möglichst weitgehend in allen Bauteilen eingesetzt und von einheimischen Betrieben verarbeitet werden.
Die Gewerbehalle wurde als Großraum mit anpassungsfähigen Leichtbautrennwänden konzipiert. Das Bauwerk ist ein Nurdachgebäude, das außen wie innen geprägt ist von einem Tonnendach. Die wechselnden Höhen im Raum werden mit unterschiedlichen Nutzungen belegt. Sieben gebogene Brettschichtholzbinder mit einer Dimension von 20/ 58cm bilden im Abstand von 7,20 m das rund 6 m hohe Skelett des Tonnendaches. Die als Dreigelenkrahmen ausgeführten Bögen überspannen 29 m und stützen sich auf Stahlbetonwiderlagern ab. Die Binder sind durch Brettschichtholz-Koppelpfetten miteinander verbunden. Die aussteifenden Dachelemente wurden vorgefertigt. Unter Verwendung der Schablone für die Herstellung der gebogenen Binder konnten die Rahmen der Dachschalenelemente ohne Zusatzkosten ebenfalls aus BSH vorgefertigt werden. Die Innenseiten der Dachschalen aus OSB-Platten wirken zugleich als Dampfbremse.
Als zusätzlichen Schutz der Außenseite aus DWD-Platten wurde ganzflächig eine dampfdurchlässige Folie aufgebracht. Die Dachkonstruktion ist hinterlüftet, ihre Deckung besteht aus beschichtetem Wellblech. Die Giebelkonstruktion in Holzrahmenbauweise ist innenseitig mit OSB-Platten beplankt und außen mit Massivholzlamellen verkleidet. Die Längsfront der Halle wurde im südlichen Randbereich für die solare Nutzung und Belichtung geöffnet. Zur Befestigung von Verglasung und Sonnenschutz befinden sich parallel zu den Hauptträgern Brettschichtholz-Rippen mit einem Achsmaß von 2,40 m. Transparente Wärmedämmung, kapillar strukturiert, wurde in den Fensterelementen als »Direktgewinnsystem« eingesetzt.
Ein ausgeklügeltes Energiekonzept, etwa ein Hypokaustensystem, das die Abwärme der zum Betrieb gehörenden benachbarten Druckerei nutzt, und aktive wie passive Nutzung von Solarenergie reduziert den Energieaufwand gegen Null. Generell erweist sich die geringe Außenfläche beziehungsweise das günstige Außenwand-Volumen-Verhältnis der Bogenkonstruktion als energetisch günstig.zuschnitt, So., 2003.06.15
15. Juni 2003 Christoph Bijok
verknüpfte Bauwerke
Gewerbehalle in Lorch
Markt für Architektur
Hermann Kaufmann materialisierte in Weiler die Hallendecke des Einkaufsmarktes als optisch dominierende Raumfläche besonders homogen, als neutralen und zugleich stimmungsgebenden »Fond« des Ganzen.
Die 47cm starke Dachplatte, ca. 1.500m² groß, überdeckt in 5 m Höhe gleichsam monolithisch den Innenraum mit Auskragungen in den Außenraum bei Eingangsfront und Lieferrampe. Diese Platte ist ein Gefüge aus Hohlkastenelementen, gespannt zwischen den seitlichen Außenwänden und Hauptträgern aus Brettschichtholz, die über zwei Reihen von Stahl-Pendelstützen die Last im Innenraum abtragen. Die Spannweite der Hohlkästen beträgt zur Hälfte ca. 14 m, im übrigen Bereich (trapezförmiger Grundriss) kontinuierlich bis auf 8 m verkürzt. Die vorgefertigten Teile sind beidseitig mit Dreischichtplatten beplankt und haben Rippen aus Brettschichtholz. Die untere Platte ist die fertige Deckenuntersicht.
Um diese helle Untersicht in Fichte völlig ruhig und ungeteilt zu erhalten, sind auch die bis zu 72cm breiten Hauptträger in die Deckenhöhe integriert.
Neben der schnellen, einfachen Montage und der speziellen Materialwirkung hat diese Holzplatte noch den Vorteil, dass sie keine Kältebrücke bildet und kontinuierlich durch die Glaswände der Stirnfronten in die Auskragungen der Vordächer hinauslaufen kann. Der ganzheitliche, zusammenfassende Effekt der Dachplatte hat eine weitere konkrete Wirkung, indem sie als statische Scheibe auch das ganze Gebäude stabilisiert.
In Tirol hat im letzten Jahrzehnt MPreis Maßstäbe gesetzt. In den Wettbewerb um die attraktivsten Verbrauchermärkte steigt in Vorarlberg jetzt Sutterlüty ein, und der im Ländle gut positionierte Nahversorger kann immerhin auf eine Pioniertat in der Branche verweisen, den phänomenalen Kirchpark in Lustenau.
Schon bei der Mehrzahl der MPreis-Bauten und erst recht beim Kirchpark spielten weitgespannte Tragwerke in Holz eine wesentliche Rolle. Bei der nun anlaufenden Serie mittelgroßer Märkte werden Qualitäten und Möglichkeiten moderner Holzkonstruktion noch straffer in ein neu formuliertes Gesamtkonzept eingebunden. Sutterlüty setzt hier ganz klar auf einen Paradigmenwechsel. Die kundenfreundliche Funktionalität, das innenräumliche Image der Hallen, wird zum gestalterischen Hauptkriterium. Aus dem »Supermarkt« soll wieder der ursprüngliche »Markt« werden, d.h. der tägliche oder wöchentliche Einkauf soll in einem Ambiente räumlicher Übersichtlichkeit und Offenheit stattfinden, das von den bisher gepflogenen Maximen entschieden abgeht. Beim neuen Sutterlüty in Weiler werden die Kunden in diesem Sinn gleich beim Eintritt von einem inneren Platz empfangen, einer »Erlebniszone« mit duftender Cafe-Bar, daran anschließend die in einzelne »Standeln« aufgegliederte Frische-Abteilung, die reich differenzierte, für die optische, haptische oder olfaktorische Wahrnehmung klar portionierte Bereiche bildet. Und dieser zentrale Marktplatz führt in die Tiefe einer möglichst hellen, weiten Halle, in der dann Regale nur mehr als relativ kurze, gut überblickbare und durch Richtungswechsel aufgelockerte Pakete den Weg zurück zu den Kassen strukturieren.
Mehr denn je ist also ein Tragwerkskonzept gefragt, das dieser inneren Freiheit und lokalen Individualisierung optimale Spielräume gibt, das mit möglichst wenig verschiedenen Standardelementen für die einzelnen Standorte variiert werden kann. Eine Konstruktionsart jedenfalls, die zudem ökonomisch ist, nachhaltig, und die der lebhaften »Performance« des Warenbereichs, die sich in Augen- und Griffhöhe abspielt, einen möglichst ruhigen Hintergrund bietet.
In Weiler materialisierte Hermann Kaufmann aus all diesen Gründen die Hallendecke als optisch dominierende Raumfläche besonders homogen, als neutralen und zugleich stimmungsgebenden »Fond« des Ganzen. Die 47cm starke Dachplatte, ca. 1.500m² groß, überdeckt in 5 m Höhe gleichsam monolithisch den Innenraum mit Auskragungen in den Außenraum bei Eingangsfront und Lieferrampe. Diese Platte ist ein Gefüge aus Hohlkastenelementen, gespannt zwischen den seitlichen Außenwänden und Hauptträgern aus Brettschichtholz, die über zwei Reihen von Stahl-Pendelstützen die Last im Innenraum abtragen. Die Spannweite der Hohlkästen beträgt zur Hälfte ca. 14 m, im übrigen Bereich (trapezförmiger Grundriss) kontinuierlich bis auf 8 m verkürzt. Die vorgefertigten Teile sind beidseitig mit Dreischichtplatten beplankt und haben Rippen aus Brettschichtholz. Die untere Platte ist die fertige Deckenuntersicht.
Um diese helle Untersicht in Fichte völlig ruhig und ungeteilt zu erhalten, sind auch die bis zu 72cm breiten Hauptträger in die Deckenhöhe integriert. Die Beleuchtung ist von der Decke abgehängt und bewusst direkt der Ladenzone zugeordnet.
Neben der schnellen, einfachen Montage und der speziellen Materialwirkung hat diese Holzplatte noch den Vorteil, dass sie keine Kältebrücke bildet und kontinuierlich durch die Glaswände der Stirnfronten in die Auskragungen der Vordächer hinauslaufen kann. Der ganzheitliche, zusammenfassende Effekt der Dachplatte hat eine weitere konkrete Wirkung, indem sie als statische Scheibe auch das ganze Gebäude stabilisiert. Die seitlichen Längswände sind Holzrahmenkonstruktionen mit innerer Beplankung aus OSBPlatten (rötlich gefärbt, abgestimmt mit der rot durchgefärbten, monolithischen Bodenvergütung) und einer äußeren Schicht aus diffusionsoffenen Holzwerkstoffplatten. Die zur Durchzugstraße geschlossene Westfassade hat als Außenverkleidung stehend montierte Akazienbretter - ohne die üblichen Keilzinken in den vom Werk verschieden gelieferten Längen verarbeitet und mit bündigen Querleisten zusammengefasst. Die solcherart subtil texturierte Wand wird gleichmäßig verwittern und den benachbarten Betonwänden des Friedhofs und Kirchenvorplatzes (Marte/ Marte) adäquat und ephemer antworten.
Kaufmann hat das gesamte System natürlich auch für und aus dem örtlichen Kontext optimiert. Der Markt schließt südlich an Kirche und Friedhof von Weiler an, bildet zwischen der Halle und den etwas höherliegenden Friedhofsmauern einen beschatteten Parkplatz - einen neuen Freiraum im Ortskern. Weitere Sutterlütys dieser Art, lokal maßgeschneidert, sind in Planung.zuschnitt, So., 2003.06.15
15. Juni 2003 Otto Kapfinger
verknüpfte Bauwerke
Sutterlüty Markt
Produktionshalle Trisa in Triengen
Für die bisher in unterschiedlichen Gebäuden untergebrachte Herstellung von Zahnbürsten wurde, an ein vor fünfzehn Jahren errichtetes Lagerhaus anschließend, eine neue Produktionshalle gebaut. Die Vorgaben des Bauherrn lauteten: Eine Halle mit einer Fläche von rund 85 x 62 m, möglichst große Spannweiten und eine lichte Höhe von mindestens 6 m. Zudem waren möglichst viel Tageslicht, behagliche Temperaturen und eine angenehme Akustik verlangt. Für die Konstruktion wurden unterschiedliche Materialvarianten eingehend geprüft: elementweise vorgefertigtes Mauerwerk, ein Stahltragwerk mit einer Fassade aus Zementplatten oder aus Metall. Weil sich die Kostendifferenz zu einer Holzkonstruktion für Tragwerk und Fassade als vergleichsweise gering erwies, wurde Holz bevorzugt. Die Produktionshalle, deren Untergeschoß und Kern in Hallenmitte aus Beton mit Pfahlgründung besteht, ist aufgrund des Primärträgerabstands von 12 m mit nur einer mittigen Stützenreihe sehr flexibel. Der klare Konstruktionsraster (Achsabstand 3 m längs, 3,80 m quer) begünstigte die Vorfertigung der Wandund Deckenelemente. Reihen von Sheds bringen das Tageslicht tief in den Raum mit 6 m lichter Höhe. Die Außenhaut des Gebäudes bildet eine offene Stülpschalung aus unbehandeltem Lärchenholz, Blau und Weiß als Farbakzente bei den Fensterbändern spiegeln die Firmenfarben wider. Die Anordnung der Fenster macht es möglich, auf eine mechanische Belüftung zu verzichten. Die Abwärme der Produktionsmaschinen erwärmt mittels Wärmetransfer das benachbarte Lager und die Spedition und verringert den Heizbedarf dadurch laut Angaben um jährlich 100.000 Liter Heizöl. Zudem wird das Regenwasser der großen Dachfläche gesammelt und als Brauchwasser verwendet. Die Firmenidentität wird bei diesem Bau durch die konsequente Umsetzung ökologischer Aspekte glaubwürdig betont - mit einem Mehraufwand von rund einem Fünftel der Baukosten.zuschnitt, So., 2003.06.15
15. Juni 2003 Marc Steger
verknüpfte Bauwerke
Trisa of Switzerland