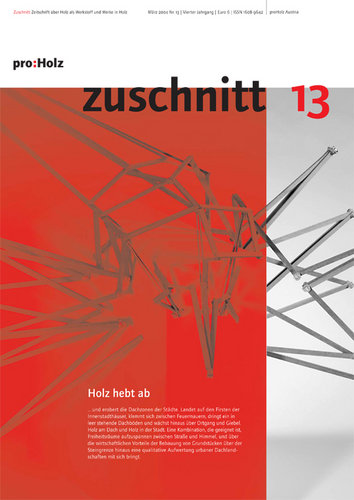Editorial
Bäume wachsen in den Himmel. Das ist nicht unmittelbar der Grund dafür, dass Holz bestens geeignet ist, um als Baustoff in hohen Lagen eingesetzt zu werden, aber es funktioniert als Bild für uns, als Synonym für das Aufwärtsstreben, als etwas, das wir mit Freiheit verbinden trotz einer festen Verankerung im Boden. Dabei denken wir diesmal nicht an Almhütten, Bergstationen oder Schutzhäuser, sondern an Holz in den Höhenlagen unserer Städte. Dachböden haben sich von Dienstbotenzimmern über Räume zum Wäsche aufhängen zu städtischem Bauland gewandelt. Aber zugleich und noch immer verbinden wir mit der Höhe die Freiheit, die Anonymität, den Bereich, wo Gesetze außer Kraft treten.
Noch immer denken wir an Spitzwegs »Poeten«, an vergessene Briefe, an verborgene Schätze. Noch immer sind Dachböden Sehnsuchtsräume, in denen sich träumen lässt und die uns aus den Niederungen des Alltags emporheben. Zugleich sind Dachzonen ein enormes wirtschaftliches Potenzial der Städte. Dabei ist Holz wie kein anderer Baustoff dazu prädestiniert, dieses Potenzial zu nutzen: es ist leicht, kann in hohem Maß vorfabriziert und in Trockenbauweise verarbeitet werden, ist formal vielseitig, weich, duftend, haptisch wohltuend, schön. Trotzdem wird im urbanen Zusammenhang viel zu wenig an Holz als mögliches Baumaterial gedacht. Dafür mag das Bild der »festen Stadt aus Stein« ebenso verantwortlich sein wie die Erinnerung an verheerende Brandkatastrophen und die starke Assoziation von Holz mit ländlicher Architektur.
Aber wie gültig sind diese Bilder, wie gerechtfertigt diese Vorurteile? Die Stadt besteht nicht nur aus Stein. Sie besteht auch aus Glas, Beton, Ziegeln und ganzen Wäldern, die zu Stiegenhäusern, Tramdecken und Dachstühlen verarbeitet wurden. Jedes Haus kann brennen. Häuser aus Holz genauso wie alle anderen. In der Praxis stellen Brände in Holzgebäuden, welche nach den baurechtlichen Vorgaben errichtet wurden, keine größere Bedrohung für die Bewohner dar als in Bauwerken aus anderen Materialien.
Holz ist sicher ein geeigneter Baustoff für Architektur am Land. Bedeutet das, Holz sei ungeeignet für Architektur in der Stadt? Zu wenig Kühe und Felder? Zu viele Autos und Straßen? (Manchmal) zweifelhafte Holzarchitektur am Land sollte niemanden davon abhalten, gute Holzarchitektur in die Stadt zu bringen.
Mit diesem Zuschnitt machen Sie einen Spaziergang über städtische Dachlandschaften. Sie erfahren von den Möglichkeiten qualitativer Stadterweiterungen mit Holz, sehen gebaute Beispiele für die Bearbeitung von Dachzonen, lernen Studentenarbeiten kennen, die Impulse für Innovationen im Holzbau liefern und Ideen für die Besetzung des Sehnsuchtsraumes Dach jenseits von Vorgaben und Einschränkungen. Eva Guttmann
Inhalt
Zum Thema
Editorial
Eva Guttmann
Essay – Von der Beletage ins Penthouse
Text: Arno Ritter
Dachaufbauten aus Holz
Hoch hinaus
Text: Franziska Leeb
Tarnkappe – Dachaufbau, Graz
Architekten: Michael Georg Homann, Wolfgang Schmied
Draufgesetzt – Dachaufbau, Wien
Architekt: Heinz Lutter
Angelehnt – Dachbodenausbau, Stadtschlaining
Architekt: Tomm Fichtner
Aufgebügelt – Dachprojekt »FF50«, Innsbruck
Architekten: Christian A. Pichler, Ferdinand Reiter
Auf Besuch – »Loftcube«, Berlin
Architekt: Werner Aisslinger
Holz auf der Höhe
Städte ohne Helmpflicht
Text: Redaktion Zuschnitt
Statement
Text von Volker Giencke im Rahmen der Preisverleihung von »warpvision«
Von der Elastizität des Holzes
Diskussion zwischen den Preisträgern des »warpvisions«-Wettbewerbs, Kathrin Aste, Johannes Kaufmann und Wolfgang Pöschl
Draufgesetzt
Nicht Einfügen, sondern Draufsetzen lautet das Motto hingegen bei einem anderen Dachausbau in Holzkonstruktion. Jenseits dezenter Zurückhaltung thront in der Wiener Spitalgasse ein eigenwilliger schwimmbadblauer Körper auf einem Eckhaus aus der Gründerzeit. Das Gesims ersetzt eine nach außen geneigte Brüstung. Provokant markiert eine rote Linie den Schnitt zwischen Alt und Neu. Architekt Heinz Lutter schöpfte – wie es wohl jeder Planer versuchen und jeder Investor verlangen würde – die baurechtlichen Möglichkeiten aus. Im kreativen Umgang mit den Rahmenbedingungen entstand darüber hinaus aber auch eine räumlich interessante Lösung. Drei Geschosse zusätzlich waren an der Seite zur Spitalgasse gestattet, zwei an der schmäleren Seitengasse.
Ein reichhaltiges Freiraumangebot unterstützt das Wohnerlebnis zwischen und über den Dächern. Sobald der Entwurf feststand, galt es sowohl einen geeigneten Werkstoff als auch eine ausführende Firma zu finden, um das Objekt mit seinen komplizierten Winkeln und Schrägen möglichst ökonomisch umzusetzen. Holz erwies sich rasch als beste Option. Die Firma Unterluggauer aus Osttirol setzte den Bau vom Plan weg und nach einmaligem Naturmaßnehmen in Fertigteile um. Es handelt sich um eine Sandwich-Konstruktion aus innen mit Gipskarton beplankten Fichtenholzplatten. Die Schutzschicht der Hülle besteht aus einem dauerelastischen Flüssigkunststoff, der hellblau gestrichen wurde.zuschnitt, Mi., 2004.09.15
15. September 2004 Franziska Leeb
verknüpfte Bauwerke
Wohnen am Dach
Von der Beletage ins Penthouse
(SUBTITLE) Über die Umwertung urbaner Dachlandschaften
Meine erste eigene Wohnung war ein kleines Nest mit Blick über die Dachlandschaft des ausrinnenden »Ungargassenlandes« (Ingeborg Bachmann) und Klo am Gang. Sie war 24,86 m² groß und bestand aus zwei mansardenartigen Räumen, die ehemals als Waschküche und Bügelzimmer in jenem gründerzeit-lichen Miethauses dienten, in dem ich aufgewachsen war. Über zwanzig Jahre hatte sich meine räumliche Sozialisation in der so genannten Beletage dieses Hauses abgespielt, mit den bekannten Insignien von Zimmerflucht, Flügeltüren, Parkettböden und dem Geruch einer ausgedünnten großbürgerlichen Wohnkultur. Und dann bezog ich diesen Horst, diesen Sehnsuchtsraum am Ende meiner bisher wahrgenommenen Hauswelt. Irgendwie abgehoben von der Stadtebene, zwar direkt mit dem Kommen und Gehen im Stiegenhaus, dem altertümlichen Lift und seiner knarrenden Geschäftigkeit verbunden, träumte ich mich von der »Hausherrenebene« in die Welt eines »Ghost Dogs«. Ich war also in der einst architektonisch angelegten Hierarchie dieses Jahrhundertwendehauses dorthin gezogen, wo früher eine unterprivilegierte Schicht – vom Künstler im Atelier bis zum Arbeitsbereich der Dienstmädchen – ihr meist unromantisches Spitzweg-Dasein gelebt hatten.
Für mich jedoch repräsentierten diese zwei Räume, der Blick in den Himmel und das ferne Rauschen der pulsierenden Stadt die reine Freiheit. Wahrscheinlich löste diese Wohnung in mir aber auch jene Träumereien und naiven Projektionen ein, die ich als Kind in die Dachlandschaft, in diese verwunschene und unheimliche Zone zwischen Haus und All hineingelegt hatte und die in meiner Einbildungskraft eine eigenartige Form von Intimität und Geborgenheit erzeugten.
Der Dachboden war lange Zeit in unseren Breiten eine unbewohnte Randzone zwischen Haus und Himmel, der mit den Jahreszeiten mitlebte. Er beherbergte Wirtschaftsräume oder diente als Speicher für eine ausrangierte Vergangenheit. Vor allem im urbanen Kontext wurde diese nutzlose Hausebene aber über die Stilepochen hinweg zur Straße repräsentativ und meist individuell gestaltet. Mit welcher Identität das Haus endet, war eine immer wiederkehrende Frage in der Architektur. Vor allem im Historismus entstand ein differenziertes gestalterisches Zeichensystem, das die urbane Dachlandschaft zur Repräsentationsfläche einer bürgerlichen Mythologie machte, die per Katalog zu bestellen war. Ein wahres Reich an oft industriell gefertigten Fabelwesen, Engeln und Statuen bevölkerten die mit Kupfer verkleideten und in Stein ornamentierten Dachzonen mit ihren Erkern, Türmchen und Giebeln. Gehalten und gestützt wurde diese urbane »Märchenwelt« durch teilweise aufwändig konstruierte Dachstühle, die den Blicken des Stadtbewohners zumeist verborgen blieben. Diese von Zimmermannshand errichtete Dachlandschaft, mit ihren komplexen Konstruktionen und den lange im Dunklen liegenden räumlichen Qualitäten, verschlang ganze Wälder und inspirierte die Handwerkskunst zu faszinierenden Lösungen. Die abschließende Ebene der »steinernen Stadt« bestand aus zumeist nutzlosen Kubaturen, die größtenteils aus Holz errichtet waren und »unbewusst« bzw. planlos auf ihre Entdeckung warteten.
Doch mit der zunehmenden Beschleunigung des Stadtlebens und der Horizontalisierung der urbanen Wahrnehmung, der Kommerzialisierung der Schaufensterzone und der Ökonomisierung der städtischen Räume wurde die Dachlandschaft zu einer nur mehr peripher gestalteten Zone. Sie verlor zunehmend ihre geheimnisvolle Ordnung und symbolische Bedeutung. Der vertikale Abschluss der Stadt wurde im Zuge der so genannten Moderne und im Sinne des positivistischen Denkens rationalisiert und veränderte damit seine Bedeutung. Die Dachzone wurde unter anderem zur Trägerin kommerzieller Signale, zum Ort einer Zeichenwelt mit Leuchtreklamen und Schriftzügen, die eine ökonomisch geprägte Mythologie der Logokultur in die Stadtgestalt integrierte. Das Reich der steinernen Fabelwesen wurde von der »lichten« Ordnung der Warenwelt und des kommerziellen Denkens abgelöst. Im Zuge dieser Modernisierung begannen die Vertreter der architektonischen Avantgarde auch die Stadt und das Haus von ihrer unheimlichen Geschichte zu entstauben und dem Dachboden seine Geister auszutreiben.
»Das Haus mit dem steilen Giebel birgt Geheimnisse und unbekannte Stellen. Das flache Dach ist ein Ausdruck der nicht metaphysischen Weltanschauung, die überall Klarheit haben will: Das Haus steht da, es ist das und das drin und damit ist es fertig. (…) Das ist der wahre Grund, weshalb das flache Dach in den Wohnbau eingeführt wurde. (…)« (Josef Frank: Was ist modern?, in: Die Form V/ 15, 1930) Irgendwie kann die heute teilweise als krampfhaft wahrgenommene Ideologie der Moderne, einerseits das Satteldach und seine zahlreichen »Geschwister« aus der gestalterischen Ordnung der Welt zu vertreiben, andererseits den »unheimlichen« Keller durch fast schwebende und die Erde nur punktweise berührende Häuser zu eliminieren, auch psychoanalytisch gedeutet werden. Das undurchsichtige Es des Hauses sollte Ich werden und damit die so genannte »Klarheit« und »Transparenz« Grundlage einer neuen Weltordnung.
Die Dachebene wurde dementsprechend von den modernen Architekten zur nutzbaren öffentlichen Freizeitzone, zur Terrasse mit Aussicht, zur Begegnungsfläche mit Sonne, Luft und Sternen umgedeutet. Im Zuge dieser Umwertung wurde das Dach flach, der kubische Hauskörper wurde auf Stützen gehoben und mit Pergolen, schwebenden Flugdächern und anderen architektonischen Elementen symbolisch zum Fliegen gebracht. Das Wohnhaus wurde zur sinnvollen »Maschine« uminterpretiert und jegliche Form architektonischer und damit zeichenhafter Archetypik zu vermeiden versucht. So sehr dieser »aufklärerische« und moderne Anspruch im Wissen um die damaligen räumlichen, sozialen wie gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen verständlich ist, so sehr verdrängte er aber auch gewisse psychische Befindlichkeiten, die vor allem in der literarischen, künstlerischen wie filmischen Einbildungskraft weiterlebten und gewisse »Tiefenschichten« einer kollektiven bzw. individuellen Hausvorstellung visuell oder schriftlich konservierten.
Eine fast unsichtbare und irgendwie verschmitzte Aneignung der urbanen Dachzone begann Raum zu greifen. Um dem »neuen« Bedürfnis nach Luft, Sonne und Sternen gerecht zu werden, wurden meist straßenabgewandt Terrassen und Wintergärten in die oberste Weichschicht der Städte eingeschnitten und eine Art von kleinbürgerlicher Schrebergartenidylle am Dach geschaffen. So lebte sich der Traum vom ökologisch korrekten Stadtbewohner, der »nutzlose« Kubatur umwidmete, um obenauf und mit ein wenig Grün zu wohnen – von der Beletage in den Dachboden war die halbbewusste Losung dieser aufstrebenden Schicht.
Ab Mitte der 1990er Jahre entstand die Sehnsucht der obersten Zehntausend nach einem richtigen Haus am Haus, nach der sichtbaren Artikulation einer abgehobenen Wohnung, nach einem neuen architektonischen Zeichen und Status im urbanen Geflecht. Man wollte sich nicht mehr verstecken, sondern sich selbstbewusst von der darunter liegenden baulichen Geschichte und dem »banalen« Alltag abheben. Es entstand die »nachmoderne Villa« auf historischem Sockel mit Garten und Blick auf die »alte«, wieder lebenswerte, mittlerweile durchökonomisierte, letztlich aber auch unheimliche und irgendwie »gefährliche« Stadt – der »Mordillo-Virus« breitete sich auf den Dächern aus und befriedigte den Traum einer neuen urbanen, vermögenden Klientel. Einkokont in die Abgehobenheit, mit einer nach allen Seiten hin transparenten Haut zwischen Himmel und Erde, angesiedelt zwischen individualpsychologisch motivierten Freiheitsvorstellungen und einer unsicheren politischen wie kollektiven Bodenhaftung, wurde ein neues Schichtmodell in die Stadt integriert. In einer zweiten Lesung von Stadt eroberte eine »high Society« die Dachebene, schottete sich vom öffentlichen Raum und der ökonomischen Alltäglichkeit ab und richtete sich in der Stadtkrone sichtbar ein. Sogar im sozialen Wohnbau wurden die Etagen neu verteilt und die Stockwerke nach ökonomischen Kriterien umgewertet und bemessen. Seit einiger Zeit sitzen die neuen »Hausherren« obenauf und nicht mehr im ersten Stock, in der so genannten Beletage.zuschnitt, Mo., 2004.03.15
15. März 2004 Arno Ritter
Hoch hinaus
Mit der bescheidenen Dachkammer des armen Poeten haben die aktuellen Raumschöpfungen in den urbanen Dachlandschaften nichts mehr gemeinsam. Der Terminus Dachbodenausbau beschreibt einige aktuelle Interventionen aber nur unzulänglich, denn die Dachzone ist zu einem beliebten Bauland geworden. Neben den klassischen Dachausbauten, die sich mehr oder weniger unauffällig in die vorhandene Stadtkontur einfügen, bis zu Aufbauten, die sich wie Satelliten über den Gesimskanten niederlassen, reicht das Spektrum des Möglichen. Die Begleiteffekte des Dachwohnungs-Booms bewegen sich im Zwiespalt von aufwertender Stadtreparatur und ökonomischer Ausnutzung bestehender Strukturen.
Der These, dass Nachverdichten im Stadtinneren Bauland am Stadtrand spart, könnte man entgegenhalten, dass in den ohnedies von Verkehr und Parkplatznot geplagten Stadtvierteln zusätzliche Bewohner prekäre Dichten noch verstärken.
Zwar können Dachgeschossausbauten in benachteiligten Stadtgebieten sozialen Segregationsprozessen entgegenwirken, es gibt aber andererseits zahlreiche Beispiele, wo an der vorhandenen Bausubstanz nichts verbessert und ausschließlich in den Dachraum investiert wird. Und dann wäre noch die in Sachen Dachausbau am lautesten geführte Diskussion zwischen den Bewahrern der historischen Dachlandschaft und den Verfechtern eines auch aus der Vogelperspektive zeitgemäßen Stadtbildes. Diese Spannungsfelder könnten entschärft werden, wenn sich die Diskussion auch darum drehen würde, wie man sich die Dachzonen am schonendsten – nicht nur im Sinn des Ensembleschutzes, sondern auch in ökologischer und soziologischer Hinsicht – zunutze machen kann.zuschnitt, Mo., 2004.03.15
15. März 2004 Franziska Leeb