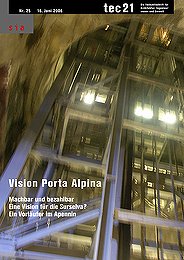Editorial
Wie sinnvoll ist die Porta Alpina?
Die Lobbyarbeit der Bündner für die „Visiun Porta Alpina“ hat die Schweiz überrascht. Der Bahnhof mit Lift im Gotthard-Basistunnel ist innert Kürze zur kantonal und national geförderten Entwicklungsstrategie für das Bündner Oberland geworden. Bereits sind beträchtliche Mittel gesprochen, und ein machbares und bezahlbares Projekt steht bereit. Aldo Rota stellt es in seinem Artikel vor.
Über die touristische Stossrichtung, möglichen Nutzen und raumplanerische Folgen der Porta Alpina hingegen gibt es zwar Gutachten, aber bisher keine öffentliche Diskussion. Als öffentlich finanziertes Bauprojekt muss sich die Porta Alpina aber Fragen gefallen lassen. Die Infrastruktur in den Alpen wird über Bundesbeiträge und Finanzausgleich zu einem guten Teil von den Steuerzahlern im Mittelland finanziert. Diese sind auch das primäre Zielpublikum der alpinen Touristenorte. Es erscheint deshalb selbstverständlich, dass ein Projekt wie die Porta Alpina eine landesweite Diskussion verdient. Umso mehr, als sowieso eine grundsätzliche Auseinandersetzung über die Regionalpolitik und die künftige touristische Entwicklung des Landes ansteht.[1]
Auch wenn man die regionalpolitische Tradition nicht so rücksichtslos in Frage stellen will wie „Avenir Suisse“[2] und nicht den halben Alpenraum so pauschal als Brache bezeichnen mag wie das ETH-Studio Basel[3], so möchte man als Mittellandbewohner - gerade weil man viel Zuneigung zu den Alpentälern und ihren Bewohnern hat und sich bemüht, deren Perspektive zu verstehen - doch gern fragen dürfen: Ist die Porta Alpina eine Entwicklung in die richtige Richtung? Eine, die die Schweiz will? Und falls ja: Wird sie auch leisten können, was man sich in der Surselva von ihr verspricht?
Im Mittelland löst die Porta Alpina keine Begeisterung aus. Nicht wegen der Kosten, sondern weil die Agglomerationsbewohner in ihrer hektischen, lärmgeplagten Alltagswelt eher zu viel als zu wenig Technik um sich haben und sich zum Ausgleich in den Bergen nicht nur Resorts wie Davos oder Zermatt wünschen, sondern immer mehr eine ursprüngliche Landschaft und intakte Natur. Die Porta Alpina wird deshalb nicht als Vision wahrgenommen, sondern eher als Neuauflage jener „Wunder der Technik“, mit denen man im 19. Jahrhundert den Alpen zu Leibe rückte.[4]
Doch es gibt auch skeptische Bündner. Der Geograf und Tourismusexperte Stefan Forster betrachtet in seinem Artikel den 1999 eröffneten Vereinatunnel und sieht ernüchternd wenig Wirkung im Unterengadin. Da erscheinen die in Sedrun erwarteten Gäste-, Zuzüger- und Umsatzzahlen sehr optimistisch. Heute wachsen nur noch die Segmente Kulturtourismus und naturnaher Tourismus. Ist da die Porta Alpina nicht ein Zeichen, das in die falsche Richtung weist? Forster möchte endlich eine ernsthafte Diskussion um Alternativen zur traditionellen Erschliessungs- und Infrastrukturpolitik in den Bergen eröffnen. Diese Diskussion wird in den nächsten Jahren im gesamten Alpenraum unumgänglich sein, und sie betrifft uns alle. Ruedi Weidmann
[1] Werner Spillmann, Angelus Eisinger: Vom Wachsen und Schrumpfen der Städte. NZZ 29.5.2006.
[2] Hansjörg Blöchliger: Baustelle Föderalismus. Zürich 2005.
[3] Roger Diener et al.: Die Schweiz. Ein städtebauliches Porträt. Basel 2005.
[4] Helmut Stalder: Porta Alpina oder die Kolonisation der Alpen. Tages-Anzeiger 12.1.2006.
Inhalt
Machbar und bezahlbar
Aldo Rota
Die Porta Alpina als Projekt, technisch gesehen: Der Beitrag zeigt auf, welche Bestandteile des Gotthard-Basistunnels genutzt und in jedem Fall erstellt werden, wie die Station aufgebaut ist und dereinst funktionieren soll, wie sie lokal und regional vernetzt werden kann und wie sich ihre Bedienung in den dichten Eisenbahnfahrplan eingliedern lässt.
Eine Vision für die Surselva?
Stefan Forster
Ein Bündner Geograf und Touristiker stellt unbequeme Fragen zur Porta Alpina. Er vergleicht sie mit dem Vereinatunnel, der wenig Effekt hatte, plädiert für eine Abkehr von der «Doktrin der Erschliessung» und möchte die Diskussion um neue touristische Strategien anstossen.
Ein Vorläufer im Apennin
Aldo Rota
Im Apennin-Basistunnel, zwischen Bologna und Florenz, wurde schon vor 70 Jahren eine Kreuzungs- und Überholstation mit öffentlicher Verbindung zur Oberfläche erstellt.
Magazin
Freisetzung von Schadstoffen / Solaranlagen-Boom / Umweltschutzgesetz für Liechtenstein / Öko-Investitionen lohnen sich / Binding-Waldpreis 2006 für Amden / Messe Basel teilweise unter Schutz? / Park von Schloss Arenenberg soll wieder auferstehen / Abschied von einem Monument des Kalten Krieges /
Ausstellungen / Publikation / Leserbrief / Verkehr / Planung
Aus dem SIA
Energetische Herausforderung für Planer / Vorschau Kurse
2. Halbjahr 2006 / SIA-Normenforum / Auszeichnung SIA «Umsicht»: Eingabetermin
Produkte
Impressum
Veranstaltungen
Eine Vision für die Surselva?
Die Porta Alpina hat eine steile Karriere von der „Schnapsidee“ zum umjubelten Pionierprojekt hinter sich, sie ist ein Lehrstück für regionalpolitisches Lobbying. Doch wie so oft bei rasanten Aufstiegen geht unterwegs einiges vergessen, werden anstehende Fragen grosszügig übersprungen. Dieser Artikel möchte ein paar Fragen zur Porta Alpina und zur alpinen Raumentwicklung nachholen und die Diskussion um Chancen, Risiken und Alternativen eröffnen.
Der ländliche Raum steht aufgrund der sozioökonomischen Polarisierung vor grossen Herausforderungen. Die regionalpolitische Erschliessungs- und Infrastrukturpolitik der letzten 30 Jahre hat die räumlichen Disparitäten in der Schweiz nicht aufgehoben, im Gegenteil: Die Ungleichheiten akzentuieren sich. Auch die obere Surselva und der gesamte Gotthard-Raum sind davon exemplarisch betroffen. Aufgrund der demografischen Entwicklung, der Siedlungsstruktur und ökonomischer Kennzahlen lassen sich in Graubünden und im gesamten Alpenraum grundsätzlich vier Raumtypen mit je unterschiedlichen Entwicklungstendenzen beobachten:
- Zentrumsregionen mit stark urbanisiertem Kern und periurbanen Agglomerationsräumen. Neben dem Tourismus und übrigen Dienstleistungen sind in diesen Räumen oft auch Industrie und Gewerbe stark entwickelt. Zu diesem Raumtyp zählen das Churer Rheintal als wirtschaftlich diversifiziertes Kantonszentrum und die grossen Tourismuszentren wie Davos und das Oberengadin.
- Periurbane Regionen mit einer hohen Auspendlerquote in inner- oder oft auch ausseralpine Zentren. Charakteristisch ist bei diesem Raumtyp ein Bevölkerungswachstum mit geringer wirtschaftlicher Dynamik. Darunter fallen die Auspendlerregionen in Zentrumsnähe wie das Domleschg, das Schanfigg oder Gebiete in der Surselva.
- Ländliche Räume mit disperser Siedlungsstruktur und nach wie vor starker Prägung durch den Agrarsektor, Gewerbe und etwas Tourismus. Dieser Raumtyp weist eine mehr oder weniger ausgeglichene Bevölkerungsbilanz auf. Dazu können weite Teile Mittelbündens und der Surselva gezählt werden, das mittlere Prättigau, das Puschlav oder das Bergell.
- Entleerungsregionen mit starkem Bevölkerungsrückgang und sehr hohem Anteil an Landwirtschaft. Ausgeprägte Entleerungsräume wie in den Westalpen gibt es im Kanton Graubünden noch keine. Als potenziell gefährdet können höchstens das Safiental und das Calancatal bezeichnet werden.
Schrumpfende Dörfer
Wenn wir nun diese allgemeine Typisierung, die im Kern dem aktuellen Raumplanungsbericht des Bundes (ARE 2005) entspricht, auf den Gotthard-Raum umlegen, dann sticht die Porta Alpina mitten in den grössten zusammenhängenden ländlichen Raum der Schweiz. Dieser steht vor grossen Herausforderungen. Der landwirtschaftliche und der gewerbliche Strukturwandel führt auch hier zu erheblichen Problemen. Die traditionelle Berglandwirtschaft verliert ihre Bedeutung als Einkommensbasis. Im Gegensatz zu den 1960er- und 1970er-Jahren können die anderen Branchen diesen kontinuierlichen Rückgang nicht mehr auffangen. Seit den 1990er-Jahren stagniert der Tourismus. Die alpinen Wintersportorte verlieren kontinuierlich und zum Teil dramatisch Logiernächte, u.a. weil sich die Nachfrage nach Wintersportangeboten diversifiziert und nicht mehr alle Ski fahren wie noch in den 1970er-Jahren, als das Skifahren praktisch zur schweizerischen Sozialisation gehörte. In direktem Zusammenhang damit verliert das Gewerbe, das in den Randregionen über lange Zeit einen starken Beschäftigungseffekt hatte, seit 15 Jahren an Bedeutung. Und im Dienstleistungssektor entstehen im Gegensatz zu den Zentrumsregionen keine neuen Arbeitsplätze. Wir befinden uns mitten in einem kumulativen Schrumpfungsprozess des ländlichen Raumes: Wegen der fehlenden Beschäftigungsgrundlage wandert ein Teil der jüngeren Bevölkerung in die regionalen und nationalen Zentren ab. Daraus resultiert ein sozialer Substanzverlust, der wiederum oft dazu führt, dass die personellen Ressourcen für eine innovative Weiterentwicklung fehlen. Folge des Rückgangs der regionalen Wirtschaftskraft und des Abbaus von Arbeitsplätzen ist die Gefährdung der öffentlichen Infrastruktur und der Dienstleistungen.
Diese Entwicklung hat sich in den letzten Jahren akzentuiert, obwohl Milliarden von öffentlichen Geldern in den Ausbau der Verkehrserschliessung, den Aufbau der öffentlichen Infrastruktur und in die Unterstützung der Landwirtschaft geflossen sind. Das zeigt, dass die verkehrtstechnische Erschliessung und die öffentliche Infrastruktur nicht das alles entscheidende Kriterium für Entwicklungsperspektiven des ländlichen Raumes sind. Die Entwicklung im Gotthard-Raum unterstreicht diese These. Das Urnerland kämpft im oberen Reusstal mit gravierenden Strukturproblemen. Die oben ausgeführten kumulativen Degradierungsprozesse sind weit fortgeschritten, obwohl das obere Reusstal wohl zu den am besten erschlossenen ländlichen Räumen in Europa gehört. Dasselbe könnte über die Region der Tre Valli auf der Südseite des Gotthards gesagt werden.
Ein Tunnel oder ein Lift generieren noch keine Übernachtungen
Um die Bedeutung der Erschliessung zu untersuchen, bietet sich auch der Vereinatunnel an. Der Eisenbahntunnel mit Autoverlad verbindet das Prättigau mit dem Unterengadin. Um die Auswirkungen auf die räumliche Entwicklung seit der Eröffnung 1999 zu analysieren, hat das Bundesamt für Raumentwicklung einen Bericht vorgelegt (ARE 2006). Mit dem Vereinatunnel wurde die Erreichbarkeit des Unterengadins aus den Zentren des Mittellandes erheblich verbessert. Die Anreise mit der Bahn von Zürich wurde um zwei Stunden verkürzt und dauert heute noch rund 2 Stunden und 40 Minuten. Der Tunnel hat an der peripheren Lage des Unterengadins aber grundsätzlich nichts verändert. Er hat nicht zu einer Verlagerung des Personenverkehrs auf die Schiene geführt, die Nachfrage nach Zweitwohnungen im Unterengadin hat sich nicht erhöht, und auch die Preisentwicklung im Immobiliensektor wurde nicht beeinflusst. Nachdem sich die Logiernächtezahl kurzfristig erhöhte, liegt sie heute mit rund 840000 Logiernächten (gesamtes Unterengadin von Susch bis Martina) wieder auf dem Niveau von 1999. Geht man weitere zehn Jahre zurück, als die Logiernächte weit über eine Million Übernachtungen jährlich ausmachten, so hat das Unterengadin im Vergleich zu anderen Destinationen im Alpenraum gar überdurchschnittlich an Logiernächten eingebüsst. Deutlich zugenommen hat hingegen der Tages- oder Kurzaufenthaltstourismus. Dies wohl hauptsächlich, weil mit dem „Bogn Engiadina“ in Scuol ein attraktives Angebot vorhanden ist, das von der besseren Erreichbarkeit direkt profitiert. Die Eintritte ins Bad haben sich seit der Eröffnung des Vereinatunnels um ca. 25% erhöht. Da sich heute die Logiernächte auch in Scuol wieder auf dem Niveau von 1999 eingependelt haben, zeigt sich deutlich ein Problembereich der besseren Erreichbarkeit (Tagesdistanz). Als primäres Reisemotiv gilt ein Besuch der Hauptattraktion, der Anreiz, länger als einen bis zwei Tage in der Region zu bleiben, fällt weg. Das Unterengadin steht heute nicht so schlecht da wie andere Regionen. Wie weit dies auf den Vereinatunnel zurückzuführen ist bzw. ob die Entwicklung des Unterengadins ohne Vereinatunnel schlechter verlaufen wäre, kann hier wegen der Menge an Einflussfaktoren nicht untersucht werden.
Tatsache ist, dass in der oberen Surselva eine mit dem „Bogn Engiadina“ vergleichbare Hauptattraktion fehlt. Aufgrund der Analyse der räumlichen Auswirkungen im Unterengadin nach dem Bau des Vereinatunnels stellt sich die Frage, wie nachhaltig die Baukosten für die Porta Alpina angelegt wären. Es muss wohl die eher ernüchternde ökonomische Potenzialanalyse zur Porta Alpina von Thomas Bieger, Universität St.Gallen, als realistisch angesehen werden: „Mit einer signifikant steigenden Zahl von Übernachtungsgästen kann nicht gerechnet werden.“ (Bieger 2005) Die Analyse der Auswirkungen des Vereinatunnels zeigt weiter - und das scheint im Vergleich zur Situation im Gotthard-Raum sehr aufschlussreich -, dass sich die Beziehungen zwischen den Akteuren im Prättigau und im Unterengadin betreffend Kooperationsbemühungen, vernetzter Angebotsentwicklung und grundsätzlich neuer interaktiver ökonomischer und sozialer Prozesse nicht verändert haben, d.h., weiterhin praktisch inexistent sind. Dies relativiert auch die Hoffnung von Bundesrat Joseph Deiss, die Porta Alpina könnte als „Initialzündung“ für die Entwicklung im gesamten Gotthard-Raum wirken („Südostschweiz“ vom 18.5.2006), weil vorauszusehen ist, dass auch hier die topografischen und die kulturellen Grenzen nicht überwunden werden.
Die Porta Alpina verstellt den Blick auf wahrhaft neue Perspektiven
Die zunehmende Polarisierung der schweizerischen Raumentwicklung wird momentan kontrovers und heftig diskutiert. Vor allem die strukturschwachen Räume, die zu einem erheblichen Teil von öffentlichen Transferleistungen und Subventionszahlungen abhängig sind, kommen zunehmend unter Druck. Angestossen wurde die Debatte aus wirtschaftsnahen Kreisen, die unter dem Primat der neoliberalen Deregulierung eine rein ökonomische und kurzsichtige Kostenwahrheit fordern. Aber auch das ETH Studio Basel (Institut Stadt der Gegenwart), das unter der Federführung der Architekten Jacques Herzog, Pierre de Meuron, Marcel Meili und Roger Diener in ihrer Publikation „Die Schweiz - Ein städtebauliches Porträt“ den alpinen ländlichen Raum als „Brachland“ bezeichnet, hat einen wichtigen Beitrag zur aktuellen Debatte geleistet. Die Diskussion wird auch auf politischer Ebene geführt. Anlass dazu sind u.a. die Bemühungen, ein neues Konzept für die schweizerische Regionalpolitik zu erarbeiten, und die Bearbeitung der Vorlage für die Agrarpolitik 2011. Unabhängig davon, wie man die Ansätze und Konzepte im Einzelnen beurteilt, wird sehr deutlich, dass ein Umbruch im Gange ist und nach neuen regionalpolitischen, raumplanerischen und ökonomischen Steuerungsmechanismen gesucht wird.
Typisch - und ein Teil der bisherigen Problemlage - ist dabei auch die reflexartige Abwehrhaltung der politischen und meinungsbildenden Akteure aus dem Berggebiet gegen zum Teil durchaus konstruktive Diskussionsvorschläge. So verkümmert die sehr wichtige Diskussion auf ein reines Seilziehen um die Bewahrung der erheblichen staatlichen Transferleistungen. Dieses Seilziehen um die knapper werdenden Bundesgelder zeigt sich auch in einer gewissen Hyperaktivität in den strukturschwachen Räumen, was die Projektkonzepte und -entwicklungen angeht. Zwischen Genfersee und Unterengadin werden momentan zahlreiche mehr oder weniger innovative Projekte lanciert, die als rettende Strohhalme angesehen werden, aber in ihrer langfristigen Wirkung eher überschätzt werden. Diesen Projekten, die punktuell durchaus erfolgreich sein können, fehlt der gemeinsame neue Boden in der zunehmend urbanen Schweiz, die gemeinsame komplementäre Strategie zu den Metropolitanräumen für eine neue Idee des ländlichen Raumes. Sie funktionieren nach dem alten, bewahrenden Muster, das die Polarisierung der Raumentwicklung weiter verstärken wird. Vom Bund über die Kantone bis zu den Gemeinden werden je eigene „Raum-Welten“ neu erfunden. Die Raumplanung versucht diese einander überlagernden und oft widersprechenden „Welten“ zu ordnen. Die Akteure vor Ort zählen auf den solidarisch ausgeprägten „Bergmythos“ und die damit verbundene finanzielle Unterstützung von aussen.
Werden in der laufenden Diskussion über die Porta Alpina diese Grundsatzfragen ausgeklammert, wird die Porta Alpina als weiteres kostenintensives Beispiel für die überholte räumliche Bewahrungsdoktrin in die Geschichte eingehen. Dann würde sie keine neue Idee darstellen, sondern nach alter, regionalpolitischer Schule die Doktrin der Erschliessung und des Infrastrukturausbaus verfolgen. Sie ist in diesem Sinn nicht visionär. Denn es wird übersehen, dass das traditionelle Modell des Disparitätenausgleichs, der gutschweizerischen „räumlichen Gerechtigkeit“, der technokratisch geplanten und regionalpolitisch regulierten Bestandesbewahrung ausgedient hat und neue, differenzierte Entwicklungsstrategien notwendig werden.
Den ländlichen Raum neu denken
Es ist notwendig, dass der ländliche Raum selbstbewusst und in Zusammenarbeit mit den Metropolitanräumen neue Konzepte entwirft. Der räumliche Ausgleich muss neu gedacht werden. Die Lehren aus der Vergangenheit müssen integriert und die heutigen Realitäten akzeptiert werden. Dabei sollen nicht die Bewahrung der Transferleistungen für den ländlichen Raum im Vordergrund stehen, sondern neue sozioökonomische Chancen integriert werden. Anhand des Beispiels der Porta Alpina möchte ich drei Diskussionsbeiträge formulieren, die dies unterstreichen sollen:
1. Welche Landschaft wollen wir?
Diese an sich banale Frage steht am Anfang der Diskussion. Es muss geklärt werden, welche Landschaft die Gesellschaft in Zukunft möchte und wie viel sie kosten darf. Es braucht einen politischen Diskurs über die zukünftige Landschaftsentwicklung in der Schweiz. Heute dominieren Partikularinteressen, das „grosse Bild“ fehlt. Im Rahmen eines Teilprojektes des NFP 48 „Landschaften und Lebensräume der Alpen“ konnte gezeigt werden, dass sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber bestehen, wie sich die Landschaft entwickeln soll. (Forster, 2006) Inneralpin herrscht nach wie vor eine eher funktionalistisch-technische Sicht auf die Landschaft vor, während die ausseralpine Bevölkerung ein romantisch-idyllisches Bild der Landschaftsentwicklung bevorzugt. Für die Erarbeitung von neuen Konzepten braucht es dringend Konsensbemühungen, die die unterschiedlichen Sichtweisen zusammenführen. Weder im Gotthard-Raum noch in der Surselva wurde diese Frage angegangen. Darum werden gleichzeitig sehr unterschiedliche und sich widersprechende „Landschaftsprojekte“ lanciert - beispielsweise das Nationalpark-Projekt „Parc Adula“, das auf einer kantonsübergreifenden Fläche mit der Greina-Hochebene im Zentrum die vielfältige Landschaft schützen und Wertschöpfung für die anliegenden Regionen generieren soll. Gleichzeitig wird in Andermatt, das von einem ägyptischen Investor eher zufällig und ohne Bezug zur Region auserwählt wurde, ein künstliches Ferien-Resort geplant. In der Surselva entstehen drei neue Golfplätze (neben dem bereits bestehenden in Sedrun), obwohl sehr fraglich ist, ob die Nachfrage überhaupt vorhanden ist. Die Aufzählung liesse sich verlängern. Bis auf Gemeindeebene hinunter wird ein eher widersprüchlicher Einzelprojekt-Aktivismus sichtbar ohne Konsens und ohne gemeinsame und abgestimmte Strategie für die Landschaftsentwicklung.
2. Wie nutzen wir das Potenzial der Differenz?
Die kulturelle, soziale und ökonomische Lebensweise auf dem Land unterscheidet sich heute nicht mehr wesentlich vom städtischen Alltag. Trotzdem - oder gerade deshalb - müssen die Differenzen neu definiert und fruchtbar gemacht werden. Die Globalisierung führt zur Suche nach Übersichtlichkeit im Regionalen. Die alltägliche Hektik fördert bei den Agglomerationsbewohnern des Schweizer Mittellandes die Sehnsucht nach Entschleunigung. Der unpersönliche Leistungsdruck im Beruf sucht im Wunsch nach einer „echten“, menschlichen Begegnung einen wohltuenden Ausgleich. Die gesichtslosen, zusammenwachsenden Agglomerationen wecken die ästhetische Lust nach intakten Landschaften. Die bisherige Strategie des Disparitätenausgleichs, der „räumlichen Gerechtigkeit“ durch Erschliessungs- und Infrastrukturplanung muss deshalb abgelöst werden. Nicht mehr die unmögliche Nivellierung des Raumes soll im Vordergrund stehen, sondern vielmehr müssen die unterschiedlichen, komplementären Qualitäten herausgestrichen werden. Denn im Unterschied (nicht als Abschottungs-, sondern als komplementäre Strategie) liegt das Entwicklungspotenzial für den ländlichen Raum. Differenzen aufzeigen heisst Rückbesinnung und Weiterentwicklung der eigenen Qualitäten in der Bewältigung eines globalen Strukturwandels.
Die Porta Alpina entspricht dem überholten räumlichen Nivellierungskonzept, verwischt die Differenzen zwischen ländlichen und städtischen Räumen und degradiert so letztlich einen Teil des originären Potenzials der Surselva, das gerade hier noch ausgeprägter erhalten ist als in anderen Schweizer Alpentälern.
3. Wie können Potenziale für naturnahen Kulturtourismus erkannt und genutzt werden?
In einem solchen komplementären Tourismuskonzept ist der ländliche Raum Träger der zunehmend wichtigen Kernwerte eines natur- und kulturnahen Tourismus. Diese Werte müssen besser genutzt werden, denn die Nachfrage danach wird steigen. In der Freizeit und im Tourismus spiegeln sich die veränderten gesellschaftlichen Bedürfnisse: Regionalität, Entschleunigung, Begegnung, intakte Landschaften und authentische Erlebnisse sind darum auch die zentralen Begriffe der Erwartungen an den natur- und kulturnahen Tourismus, der Natur und Landschaft schont, die authentische Kultur fördert und die regionale Wirtschaft des Ferienortes belebt. Eine Befragung der Hochschule Rapperswil von Anbietern im Bereich des naturnahen Tourismus ergab, dass diese mit einer Zunahme des Marktvolumens von bis zu 40% in den nächsten zehn Jahren rechnen. Heute bewegen sich die Gesamtausgaben der „naturnahen“ Schweizer Gäste jährlich bei etwa 2.3 Milliarden Franken. Der naturnahe Tourismus tritt aus seiner Nische heraus und wird zu einem wichtigen und interessanten Marktsegment.
In der Surselva, dem Vorderrheintal und der Gotthard-Region gibt es zahlreiche Beispiele von möglichen Zielen für naturnahen Kulturtourismus, deren Potenzial heute zu wenig genutzt wird und brachliegt. Dazu gehören u.a. die Rheinquelle, die Verkehrsgeschichte des Gotthards und des Furka-, Oberalp- und Lukmanierpasses, die Militärgeschichte im Zentrum des Reduit, die dichte Vielfalt an Sprachkulturen rund um den Gotthard, die Specksteinvorkommen, die überdurchschnittlich intakten Landschaftsräume etwa im Bleniotal, im Lugnez und in anderen Seitentälern.
Die Porta Alpina ist eine faszinierende Idee. Wie eine Feuerwehrrakete hat sie die 150 Täler Graubündens hell erleuchtet und eine an sich positive gemeinsame Sache geschaffen. Nachdem nun der helle Schein etwas verblasst ist und sich der Rauch verzieht, müssen die wichtigen, zum Teil natürlich unangenehmen Fragen endlich breit diskutiert werden. Es reicht nicht, nun
einfach punktuelle Konzepte nachzuschieben. Die wirklichen Grundsatzfragen für eine gemeinsame, nachhaltige Entwicklungsstrategie in der oberen Surselva und im gesamten Gotthard-Raum müssen zuerst geklärt werden.
Literatur
Amt für Raumentwicklung: Richtplanung Graubünden - Porta Alpina und nachhaltige Raumentwicklung. Zusatzbericht, 2005.
Bätzing, W.: Die Alpen. Entstehung und Gefährdung einer europäischen Kulturlandschaft. Beck-Verlag, München, 2003.
Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement, Kanton Graubünden: Raumkonzept Gotthard. Grundlagen, Inhalte, Struktur und Prozess, 2005.
Bieger, T., Laesser, C.: Marktanalyse und Bedürfnisabklärung für eine Neat-Tunnelstation Sedrun - Porta Alpina. Institut für öffentliche Dienstleistungen und Tourismus, Universität St. Gallen, 2005.
ARE Bundesamt für Raumentwicklung: Räumliche Auswirkungen des Vereinatunnels - eine ex-post Analyse. Zusammenfassung, 2006.
ARE Bundesamt für Raumentwicklung: Raumentwicklungsbericht des Bundes 2005, Bern, 2005.
Caminada, Gion A.: Untersuchungen zur Surselva. ETH Zürich, Departement Architektur, 2004/2005.
Diener, R. et al.: Die Schweiz - Ein städtebauliches Portrait, ETH-Studio Basel, Institut Stadt der Gegenwart. Birkhäuser Verlag, 2005.
Forster, S., Buchecker, M., Hunziker, M., Meier, C.: NFP 48 „Zielvorstellungen und -konflikte hinsichtlich alpiner Landschaftsentwicklungen“. Landschaftsentwicklung im Albulatal und im Sursès - Handlungsempfehlungen für den Regionalverband Mittelbünden. WSL, Birmensdorf, 2006.
Schuler, M., Perlik, M., Pasche, N.: Nicht-städtisch, rural oder peripher - wo steht der ländliche Raum heute? ARE, Bundesamt für Raumentwicklung, Bern, 2004.
Siegrist, D., Stuppäck, S.: Potenzialstudie naturnaher Tourismus in der Schweiz. Institut für Freizeit, Tourismus und Landschaft der Hochschule Rapperswil, 2002.
Zusatz:
Finanzierung und Politik
Am 21. Dezember 2004 hat die Regierung des Kantons Graubünden dem Bundesrat ein Gesuch um Finanzierung des Vorhabens „Porta Alpina Sedrun“ eingereicht. Der Kanton Graubünden hat sich bereit erklärt, sich seinerseits an der Finanzierung zu beteiligen.
Am 12. Februar 2006 ist in Graubünden der Kantonsbeitrag von 40% (6Mio. Fr.) an eine Vorinvestition in die Porta Alpina von rund 15Mio. Fr. an der Urne bewilligt worden, nachdem sich der Bundesrat bereits am 19. Oktober 2005 für eine Mitfinanzierung der Vorinvestition mit einem Bundesanteil von 50% entschieden hatte. Die restlichen 10% (1.5Mio. Fr.) der Vorinvestition werden von den Gemeinden der Region Surselva aufgebracht. Damit können die Arbeiten im Bereich der Tunnelröhren (zusätzlicher Ausbruch für Perronverbreiterungen und Wartehallen), die im Hinblick auf das oberste Gebot, dass die Arbeiten für den GBT nicht verzögert werden dürfen, zeitkritisch sind, rechtzeitig ausgeführt werden. Die nicht unmittelbar die Tunnelröhren tangierenden Arbeiten für die Porta Alpina sind weniger zwingend mit der Fertigstellung des GBT gekoppelt und weisen noch einen gewissen Spielraum für Varianten und Anpassungen auf. Mit der aktuellen Vorinvestition werden die Optionen für alle zukünftigen utzungsmöglichkeiten gewahrt.
Die Kosten für die weniger zeitkritische Hauptinvestition belaufen sich demnach auf rund 35Mio. Fr. Wenn derselbe Verteilschlüssel wie bei der Vorinvestition angewendet wird, beträgt der Anteil des Kantons Graubünden 14Mio. Fr. (40%). Ein Entscheid des Bundes über die Mitfinanzierung der Hauptinvestition ist noch offen und hängt vom Ergebnis technischer Zusatzabklärungen und von einem „Raumkonzept Gotthard“ ab, welches von den Gotthard-Kantonen (Uri, Tessin, Wallis und Graubünden) erarbeitet wurde und noch zu konkretisieren ist.
Trotzdem (oder gerade deshalb) hat die Bündner Regierung am 12. Februar 2006 dem Stimmvolk eine Kreditvorlage über den gesamten Kantonsanteil von 20Mio. Fr. für Vor- und Hauptinvestition unterbreitet. Der deutliche positive Entscheid wird, so die nicht unberechtigten Hoffnungen der Promotoren, die Entscheidungsfindung des Bundes beschleunigen und erleichtern. Der Verpflichtungskredit des Kantons Graubünden steht unter der Bedingung, dass sich auch der Bund und die Region Surselva, im Rahmen ihrer Anteile an der Vorinvestition, an den gesamten Investitionskosten beteiligen, und ist zeitlich befristet: Wird die Hauptinvestition bis zur Inbetriebnahme des GBT, voraussichtlich 2016, nicht realisiert, verfällt der Kredit. TEC21, Fr., 2006.06.16
16. Juni 2006 Stephan Forster