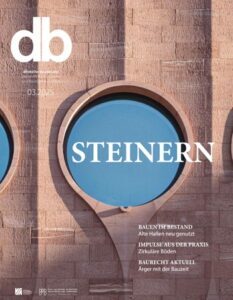Editorial
Sichtmauerwerk aus Ziegeln oder Naturstein verbindet Tradition mit moderner Baukultur. Seine Farb- und Texturvielfalt ermöglicht einzigartige, kontextbezogene Entwürfe. Trotz hoher Energiekosten und den Narben, die der Abbau in der Landschaft hinterlässt, punkten Ziegel und Naturstein mit Langlebigkeit und geringem Wartungsaufwand. Besonders interessant: die Wiederverwendung aufbereiteter Materialien. In unserer aktuellen db-Ausgabe »Steinern« erfahren Sie, wie Architekt:innen mit neuen Ansätzen die Zukunft dieses jahrtausendealten Baustoffs gestalten.
Wohnbau Hertogensite in Leuven
Im flämischen Leuven wandelt sich ein einstiges Krankenhausareal in ein Wohnviertel mit Park. David Chipperfield Architects schufen darin ein Ensemble aus drei Wohntypologien. Backsteine, historisch inspiriert und doch eigenständig, tragen zur einenden Sprache bei.
Ein jahrzehntelang abgedeckter Seitenarm des Flüsschens Dijle liegt zum Teil schon wieder offen, am Ufer sind erste Sitzstufen entstanden. Sie schließen an einen Stadtplatz an, der den Vorbereich zu teils fertigen Bauten in rotem Backstein von Sergison Bates, 360 architecten und De Gregorio & Partners bildet. Unmittelbar neben dem deutlich helleren Wohnensemble von David Chipperfield Architects türmen sich noch Lehmhügel auf, die bis Ende 2025 zum Park werden sollen: Das sind die Eckpunkte der Verwandlung, den die Hertogensite, vormaliges Krankenhausareal unmittelbar am Rande der Leuvener Innenstadt, derzeit unternimmt. Deren Geschichte reicht bis zur Gründung eines kirchlichen »Godshuis« zur Versorgung Kranker im 11. Jahrhundert zurück. Zuletzt platzte hier das nun an den Stadtrand verlagerte Unikrankenhaus aus allen Nähten. Den Wettbewerb zur Neuplanung gewann der Projektentwickler Resiterra schon vor 20 Jahren. Seit Beginn sind Wirtz International Landscape Architects beteiligt, 2014 zeichneten De Gregorio und 360 einen Masterplan. Sukzessive Anpassungen im Austausch mit der Stadt betrafen etwa den Erhalt verschiedener Altbauten und ein künftiges Zentrum für Podiumkünste. Der Kerngedanke aber ist bewahrt geblieben: Der Fokus liegt auf Wohnen und auf Entsiegelung – von Parkplätzen und Innenhöfen hin zu mehr Grün, zu autofreier Durchwegung, zu öffentlichem Raum.
Einheit und Vielfalt
Für den Chipperfield-Bau waren dies prägende Parameter. Anders als die übrigen Bauten steht er im künftigen Stadtraum weitgehend frei, womit auch ein klarer Solitär denkbar gewesen wäre. Teil des Projekts ist ein 14-geschossiger Wohnturm, der zu gewissem Grade diese Funktion übernimmt und in einem Turm von Sergison Bates gegenüber ein Pendant findet. Dass die beiden weder gleich hoch noch exakt symmetrisch platziert sind, unterstreicht indes, dass nicht mit großen Gesten hantiert wurde. Tatsächlich ist der im Masterplan vorgegebene Turm nur eine von drei verschiedenen Wohntypologien, die im Chipperfield-Entwurf zu einer Einheit zusammenkommen. Während der Turm 24 Kaufappartements plus ein Penthouse aufnimmt, schließen daran neun viergeschossige Reihenhäuser an, gefolgt von einem Endstück mit je drei Studios und Einzimmerwohnungen zur Miete. Dieser Abschnitt bildet zugleich das Kuppelstück zu einem Altbau der Universität, dessen künftige Nutzung noch ungewiss ist.
Die Balance zwischen Einheit und Vielfalt wird damit zu einer Art Leitmotiv. »Die unterschiedlichen Logiken legten ein Trennen der Teile nahe«, so Julien Gouiric, Projektarchitekt im Londoner Büro, »aber Bauvolumen und Masterplanvorgaben führten immer wieder zur Kompaktheit zurück.« Umso mehr liegt hier die Qualität des Projekts: Auf der Suche nach einer gemeinsamen Sprache formulierten die Architekten Baukörper, die ineinander übergehen und doch ihre Identität bewahren, sorgfältig skulptural geschnitten sind und zugleich die Untereinheiten lesbar halten. So greifen beim Turm je zwei L-förmige Wohnungen von 125 bzw. 140 m² um den Kern. Pro Etage ist die Position der Loggien gespiegelt, wodurch sie jeweils im Wechsel an den Ecken zu liegen kommen und den Rhythmus der vier Fassaden prägen. Das Penthouse folgt dem nahezu vollständig, das Parterre greift mit einer Vorhalle aus und nimmt einen Fitness- und einen Fahrradraum auf. Ähnlich lassen sich die Reihenhäuser als Kette einzelner Bauten oder als Quader mit Sägezahnfassade lesen. Durch die Verzerrung der Grundrisse zum Parallelogramm erhält jede Einheit ihren Eingang; rückwärtig ergeben sich geschützte Terrassen im 1. OG, von denen Treppen in die Privatgärten hinabführen. Am wenigstens eigenständig wirkt der Teil mit Mietwohnungen, der den benachbarten Rhythmus fortführt.
Material und Kontext
Die Wahl der Außenhaut spielte innerhalb dieser Haltung eine deutliche Rolle. Die grundsätzliche Entscheidung für ein mineralisches Material, das als Schale die tragende Funktion dem Stahlbeton überlässt, ging dem Entwurf voraus, als Präferenz des Bauherrn und der Stadt, insbesondere aber kontextuell begründet. Backstein ist in Leuven historisch vorherrschend, in roter Tönung aufgrund des Bodens, abgesetzt mit Leisten häufig in cremefarbenem Brabanter Sandstein, aus dem auch Sonderbauten wie das gotische Rathaus errichtet wurden. Eben jener Stein taucht auch im Sockel eines Stadtmauerfragments aus dem 12. Jahrhundert auf, das unmittelbar neben dem Projekt erhalten blieb. Der Entwurf verbindet das »Profanbaumaterial« Backstein mit diesem hellen Ton prominenter Zeichen. Bestätigt in der Farbgebung fühlten sich die Architekten durch die weite Sichtbarkeit des Turms, während beim Material durchaus abgewogen wurde. Terrazzoartiger Prefab-Beton, wie beim vom Bauherrn geschätzten Bryant Park Tower in New York, wurde in Betracht gezogen, hätte sich aber eher bei strenger Rasterfassade angeboten; günstigerer Putz schien zu wenig langlebig. Der halb handwerklich produzierte Backstein aus Dänemark – belgische Steine tendieren zu einem kälteren Grau oder hätten einen kostenaufwändigeren Vorlauf gebraucht – kombiniert nun physikalische Qualitäten mit einer, so Gouiric, nicht zu industriell wirkenden Varianz. Die Detailsorgfalt, mit der diese Entscheidungen fortgeführt wurden, ist dann typisch Chipperfield Architects. So zieht sich der Backstein auch über die untersichtigen Flächen; für die Terrassen wurde ein farblich exakter keramischer Belag gefunden; erst bei genauem Hinsehen fällt die historisch inspirierte Plinthe aus Fertigbeton auf. Die Steine wurden so wenig wie möglich zugeschnitten, selbst die Lüftungsschlitze möglichst gleichmäßig gesetzt. Von Ferne scheint das Ensemble, im Zusammenspiel mit den körperhaften Einschnitten der Loggien, monolithisch; in Nahsicht überwiegt eine freundliche, changierende Homogenität.
Urbane Langlebigkeit
Die Dauerhaftigkeit, die die Fassade ausstrahlt, darf auch als ein Aspekt von Nachhaltigkeit verstanden werden, den die Architektur von David Chipperfield Architects generell anstrebt. Im technischen Sinne trägt zur Nachhaltigkeit hier ein geothermiebasiertes Kollektivwärmenetz bei, das das Gesamtareal versorgt und im Zusammenspiel mit Booster-Wärmepumpen und Wärmerückgewinnung Heizung, Kühlung und Lüftung sicherstellt. Hinzu kommen Solarpaneele sowie Regenwassernutzung. Grundsätzlicher versteht der Entwurf Nachhaltigkeit als urbane Langlebigkeit, zu der die vom Bauherrn explizit geforderte Flexibilität der Nutzung beiträgt. So ließen sich im Turm die zwei Einheiten pro Geschoss ebenso zu einer – dann sehr generösen – Wohnung zusammenlegen. Wichtiger ist die individuelle Formbarkeit der Grundrisse dort und in den 250 m² großen Townhouses. Zwischen Kern und Fassade bzw. den Haustrennwänden konnten die Käufer:innen die Einteilung selbst wählen. Für die Reihenhäuser bedeutet dies, dass oberhalb von ein oder zwei Geschossen zum offenen »Durchwohnen« drei oder vier Schlafzimmer möglich waren; ebenso sind Einliegerwohnungen oder ein Bürobereich für freie Berufe zulässig.
Vor allem geben insbesondere die Reihenhäuser eine gewisse Belebung an den Stadtraum zurück. Das funktioniert auch deshalb, weil sowohl vorn, entlang der Stadtmauer, als auch hinten ausschließlich Fußwege verlaufen. Der Weg hinter den Privatgärten ist derzeit noch Sackgasse und entsprechend ruhig. Ob sich das künftig ändert, wird sich zeigen; bei Umnutzung des Uni-Gebäudes wäre eine, weiterhin nur fußläufige, Öffnung des Wegs vorgeschrieben. Die Vorteile dürften so oder so überwiegen: Das Projekt erkundet gewissermaßen in einer einheitlichen Figur, wie Differenzierung nicht nur zwischen Wohntypologien (innerhalb eines gewissen Marktsegments; Sozialwohnungen finden sich anderorts auf dem Areal), sondern zwischen öffentlichem und privatem Miteinander aussehen kann. Das gelingt, weil das Ensemble auf die spezifischen Bedingungen des Leuvener Areals reagiert. Die Balance ist so gesehen nicht nur jene zwischen Einheit und Vielfalt, sondern mehr noch jene zwischen urban und suburban.db, Fr., 2025.02.28
28. Februar 2025 Olaf Winkler