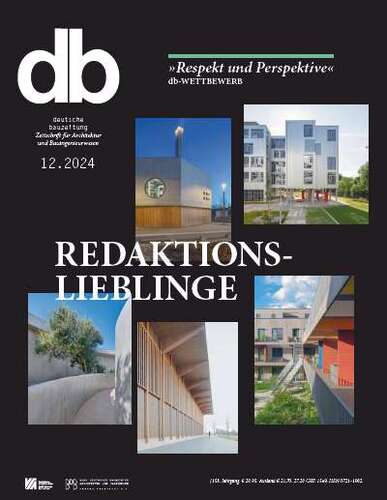Editorial
Bereits zum 16. Mal stellt die db-Redaktion in der Dezemberausgabe ihre Lieblingsprojekte unter gewohnt kritischem Blickwinkel vor. Ganz unterschiedliche Architekturen werden auch dieses Jahr umfassend betrachtet: Wir schauen in der aktuellen db Ausgabe »Redaktionslieblinge«, wie es sich an vielfarbigen Laubengängen wohnt, ob ein Blockheizkraftwerk auch ein Treffpunkt sein kann, wie man in einem »Holztempel« Feste feiert, wie sich mediterranes Lesevergnügen anfühlt und ob im Inneren eines sehr großen Schulbaus ein adäquater Maßstab fürs Lernen gefunden wird.
Mediathek in Porto-Vecchio
Etwas versteckt und unbemerkt, ohne große Allüren, aber mit subtilem Charme, entfaltet die neue Mediathek in Porto-Vecchio ihre Stärken von innen heraus. Der Entwurf respektiert den Bestand alter Olivenbäume und Steineichen, indem das Gebäude diese umschließt und umfließt. Zugleich ist ein neuer Ort mit bemerkenswerter Aufenthaltsqualität und breitem Zugang zu Medien und Büchern entstanden. Hiervon profitiert auch das angrenzende Quartier.
Auf den ersten Blick würde man die Mediathek an diesem Standort kaum erwarten. Fotos vom Gebäude lassen vermuten, dass es inmitten eines Waldes steht. Die Nachbarbebauung ist geprägt durch gesichtslose Wohnblöcke, heruntergekommene Gewerbebauten, einige Autowerkstätten und einen Hypermarché. Die neue Mediathek »Animu«, was auf Korsisch so viel bedeutet wie Atem, wertet allerdings das angrenzende Quartier Pifano deutlich auf. Noch in diesem Jahr sollen eine neue Schule, ein Sportplatz, ein Gemeindezentrum und Spielplätze hinzukommen. Insgesamt fließen fast 10 Mio. Euro in den Stadtteil, um bestehende Gebäude instand zu setzen und neue Einrichtungen zu schaffen. Mit ca. 12 000 Einwohner:innen ist Porto-Vecchio die drittgrößte Stadt Korsikas und verfügt über einen bedeutenden Fährhafen. Die Umgebung, bekannt für ihre Strände und Salinen, hat jedoch auch mit Verkehrsproblemen zu kämpfen und erlebt in der Sommersaison eine Verzehnfachung ihrer Bevölkerung. Geteilt wird die Stadt in die kleinere Altstadt auf dem Hügel, die tagsüber verschlafen wirkt und sich nachts in eine einzige Partymeile verwandelt, und die Unterstadt mit Hafen, Restaurants, Gewerbe und Wohnsiedlungen. 2016 schrieb die Stadt Porto-Vecchio einen Wettbewerb für eine neue Mediathek aus, die zusätzlich Raum für kulturelle Veranstaltungen bieten sollte. Die Mediathek hatte den Auftrag, die »Entwicklungsunterschiede innerhalb der Stadt zu verringern«. Während die hoch gelegene Altstadt über ein Kulturzentrum mit Kino verfügt, war die untere Stadthälfte bislang unterversorgt. Als Standort war ein felsiges Gelände vorgesehen, von Eichen und Olivenbäumen umgeben. Dominique Coulon & Associés gingen als Sieger aus dem internationalen Wettbewerb hervor: Ihr Entwurf zielt in erster Linie darauf ab, die umgebende Natur zu erhalten. Dazu vermaßen sie jeden Baum und Felsen. So lässt sich die organische Form des Sichtbetonbaus erklären. »Seine Kurven sind so gestaltet, dass sie die Bäume und Felsen umfließen«, erläutern die Architekten. »Das Gebäude umarmt die Landschaft, um sie besser zu schützen.« Bäume mussten für den Bau nicht weichen. Das Haus ist ein wahrer »Tree-Hugger«. Für die Menschen auf Korsika ist ein achtsamer Umgang mit der Natur von großer Bedeutung, denn sie sind fest verwurzelt in ihrer Tradition und seit jeher verbunden mit der wilden Landschaft, die geprägt ist durch schroffe Felsformationen, Korkeichen und Kastanienbäume. Das große Vertrauen in die Natur rührt sicherlich daher, dass man sich in der Geschichte der Insel stets vor den zahlreichen Angreifern ins bergige Hinterland zurückziehen musste.
Versteckt hinter Bäumen
Die Mediathek öffnet sich gleich mehrfach den Besucher:innen, durch zwei Panoramafenster an der Hauptstraße und einer Fensterfassade an der Seitenstraße. In dieser verkehrsberuhigten Seitenstraße befindet sich, versteckt hinter majestätischen Bäumen, der Haupteingang. Ein weiterer Seiteneingang mit direktem Zugang zum Multimediasaal liegt um die Ecke. Einige der Sichtbetonwände sind mit Granitstücken, einem auf dem Grundstück vorhandenen Gestein, durchsetzt. Das Material kommt häufig in lokalen Bauwerken vor und verleiht der Fassade schöne Lichtreflexionen, Kletterwand-Feeling inklusive. »Um die organischen Formen und den Schwebeeffekt von Rampen und Gebäude umzusetzen, war Beton das Mittel der Wahl«, erklärt Architekt Dominique Coulon. In einigen Bereichen setzt sich der schwere Betonkörper leicht vom Boden ab und berührt ihn nur an wenigen Stellen. »Zudem verstärkt Beton das monolithische Erscheinungsbild des Gebäudes.« Nicht zuletzt wurde die Materialwahl durch die Nähe zum Meer beeinflusst, was die Entscheidung für ein besonders widerstandsfähiges Material nahelegte.
Lesen mit Aussicht
Beim Betreten der Mediathek überrascht die Großzügigkeit der Innenräume. Doch ist der Innenraum keineswegs introvertiert, wie man es von herkömmlichen Bibliotheken erwarten würde. Er öffnet sich durch seine Panoramafenster der Umgebung und holt sich die Natur (zurück) ins Gebäude. Erfreulich ist das große Angebot an Kinderliteratur. Für Kinder gibt es viel Platz, alles wirkt offen und sehr aufgeräumt. Gemütliche Sitzkissen laden zum Schmökern ein. Auch separate Vorleseräume sind vorhanden. Die mittig gelegene Rotunde mit ihren Rückzugsräumen widmet sich digitalen Medien und Gaming. Ein schönes Detail auf den zweiten Blick sind die in die Rotunde eingeschnittenen Sitznischen mit Computerplätzen. Der Bereich für Erwachsene befindet sich in einem kleineren Seitenteil. Diese unterschiedlich große Gewichtung zwischen Kinder- und Erwachsenenbibliothek ist richtig, um angehende Bücherwürmer fürs Lesen zu begeistern, ohne dass es gleich aussehen muss wie in einer Kinderbücherei. Zahlreiche regionale Literatur, auch auf Korsisch, bereichert das Programm. Im Hochsommer sind die Räumlichkeiten von den Temperaturen angenehm, denn die südliche Fassade ist überwiegend geschlossen, die Bäume dienen der zusätzlichen Verschattung. Diffuses Tageslicht dringt über die großen Oberlichter ein und sorgt für angenehmes Leselicht. Die Farbgestaltung wird vom kräftigen Blau des Teppichs dominiert, das beruhigend wirkt und Assoziationen zu Himmel und Meer weckt. Das Blau setzt in den sonst cleanen Räumen einen Farbakzent. Stützen stehen nur dort, wo sie gebraucht werden, und ermöglichen Flexibilität in der Raumorganisation. Dies wird durch die schlanken Fensterpfosten, die ebenfalls Teil des Tragwerks sind, unterstützt.
Der Garten der Erkenntnis
Der eigentliche Rückzugsraum ist der Garten, ein Ort der Kontemplation. Lediglich eine Aufschrift über der unauffälligen Tür hinter dem Empfangstresen verrät, was sich dahinter verbirgt. Der Gang allein hat schon etwas Meditatives. Man schreitet eine etwa 50 m lange gewundene Rampe langsam hinab und taucht in eine andere Welt ein. Die Rampe ruht auf nur zwei Stützen und einer geschwungenen Begrenzungsmauer. Die linksseitig erhöhte Umfassung verschließt zunächst den Blick in den Garten, auf dem Weg nach unten kehrt sich das Verhältnis der Begrenzungsmauer um und Garten und Gebäude kommen zum Vorschein. Der Außenbereich nutzt die Hanglage des Geländes, wodurch kaum Straßenlärm eindringt. Hier gibt es eine Bar aus Betonblöcken, Sitzmöglichkeiten und ein kleines Amphitheater mit Segeldach. Das aufgeständerte Hauptgeschoss erlaubt Blicke durch und unter das Gebäude bis auf die andere Straßenseite. Im Sommer lässt es sich unter der korsischen Sonne gut aushalten. Hier finden Ausstellungen, Konzerte, Workshops sowie Lesungen statt.
Die Mediathek geht respektvoll mit dem Baumbestand und den charakteristischen Felsformationen des Geländes um, indem sie diese geschickt integriert oder umfließt. Für die Bewohner:innen bietet sie einen ebenso grundlegenden wie wertvollen Zugang zu Medien und Büchern. Ein Besuch lohnt sich nicht nur, um abseits der Touristenpfade in die bemerkenswerte Architektur einzutauchen, sondern auch, um an einem lauen Sommerabend ein kühles Kastanienbier zu genießen und die authentische Lebenswelt der Einheimischen kennenzulernen. Dennoch bleibt die Frage, ob die Investitionen in das Quartier den eigentlichen sozialen Bedürfnissen der Stadt langfristig gerecht werden.
Standort: Voie Romaine, 20137 Porto-Vecchio (F)
Bauherrin: Stadt Porto-Vecchio
Architektur: Dominique Coulon & Associés, Straßburg
Assoziiertes Architekturbüro: Amelia Tavella Architectes, Aix-en-Provence
Entwurf: Dominique Coulon
Vorentwurf: Ali Ozku, Hannes Libis, Hugo Maurice
Bauaufsicht: Für Amelia Tavella Architectes: Anaïs Natali, Margot Van Gaver
Für Dominique Coulon & Associés: Ali Ozku, Hannes Libis
Tragwerksplanung: SB Ingénierie
Beratung Statik: Batiserf Ingénierie, Fontaine
Elektroplanung: BET G. Jost, Straßburg
Akustikplanung: Ingemansson
Landschaftsarchitektur: Bruno Kubler
NGF: 1 200 m²
BGF: 2 805 m²
Nutzfläche: 1 060 m²
Baukosten: 4,5 Mio. Euro
Fertigstellung: 2022db, Di., 2024.12.03
03. Dezember 2024 Emre Onur
Doppelschule in Berlin von PPAG Architects
(SUBTITLE) Eine handvoll Compartments
In der Doppelschule an der Allee der Kosmonauten in Berlin-Lichtenberg griffen PPAG architects zu mehreren cleveren Tricks, um viele kleine Teile in einem großen Komplex zusammenzuführen, ohne dass man den Überblick verliert.
Das Architekturbüro hat auf diesen Wettbewerb geradezu gewartet: »2013 schon haben wir uns mit Wohnbau in Berlin beschäftigt. Wo Wohnungen entstehen, wächst auch der Bedarf an Bildungseinrichtungen, das war also nur eine Frage der Zeit«, so Georg Poduschka, der das Büro PPAG architects gemeinsam mit Anna Popelka führt. Diesen Bedarf hat auch der Senat von Berlin erkannt und 2016 die recht ambitionierte Berliner Schulbauoffensive (BSO) ins Leben gerufen. Es ging nicht nur darum, möglichst schnell viel Unterrichtsfläche zu schaffen – ganzheitliche, inklusive und nachhaltige Pädagogik verlangen auch nach neuen Ideen. Im Rahmen der BSO wurde das Konzept der Compartmentschule als Schulmodell der Wahl auserkoren und im Wettbewerb so ausgeschrieben. Compartments sind eigene kleine Schulen in der Schule. Hier wird jahrgangs- und klassenübergreifend in überschaubaren Gemeinschaften gelernt und gearbeitet. Die landeseigene HOWOGE, ursprünglich eine reine Wohnungsbaugesellschaft, wurde mit dem Bau von 26 Schulen und der Sanierung von 12 bestehenden Schulen beauftragt. Die Schulbauten sind über den gesamten Stadtraum verteilt und werden in allen Bezirken umgesetzt. Der bisher größte Schulbau dieser Offensive ist die Schule an der Allee der Kosmonauten in Berlin-Lichtenberg für insgesamt 1 600 Schüler und Schülerinnen, verteilt auf ein Gymnasium und eine Integrierte Sekundarschule (ISS).
Zusammen statt getrennt
Namen haben die Schulen noch nicht, bisher nutzt man die offiziellen Schulnummern Gym11Y12 und ISSK15. Deutlich einfallsreicher ist da der Neubau: PPAG architects setzten sich im Wettbewerb 2017 durch, indem sie die geforderten drei Elemente Gymnasium, ISS und Doppelturnhalle nicht auf dem Grundstück verteilten, sondern miteinander verzahnten. Diese Kombination spart nicht nur einiges an Grundfläche und Außenhaut, sondern ermöglicht auch Zusammentreffen und Verbindungen. Beide Schulen sind so konzipiert, dass die Gemeinschaft möglich ist, aber beide Schulen komplett autark funktionieren. So gibt es eigene Eingänge, zwei Mensen und zwei nebeneinanderliegende Eingangstüren zur Bibliothek, die in denselben Raum führen. Im Fall der Fälle kann leicht eine Trennwand errichtet werden, um aus einer Bibliothek zwei zu machen.
Das Grundstück ist zwar fast 38 000 m² groß, angesichts des Raumprogramms und der Außenanlagen ist es aber tatsächlich knapp. Zudem ist z. B. der Sportplatz ungewöhnlich groß, weil er der DFB-Norm entspricht. Nicht nur aus Platzgründen setzten die Architekt:innen die Turnhalle in die Mitte. Sie ist das verbindende Element zwischen beiden Schulen. Die Form der Schule leitet sich also von innen heraus ab: In der Mitte die Turnhallen, die quasi die Handfläche bilden, von der fünf baugleiche »Finger« mit den Compartments abgehen – in drei Geschossen jeweils ein Compartment pro Finger. Drei der Finger belegt das Gymnasium, zwei die ISS. Im EG befinden sich Bibliothek, Mensa, Mehrzweckraum und Verwaltung. Hier sind nicht alle Finger voll bebaut, sondern bilden überdachte Außenbereiche.
Im 3. OG sind die Fachräume angeordnet, was auch von außen ablesbar ist: Die gemeinschaftlichen Flächen dieser Etage, aber auch die Turnhallen, erhielten eine Profilit-Glasfassade. Die Fassade – egal ob Profilit oder Aluminium – mit ihren zahlreichen Einkerbungen ermöglicht zum einen mehr Tageslichteinfall, zum anderen bricht sie die große Fläche auf. Trotz dieser »Rüschung« war der Entwurf im Wettbewerb derjenige mit der geringsten Fassadenfläche, da man ja die zusätzlichen Turnhallenfassaden einspart.
Laut Georg Poduschka ist die Compartmentschule am besten geeignet, »den instruktiven Unterricht zu behindern«. Das klingt etwas rebellisch und das muss man wohl sein, wenn man eine Lernumgebung schaffen will, in der die Lehrkräfte eher Coaches als Vortragende sind, und gleichzeitig etliche technische, rechtliche und pädagogische Auflagen bekommt. Das Ergebnis ist eine Schule, die fast alles kann: völlig autarke Schulen, Begegnungen zwischen den Schulen, gemeinschaftliches Lernen, außerschulische Angebote, Sport unter Wettkampfbedingungen und vieles mehr. Wie das in der Realität genutzt und umgesetzt wird, muss sich erst noch zeigen, da beide Schulen von Grund auf neu aufgebaut werden und 2024 mit den siebten Klassen starteten – das Gymnasium ist sechszügig ausgelegt, die ISS vierzügig. Ältere Klassen gibt es noch nicht, die jahrgangsübergreifenden Gemeinschaften müssen sich erst noch bilden über die Jahre. Damit der riesige Komplex nicht leer steht, nutzen Schulen, die gerade gebaut oder saniert werden, diese Schule als Zwischenstation. So kommt es, dass es hier derzeit ganze 22 siebte Klassen gibt.
Wie eine eigene Stadt
Im Moment sind die Compartments also nur von 12- und 13-Jährigen »bevölkert«. Ob sie künftig jahrgangshomogen genutzt werden (ein Jahrgang wächst zusammen in seinem Compartment) oder jahrgangübergreifend (die Jüngeren lernen von den Älteren und andersherum), entscheiden nicht die Architekt:innen, sondern die Schule. Das Prinzip der vielen, kleinen Schulen im großen Gebäude kommt bei diesem Projekt besonders gut zum Tragen. Von außen ist man fast erschlagen von der schieren Masse an Schule, die da vor einem steht. Im einzelnen Compartment angekommen, hat man diese Dimension fast vergessen. Es ist geradezu gemütlich. Jedes Compartment ist gleich aufgebaut: Im Zentrum liegt das Forum, der multifunktionale Arbeits- und Aufenthaltsraum. Um diesen mit Tageslicht und Luft zu versorgen, griffen PPAG architects zum Kniff mit den Einschnitten in die Fassade. Vom Forum gehen alle anderen Nutzungen ab: Klassenzimmer mit Teilungsraum, Ruheraum, Teamraum für die Lehrkräfte und Toiletten. Bei Letzteren setzt Steffi Brunken von der HOWOGE, die das Projekt von Beginn an betreut hat, auf einen weiteren Vorteil dieser Schulform: »Die Schüler:innen identifizieren sich mit ihrem Compartment. Dementsprechend halten sie das auch eher in Ordnung als einen Waschraum, den sie mit 1 600 anderen teilen.« Die Treppenhäuser und gemeinschaftlich genutzte Bereiche sind in sichtbarem Beton ausgeführt, die offenen Steigleitungen unterstreichen den rauen Charakter. Die Compartments sind ebenfalls eher dezent gestaltet, allerdings deutlich feiner. »Die großen Flure sind die Straßen, die Compartments sind das Zuhause«, so Poduschka. Diese Trennung der gemeinschaftlichen und privateren Flächen stärkt die außerschulischen Nutzungen, ohne das »Zuhause« zu stören.
Konstruktiv mussten die Architekt:innen Kompromisse eingehen: Ursprünglich als Holzbau geplant, scheiterte dieses Vorhaben tatsächlich daran, dass es – zumindest zum Zeitpunkt der Ausschreibung – keine Generalunternehmer gab, die das in dieser Größenordnung zufriedenstellend umsetzen konnten. Hinzu kamen die leider immer noch üblichen Bedenken zu Brandschutz und Statik. So wurde es letztendlich ein konventioneller Stahlbetonbau. Um dennoch so nachhaltig wie möglich zu bauen, ist die Schule nach dem Zwiebelprinzip aufgebaut: das Innere muss am längsten halten, daher ist es der dauerhafte Stahlbeton. Die Fassadenunterkonstruktion ist aus Holz, die äußere Hülle, die am schnellsten getauscht werden kann, aus leichtem Aluminium.
Gestapelte Hallen
Weil es fast alles doppelt gibt, braucht man auch zwei Turnhallen. Diese sitzen übereinander: eine im 1./2. OG, eine im 3./4. OG. Aufgrund der geforderten Raumhöhen für die Turnhallen ergaben sich unterschiedliche Höhen der Geschosse: Das 1. und 2. OG sind ein wenig höher als das 3. und 4. OG. Hier guckt die Halle oben heraus, was schlicht und einfach günstiger war, als die Geschosse und somit auch die Fassadenfläche zu vergrößern. Im EG sind unter den Turnhallen die Mehrzweckräume angesiedelt. Um die Verbindung zu den Schulen zu stärken, haben beide Turnhallen große Glasflächen zu den Gemeinschaftsräumen. Für diese Fenster haben PPAG tapfer gekämpft, da sie nicht ohne Weiteres mit manchen Wettkampfrichtlinien vereinbar waren. Bei der Besichtigung waren die Vorhänge der Turnhallenfenster zugezogen, was ein wenig wie eine verpasste Chance wirkte. Aber wer weiß, vermutlich brauchen nicht nur die Jahrgänge Zeit, zu wachsen, sondern die ganze Schule, um sich an die Möglichkeiten und Freiheiten zu gewöhnen, die dieser wirklich gelungene Schulbau bietet.
Bauherrin: HOWOGE Wohnbaugesellschaft mbH
Architektur: PPAG architects, Wien
Mitarbeit: Anna Popelka, Georg Poduschka, Petra De Colle, Christian Wegerer, Paul Konrad, Jakub Dvorak,Felix Zankel, Billie Murphy, Olga Muskala, Alexander v. Lenthe, Henri Cullufe, Kerstin Enn, Lukas Felder, Maximilian Keil, Alexander Nanu
Generalplanung: ARGE FC/P/PAG
Generalplanerkoordination, Tragwerksplanung, Bauphysik, Kosten:
FCP Ingenieure
TGA & Akustik: Bauklimatik, Wien
Elektroplanung: Kubik Project, Gießhübl
Brandschutz: Brandschutz Plus, Berlin
Konsulenz Barrierefreiheit: Stefanie Bode, Berlin
Grafische Ausgestaltung: Bleed, Wien
Sportstättenplanung: Raumkunst, Wien
Fassade & Lichtplanung: Dr. Pfeiler, Graz
Küchenplanung: Ingenieurbüro Schaller, Karlsruhe
Landschaftsarchitektur: EGKK, Wien
Bau/Generalübernehmer: ARGE Ed. Züblin / Otto Wulff
Planungsleistung für GÜ: Zoomarchitekten, Berlin
Grundstücksfläche: 37 819 m²
Bebaute Fläche: 7 531 m²
BGF gesamt: 31 783 m²
Nutzfläche: 20 680 m²
Baukosten: 95 Mio. Euro
Bauzeit: Dezember 2021 bis April 2024db, Di., 2024.12.03
03. Dezember 2024 Anke Geldmacher