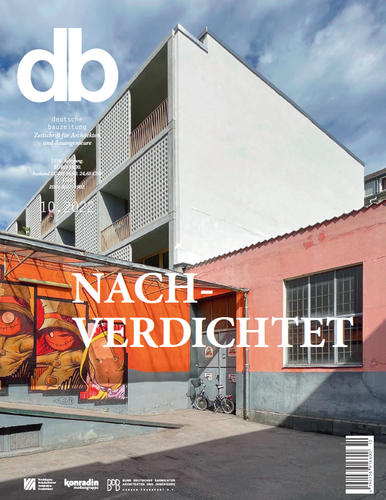Editorial
Bauland ist knapp und teuer – das ist zwar nicht neu, das Thema wird aber immer drängender. Nun könnte man sich noch auf dem Land weiter danach umschauen. Doch zum einen wird selbst dort das Angebot nicht größer und auch nicht günstiger, zum anderen sollte man sich womöglich doch besser auf das bereits Vorhandene konzentrieren. Und wenn das eben wenig Platz bedeutet, dann gilt es, Brachen und Ruinen wiederzubeleben, Lücken zu füllen und den Bestand aufzustocken.
Diesen Aspekt greift, wenn auch ein wenig überdreht, ein Hotel in Zaandam von WAM Architekten von 2010 auf, bei dem ein 12-stöckiger Neubau vermeintlich aus etlichen kleinen, traditionell anmutenden Häusern aufgeschichtet wurde – Häuschen werden gestapelt, statt sie wie üblich mit viel Abstand zueinander in der Landschaft zu verteilen. »Sky is the limit« ist vielleicht etwas zu hoch gegriffen, doch gerade in der Höhe liegt viel Potenzial, das in unseren Städten trotz aller Nachverdichtung auch noch Platz zum Leben ließe. | Anke Geldmacher
Soziale Plastik
(SUBTITLE) Wohnbauprojekt »Spiegelfabrik« in Fürth
58 Bauherren taten sich in Fürth zusammen, um ein Wohnbauprojekt mit sozialer und ökologischer Ausrichtung zu realisieren: Die »Spiegelfabrik«, nach den Plänen des Berliner Büros Heide & von Beckerath errichtet, ist kein Haus im Häusermeer – sondern ein Kiez im Kiez.
Eigentlich schade, dass hier eine Architekturkritik folgen soll. Das Sujet »Spiegelfabrik« schreit geradezu nach einem Format, das den menschlichen Faktor des Projekts betont. Eine Sozialreportage würde sich anbieten. Sogar für ein Serien-Exposé gäbe es reichlich Stoff: Ein paar Leute tun sich zusammen und begeben sich auf eine »Heldenreise«, die jeden Einzelnen vor unmögliche Herausforderungen stellt, am Ende aber doch zum Ziel führt, weil jeder Protagonist im Team über sich hinausgewachsen ist. Aber okay, bleiben wir auf dem Boden. Wenden wir uns Brigitte Neumann zu, der Heldin dieser Geschichte.
Die Ernährungswissenschaftlerin, Jahrgang 1962, gehört der Geschäftsführung der Baugemeinschaft an, die das Wohnbauprojekt »Spiegelfabrik« gemeinsam mit dem Berliner Architekturbüro Heide & von Beckerath ersonnen, geplant und realisiert hat. 58 Wohneinheiten umfasst das für rund 13,7 Mio. Euro errichtete, im März 2021 fertiggestellte Gebäude. Eine davon gehört Brigitte Neumann und ihrem Mann, aber eingezogen ist das Ehepaar bislang noch nicht. »Wir haben unsere Wohnung befristet vermietet«, sagt die agile Bauherrin. Sie möchte etwas Abstand vom Dauerstress der Bauzeit gewinnen, dennoch ist sie Feuer und Flamme, wenn es darum geht, Besucherinnen und Besuchern der »Spiegelfabrik« zu zeigen, was sie und ihre Mitstreitenden in Fürth geschaffen haben: ein Wohnhaus, ja sicher, aber eben auch so etwas wie eine Soziale Plastik.
Organisches Miteinander
Doch von Beginn an. Schauplatz des Bauabenteuers ist ein Grundstück im Südosten der Fürther Innenstadt nahe dem Stadtpark in den Auen der Pregnitz. Die Umgebung macht den Eindruck eines städtebaulichen Flickenteppichs. Es gibt Straßenzüge mit geschlossener gründerzeitlicher Wohnbebauung, aber auch Solitäre wie etwa einen Schulneubau mit spiegelnder Glasfassade. Zwischendrin klaffen kleine und größere Bebauungslücken, die als Parkplatz dienen oder brachliegen. Noch vor ein paar Jahren hätte man in der Gegend ein marodes Fabrikgebäude entdecken können, das sich zwischen der Lange Straße im Südwesten und der Dr.-Mack-Straße im Nordosten erstreckte. Errichtet im 19. Jahrhundert, als Fürth ein Zentrum der Spiegelindustrie war, wurden in dem Backsteingebäude zuletzt Fensterscheiben für Autos produziert. Nach dem Auszug des Fensterfabrikanten im Jahre 2015 stellte sich die Frage: Was tun mit dem ruinösen Industriebau? Nachdem die Denkmalschutzbehörde einem Abriss zugestimmt hatte, sollte zunächst eine Boulderhalle auf dem Gelände entstehen. »Aber wir haben uns schnell eines Besseren besonnen«, sagt Brigitte Neumann, die schon damals zu der fünfköpfigen Gruppe gehörte, die das Industriegelände neu beleben wollte. Die zündende Idee lautete dann: »Bauen wir eine große Wohnanlage mit sozialer und ökologischer Ausrichtung: generationenübergreifend, barrierearm, kinder- und familienfreundlich, mit gemeinschaftlich nutzbaren Räumen und Flächen.« Von Anfang an war den Bauherren in spe der Aspekt der Stadtverdichtung wichtig. Sie träumten nicht von weitläufigen Terrassenwohnlandschaften, sondern von eng verzahnten Lebensräumen, nicht von organisierter Einsamkeit, sondern von organischem Miteinander. »Ein Kiez im Kiez« – das war die Vision.
Gemeinsame Linie
Um nicht nur gut situierte Bürger, sondern auch weniger wohlhabende Interessenten für das Projekt zu begeistern, entschieden sich die Initiatoren, neben Eigentumswohnungen auch Räume für genossenschaftliches Wohnen zu schaffen. Dazu wurde eine Wohnungsgenossenschaft gegründet, in der die Eigentümer Fördermitglieder sind. 58 Parteien fanden sich am Ende zur Bauherrengemeinschaft zusammen. Die Architektensuche konnte beginnen.
Zunächst sprachen ein paar junge Planer aus dem Bekanntenkreis der Bauherren vor. »Die waren uns aber nicht gewachsen«, sagt Brigitte Neumann. »Sie hätten wohl versucht, unseren Wunsch nach der eierlegenden Wollmilchsau umzusetzen – was garantiert schiefgegangen wäre!« Im zweiten Anlauf lud das Team vier Büros ein, die bereits Baugruppenerfahrung hatten. »Die Architektenauswahl erfolgte über eine Matrix, die unsere wichtigen Wohn- und Sozialthemen enthielt. Heide & von Beckerath erfüllten unsere Anforderungen – und die Chemie stimmte auch.«
Daraufhin entspann sich ein Entwurfsprozess, der so vielschichtig war wie die Sache, um die es ging. Statt sofort mit der konkreten Planung zu beginnen, intensivierte das Berliner Team um Tim Heide und Verena von Beckerath zunächst einmal den Dialog mit den Bauwilligen. Um eine gemeinsame Linie zu finden, veranstaltete man insgesamt sieben Workshops – zu den Themen Städtebau, Wohntypologien, Wohnbedürfnisse, Entwurf, Regeln und Standards, Ausstattung sowie Ausführung.
Erst danach nahm das Gebäude nach und nach Gestalt an. Auf dem rund 3 400 m² großen Grundstück zwischen Lange Straße und Dr.-Mack-Straße, das von einem geschosshohen Geländesprung gequert wird, entstand ein lang gestreckter Baukörper mit je einem siebengeschossigen Kopfbau zur Straße hin. Die Erschließung des fünfgeschossigen Verbindungsbaus erfolgt über wechselseitige Laubengänge. Ein asphaltierter Weg führt an der nordwestlichen Gebäudeseite entlang und verbindet die beiden Straßen miteinander. Den Geländesprung gleicht eine breite Freitreppe aus, deren Betonstufen zum Sitzen einladen. Außer den Asphaltflächen und der Betontribüne im Nordwesten gibt es einen weiteren Freiraum auf der gegenüberliegenden Gebäudeseite. Dort befindet sich das Areal, auf dem das einzig erhaltene Relikt der Spiegelfabrik steht – die »Alte Schmiede«, die als Reparaturwerkstatt und Bastelraum genutzt wird. Der Platz vor der Schmiede ist derzeit noch eine Baustelle: Die Bewohner legen dort einen Garten mit Spielplatz und Begegnungsstätte an. Eine weitere gemeinschaftlich nutzbare Freifläche steht auf dem Flachdach zur Verfügung. Und auch im Gebäudeinneren gibt es einen Raum für gemeinsame Aktivitäten: Der »Spiegelsaal« mit angrenzender Küche, der unweit der Lange Straße im EG liegt, öffnet sich mit gläsernen Fronten zur Hof- wie zur Gartenseite.
Kritik mit einem Lächeln
Die divergierenden Vorstellungen der Bauherrschaft zur Aufteilung und Ausstattung der Wohnungen wirkten sich nicht zuletzt auf die Konstruktionsweise des Gebäudes aus. Tim Heide und Verena von Beckerath entschieden sich für eine robuste, der Industriearchitektur entlehnte Grundstruktur: »Ein Rahmen aus bewehrten Betonfertigteilen wurde mit Leichtbau kombiniert, um eine flexible Anordnung von Trennwänden in der horizontalen und vertikalen Konfiguration der Wohnungen zu ermöglichen.« 80 % der Außenwände bestehen aus vorgefertigten Holztafeln. Ein guter Dämmstandard und eine moderne Haustechnik sorgen für eine hohe Energieeffizienz. Zum Equipment gehören ein gasbefeuerter Brennwertkessel, ein gasbefeuertes Blockheizkraftwerk sowie eine Photovoltaikanlage, die dazu beiträgt, eine 60-prozentige Autarkie bei der Stromversorgung zu erreichen.
Aber zurück zu Brigitte Neumann und zur Sozialen Plastik, die sie und ihre Mitstreiter geschaffen haben. »Von den acht geförderten Wohnungen«, sagt sie, »stehen vier für Flüchtlinge zur Verfügung, andere werden vom Verein ›Lebenshilfe Fürth‹ angemietet. Eine weitere Wohnung bietet der PEN-Club für exilierte Schriftsteller an.« Und schließlich: »Im Gebäude wurde ein städtisches Quartiersbüro für nachbarschaftliche Anliegen und Initiativen eingerichtet, getragen vom gemeinnützigen Verein ›Spiegelfabrik‹.« Bei allem Stolz auf das Geleistete weiß die Bauherrin natürlich, dass Anspruch und Wirklichkeit stets auseinanderklaffen. Deutlich wird dies im Gespräch mit einigen Bewohnerinnen und Bewohnern, die allesamt gern in der Spiegelfabrik leben, aber nicht unbedingt jedes architektonische Detail goutieren. Einer stößt sich an den rauen Badfliesen, ein anderer am schmutzempfindlichen Betonboden des Laubengangs, diese ärgert sich über den unebenen Asphalt, jene über den allzu starken Hall im Hof. Andererseits wird jede Kritik mit einem Lächeln vorgetragen. Man spricht freimütig aus, was man denkt. Jeder weiß, dass Kompromisse dazugehören, wenn man miteinander baut und lebt.db, Mo., 2022.10.24
24. Oktober 2022 Klaus Meyer
Qualitätsoffensive in maximaler Dichte
(SUBTITLE) Wohngebäude in Düsseldorf
Was noch geht, wenn ein Stadtteil am Limit ist, zeigen TRU Architekten mit dem Wohnhaus Herzogstraße 79a/b in Düsseldorf. Der Neubau, ein Hinterhaus, ist einfach und gut. So ragt er aus dem dicht gewebten Teppich aus Teerpappe und Beton und setzt ein Zeichen für den Neuanfang. Aber reicht Bauen hier?
Die Herzogstraße liegt im Düsseldorfer Stadtteil Friedrichstadt: Hier ist Düsseldorf nicht schick, eher bürgerlich-rustikal und mit 19 984 Einwohnern/km² (Stand 12/2016) vor allem dicht: Es ist der am dichtesten besiedelte Stadtteil Deutschlands. Die Blöcke der gründerzeitlichen Stadterweiterung sind mit rund 190 m Kantenlänge sehr tief, doch anders als zum Beispiel in Berlin ist der Binnenraum vollkommen unstrukturiert. Gewohnt wird im Blockrand, die kleinen Läden, Büdchen und Kneipen im EG zeigen mit dem Herzog im Namen eine gewisse Ortsverbundenheit. Zwischen dem »Durst-Bunker« und einer Autowerkstatt, die zu besseren Zeiten ein Autohaus war, fügt sich ein Wohnhaus in die Reihe, schlichte Nachkriegsarchitektur mit Lochfassade, vier Geschosse auf erhöhten Sockel, Gauben lugen über die Traufe. Etwas außermittig sitzt im EG eine Tordurchfahrt, wie man sie hier häufiger sieht. Meist findet man in den Höfen Werkstätten oder Lager, An- und Weitergebautes, versiegelte Flächen, kein Grün. Lange sah es so auch im Hof der Herzogstraße 79 aus, wo ein kleiner Betrieb Druckmaschinen reparierte. Heute fällt der Blick durch das Tor auf einen noch zarten Ahorn, dahinter eine frische Fassade, eine Eingangstür aus hellem Holz.
Neu denken, neu bauen
Den privaten Eigentümern von Haus und Grund der Hausnummer 79 schien das aufgegebene Gewerbe kein gutes Gegenüber für das Vorderhaus zu sein. So wurde der Bestand im Hof bis auf die an der rückwärtigen Wand gelegene und dadurch einseitig belichtete zweigeschossige Halle reduziert. Darin sollten vier Wohneinheiten entstehen, in einem kleinen Neubau an der östlichen Brandwand zwei weitere, im Hof neben acht Stellplätzen auch etwas Grün.
Nachdem der Architekt, der bereits eine Vorplanung gemacht hatte, plötzlich verstorben war, übernahmen TRU Architekten. In Düsseldorf hatte das Berliner Büro bereits gebaut, eine Nachverdichtung gab es in ihrem Portfolio bis dahin jedoch nicht. Mit dem Ziel eine »relevante Nachverdichtung zu schaffen, ohne dass es unangenehm dicht wird«, so Karsten Ruf (Gründungspartner bei TRU Architekten), analysierten sie die Situation im Blockinnenraum, prüften das Baurecht und erkannten, dass durch einen kompletten Rückbau der verbauten Situation im Hinterhof ein grenzständiger, 15 m tiefer viergeschossiger Neubau mit zwei Höfen, einem sehr funktionalen ersten Hinterhof und einem zweiten Hinterhof als Privatgarten möglich würde. Da Abstandsflächen nur zum eigenen Vorderhaus einzuhalten waren, konnte das Bauvolumen im Vergleich zu der Vorplanung mit Bestand verdoppelt werden. Zwölf neue Mietwohnungen gibt es nun, davon zwei (je 100 m²) barrierefrei mit drei Zimmern im EG, jeweils vier Zweizimmerwohnungen (je 55 m²) im 1. und 2. OG, im 3. OG wieder zwei große Dreizimmerwohnungen. Die Erschließung des achsensymmetrisch geplanten Neubaus erfolgt über zwei getrennte Eingänge und Treppenhäuser.
Viel wenn und aber
Einfluss auf den Entwurf hatte auch ein möglicher Brandfall. Mit ihren Fahrzeugen kommt die Feuerwehr nicht durch die schmale Tordurchfahrt, im Hof muss sie daher mit Handleitern arbeiten. Bis zum 2. OG gelten die als zweiter Rettungsweg, für das 3. OG wurde der baulich über eine Verbindung der beiden Treppenhäuser hergestellt. Die Baustelleneinrichtung und die Transportlogistik für das komplett umbaute Grundstück bezeichnen die Architekten rückblickend als anspruchsvoll. Von der Straße aus wurde ein Kran mit einem Autokran über das Vorderhaus gehoben und dort im heutigen ersten Hinterhof aufgestellt, trotzdem blieben viele Handtransporte. Das Grundstück wurde vollständig geräumt, einzelne Kellerräume blieben und wurden verfüllt, die Bodenplatte perforiert, um Versickerungsfähigkeit herzustellen. Gegründet wurde der Neubau, der ohne Keller auskommen muss, mit Mikropfahlgründung durch die alte Bodenplatte bis in tragfähigen Grund. Gerüste mussten teilweise hängend errichtet werden, da die Garagendächer der Nachbarn nicht belastet werden konnten. Für die Bauherren waren die durch diese Maßnahmen entstehenden Mehrkosten kein Argument gegen die Entwicklung ihres Grundstücks.
Sichtbarkeit
Der im März 2022 fertiggestellte weiße Quader ragt heute scharf geschnitten aus dem niederen Grauschwarzbraun des Blockinnenraums empor. An den schmalen Kopfenden ist er geschlossen. Die Fassaden der beiden langen Flanken sind entsprechend ihrer Ausrichtung unterschiedlich gestaltet. Die Nordseite bildet das Pendant zum Vorderhaus mit einer Interpretation der Lochfassade. Wie eingestreut liegen die Fenster in verschiedenen Größen in der glatt geputzten Fläche. Die Fensterrahmen aus heller Fichte und die angeschrägten Einfassungen aus weißen Aluminiumblechen geben einen kleinen Hinweis auf die Handschrift der Architekten. Nach Süden in den Blockinnenraum gewandt, ist die Fassade voll verglast. Wie ein offenes Regal davorgestellt sind die Balkone; Platten und Schotten sind Sichtbetonfertigteile.
Sicht- und Sonnenschutz bieten die geschosshohen, 60 mm dicken edelstahlbewehrten Glasfaserbetonelemente, die bündig an der vorderen Kante der Balkone sitzen. Je nach Sonnenstand fällt durch das dichte Raster konischer Lochungen ein mit Lichtpunkten gesprenkelter Schatten in die Wohnungen – in die andere Richtung suchen die ersten Triebe der Balkonbepflanzung den Weg zur Sonne. Aus der Nähe zu sehen sind die Lochplatten nur aus dem Garten und von den Balkonen. Nachbarn der umliegenden Blockränder erleben den von TRU Architekten bewusst inszenierten Kontrast der formalen Strenge des aufgeräumten Schachbretts aus offenen und durchbrochenen Flächen zu dem tristen Chaos des Blockinnenraums.
Die Gärten der beiden Wohnungen im EG, die entsprechend ihrer besonderen Lage gestaltet wurden, sind nur aus dem eigenen Haus einsehbar. Noch teilen sie ihr Grün nicht mit der Nachbarschaft, denn die Spitzen der zwei Trompetenbäume werden noch etwas wachsen müssen, bis sie über die Dachlandschaft lugen und andere an ihrem Grün teilhaben lassen. Der erste Hinterhof ist bis auf die Baumscheiben der kleinen Ahornbäume versiegelt, die Oberfläche aus kunstharzversiegeltem Quarzsand im hellen Ton der Fassade wertet den hochfunktionalen Raum auf. Viel Platz für Grün blieb zwischen den zahlreichen Funktionen nicht, denn außer dem Zugang zum Hinterhaus mussten hier zwei Stellplätze (die übrigen konnten abgelöst werden), eine Rampe zum Fahrradkeller im Vorderhaus, Fahrradständer, eine neue Spindeltreppe als zweiter Rettungsweg fürs das Vorderhaus und zahlreiche Mülltonnen Platz finden.
Ist dies der Anfang?
Unumgänglich ist heute die Frage nach der Nachhaltigkeit des Projekts. Die Haustechnik ist da zu nennen, sicher auch die Tatsache, dass von der zuvor vollständig versiegelten Fläche nun gut ein Drittel entsiegelt oder vegetativ angelegt wurde. Rechnet man Garten, Baumscheiben und Gründach zusammen, liegt die Maßnahme deutlich über den im Bebauungsplan geforderten 20 Prozent Vegetationsfläche. Vorrangig für Karsten Ruf ist jedoch der Aspekt der Nachverdichtung. Während auf der grünen Wiese Ackerland Acker bleiben soll, bieten Höfe wie dieser ein großes Potenzial, den in den Innenstädten verzweifelt gesuchten Wohnraum neu zu schaffen und den Bestand gleich mit aufzuwerten. Wenn die Eigentümer wie in diesem Fall Bestandshalter (keine Projektentwickler) sind, ist es auch möglich, die neu geschaffenen Wohnungen für eine ihrer Lage und Qualität angemessene Miete anzubieten.
Beim Ortstermin mit Anno Lingens lässt uns ein Mieter einen Blick in sein Wohnzimmer werfen, die Nachbarn aus Vorderhaus, Autowerkstatt und Getränkehandel grüßen uns, man kennt sich offenbar. Auch während der Bauzeit sei das Verhältnis freundlich und kooperativ gewesen, was der Durchführung der Baumaßnahme in dem dicht bebauten Gefüge zugutekam. Jeder, dessen Wohnung ein Fenster in den Blockinnenraum hat, sieht den markanten Neubau im Hof der Herzogstraße 79. Sicherlich ist dies ein Pionierprojekt, eines, das Interesse weckt und Nachahmer finden wird.
Allerdings muss man sich genau hier auch die Frage stellen, wie viel Nachverdichtung der dichteste Stadtteil Deutschlands überhaupt noch verträgt. Genau durch dessen Mitte führt die Corneliusstraße, die stickigste Straße Düsseldorfs (Rheinische Post), Messungen belegen dies. Hier gibt es wenig Grün, die Hochsommerhitze steht zwischen den Häusern. Natürlich bieten die Höfe noch Flächen und untergenutzte Bausubstanz, sogar Leerstand im großen Maßstab, wie die seit 2013 geschlossene Immanuelkirche (Heinz Kalenboom, 1966), die im selben Block wie das hier besprochene Projekt liegt. Bauen alleine wird diesen Lebensraum nicht besser machen, nur noch dichter.db, Mo., 2022.10.24
24. Oktober 2022 Uta Winterhager