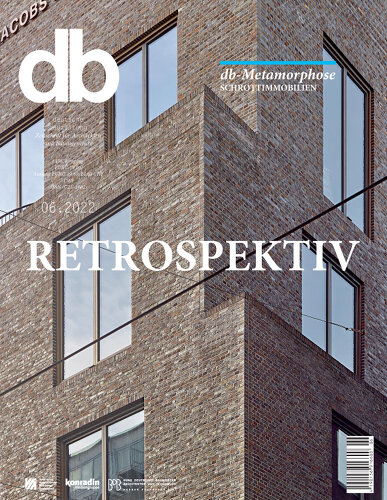Editorial
Den Blick zurück werfen kann wehmütig machen oder inspirieren. Er kann dazu verleiten, Dinge völlig anders oder genau gleich zu tun – häufig liegt die »Wahrheit« irgendwo dazwischen. Diesen Blick zurück warf Thomas Phifer nicht auf ein Gebäude, sondern auf unrealisierte Pläne von Ludwig Mies van der Rohe. Dessen Auftrag war es 1952, ein Universitätsgebäude in Bloomington, Indiana, im Stile des soeben fertiggestellten Farnsworth House zu errichten. 1957 wurde der Plan aus Geldnot verworfen, 2015 erneut betrachtet und 2019 wiederbelebt. Dünne weiße Stahlprofile und raumhohe Glaselemente tragen deutlich Mies' Handschrift und wirken doch wie ein Kind der heutigen Zeit. Im Februar zog die Eskenazi School of Art, Architecture + Design ein.
Bei der Erweiterung des Landratsamts in Starnberg (ab S. 46 in dieser db) waren Auer Weber sich selbst ein Vorbild: Sie bauten ihr Gebäude aus den 80er Jahren weiter. Auf den ersten Blick aus einem Guss, aber mit der Technik von heute. Unsere weiteren ausgewählten Projekte hatten weniger deutliche Vorlagen, der Blick zurück – u. a. auf Gründerzeit und Klassizismus – ist aber deutlich erkennbar. | Anke Geldmacher
Palazzo aus Holz
(SUBTITLE) Bankgebäude in Sarnen (CH)
Klassisch, fast wie ein Palast, wirkt der neue Hauptsitz der Obwaldner Kantonalbank im schweizerischen Sarnen. Das Besondere daran: Es handelt sich um ein hölzernes Gebäude, nicht um einen Massivbau.
Gut 20 Minuten benötigt der Zug von Luzern aus in südlicher Richtung nach Sarnen, den Hauptort des kleinen Kantons Obwalden. Das ist eine Pendlerdistanz, und die S-Bahn hält seit 2016 auch am neu angelegten Bahnhof Sarnen-Nord. Hier, zwischen dem historischen Ortskern und dem kleinen Flugplatz Kägiswil, ist in den vergangenen Jahrzehnten ein Gewerbegebiet entstanden, das gemäß dem Quartierplan für das bahnhofsnahe Gebiet namens »Feld« in den kommenden Jahren weiter mit Büro- und Wohngebäuden verdichtet werden soll.
Das erste Gebäude, das auf diesem Areal errichtet wurde, ist der im September 2021 eingeweihte Hauptsitz der Obwaldner Kantonalbank (OKB). Bis 2005 war die öffentlich-rechtliche Bank des Kantons gegenüber vom Bahnhof und damit im historischen Ortskern ansässig. Doch dann zog das Hochwasser der Saaner Aa das Gebäude so in Mitleidenschaft, dass über einen Neubau an gleicher Stelle nachgedacht werden musste. Allerdings verzögerte sich das Bauprojekt, und schließlich entschied sich die OKB, in das neue Quartier nördlich des Ortszentrums umzuziehen, wo eine geräumigere Parzelle zur Verfügung stand. Das aus der Region hervorgegangene, heute vorwiegend in Luzern ansässige Büro Seiler Linhart konnte 2017 den Studienauftrag für sich entscheiden.
Wie repräsentiert sich eine Bank?
In seiner »History of Building Types« (1976) widmet Nikolaus Pevsner Börsen und Banken ein eigenes Kapitel. Doch blickt man auf die historischen Beispiele, so zeigt sich, dass eine wirkliche Typologie des Bankgebäudes nicht existiert. Mal treten Banken eher wie repräsentative Bürobauten in Erscheinung – etwa der ehemalige Hauptsitz der Schweizerischen Kreditanstalt am Zürcher Paradeplatz, das Schweizer Bankgebäude des 19. Jahrhunderts schlechthin –, mal rufen sie die Idee des Schatzhauses in Erinnerung, so die Jewel-Box-Banken von Louis Henry Sullivan im Mittleren Westen des USA. Seiler Linhart standen also vor einer wichtigen Frage: Welcher Ausdruck ist heute für eine Bank adäquat? Und das nicht im urbanen Kontext, sondern im ländlich geprägten Sarnen?
Die Architekten entschieden sich für eine durchaus repräsentative Geste: Der auch Quadrum titulierte Neubau ist ein quadratisches Volumen mit jeweils zwölf Fassadenachsen und fünf Geschossen. Klassisch, fast palastartig, steht er inmitten eines noch weitgehend unbebauten Geländes, was die solitäre Wirkung unterstreicht. Die Gliederung der Fassaden ist an allen Seiten gleich; nur der eingezogene, zwei Achsen übergreifende Haupteingang im Süden zeigt an, dass es sich hier um die Hauptfassade handelt. Stärker tritt die vertikale Differenzierung in Erscheinung: Perforierte metallene Sonnenschutzelemente vor den Fenstern charakterisieren die beiden Publikumsgeschosse, während die jeweils in vier vertikale Streifen gegliederten Fenster der drei internen Bürogeschosse darüber mit textilen Stores verschattet werden können. Zweifelsohne ungewöhnlich ist die Entscheidung, den Palazzo der Bank als Holzkonstruktion ausführen zu lassen. Aus Beton bestehen lediglich das UG und der als Aussteifung fungierende Erschließungskern, das Tragwerk wurde in Skelettbauweise mit Stützen und Unterzügen aus Eschenholz erstellt; Verbundträger aus Esche und Fichte und ein Überzug aus Beton bilden die Decken. Während das Holz im Inneren unbehandelt geblieben ist, wurde die Fassadenschalung aus Fichtenholz dunkel lasiert; die Farbe ist schwer zu beschreiben, sie wirkt gräulich mit einem gewissen Rot-Anteil, die Architekten sprechen von Aubergine. Das nimmt dem Gebäude den rustikalen Ausdruck des Hölzernen, und von der Ferne aus mag man noch nicht einmal an einen Holzbau denken. Nähert man sich indes dem Gebäude, so tritt die differenzierte Fassadengliederung deutlich in Erscheinung: Die vertikalen Elemente sind mit Kanneluren versehen, die Knotenpunkte mit farblich leicht abgesetzten Auflagen, sodass sie wie Kapitelle wirken. Die horizontalen Bretter im Sockelbereich wurden zudem mit gefrästen Mustern dekoriert, die sich aus den Buchstaben OKB zusammensetzen. Hat sich die steinerne griechische Tempelarchitektur aus dem Holzbau entwickelt, so gehen Seiler Linhart gewissermaßen den umgekehrten Weg: Sie übertragen einen steinernen Palazzo in das Baumaterial Holz. Der Neubau der OKB verheißt Urbanität, bleibt aber noch dem Ländlichen verhaftet. Er verspricht Solidität und Sicherheit, Werte also, mit denen Banken sich identifizieren – und ist doch ganz aus dem Holz des Kantons Obwalden erstellt. Wirkt die Fassade allzu retrospektiv? Wäre hier etwas weniger an klassizierender Ornamentik wünschenswert gewesen? Darüber ließe sich diskutieren.
Halle und Lichthof
Vorbei an den Selbstbankingbereichen gelangt man vom Haupteingang aus in die zweigeschossige Kundenhalle. Geschnittene Terrazzoplatten, in welche Flusskiesel aus Obwaldner Gewässern eingelegt wurden, bilden den Bodenbelag; in die Deckenraster integriert sind Felder mit Beleuchtungselementen, welche den Raum entsprechend dem Verlauf des Tageslichts erhellen. Eine geschwungene Treppe führt hinauf zur Galerie im 1. OG, über die verschiedene Besprechungsräume erreichbar sind.
Wie in den zuvor vom Architekturbüro realisierten Arbeiten beeindrucken auch in Sarnen die Präzision der Materialverarbeitung und die Liebe zum Detail. Das zeigt sich etwa an den im Raster von 2,8 m stehenden Stützen, die sich – ähnlich der antiken Entasis – dem Druckmoment entsprechend verjüngen und damit eine subtile, kaum wahrnehmbare Dynamik erzeugen. Seiler Linhart waren darüber hinaus auch für den Entwurf der Theken aus Räuchereiche und anderer Einbauten verantwortlich, sodass eine starke räumlich-gestalterische Kohärenz erzielt werden konnte, die sich auch in der Cafeteria oder im Schließfachbereich fortsetzt. Gelungen und eine wirkliche Bereicherung sind außerdem die insgesamt acht künstlerischen Interventionen mit Obwalden verbundener Kunstschaffender, die sich über die verschiedenen Geschosse verteilen und als integraler Bestandteil der Architektur wirken. Die drei Bürogeschosse über dem öffentlichen Sockel gruppieren sich um einen schmalen Innenhof, der seitlich berankt und am Boden mit einer von einem Bewässerungssystem gesteuerten Hochmoorvegetation en miniature versehen ist.
Die Erstellung des Holzbaus benötigte bis zum Richtfest lediglich neun Tage. Zwei regionale Holzbauunternehmen fertigten die Elemente, die von 50 Arbeitern im Zweischichtbetrieb installiert wurden. Das Gebäude bietet insgesamt Platz für 160 Mitarbeitende; derzeit arbeiten vor Ort 130 Personen, es bestehen also – insbesondere im hinteren Gebäudeteil – noch räumliche Reserven für die Zukunft.db, Di., 2022.06.14
14. Juni 2022 Hubertus Adam
Retro-Pop
(SUBTITLE) Wohnbauensemble »Erhardt 10« in München
Mit dem Wohnbauensemble »Erhardt 10« am Münchner Isarufer entstand ein Stadtbaustein, der sich selbstbewusst in eine Reihe denkmalgeschützter Häuser einfügt. Das Ganze präsentiert sich als smarter Mix aus vertrauten Mustern und Motiven.
Die Erhardtstraße im Münchner Zentrum ist ein teures Pflaster. Zwar übertönt der Autolärm hier zu jeder Tages- und Nachtzeit das Rauschen der Isar, die parallel zur Straße verläuft, dennoch ist die Lage phänomenal. Wer an der Ehrhardtstraße wohnt, hat eine pittoreske Flusslandschaft vor Augen und das quirlige Gärtnerplatzviertel im Rücken. Wer dort bauen will, muss sich mit gewachsenen Gegebenheiten und steingewordener Geschichte auseinandersetzen. Eine Architektur ist gefragt, die sich »einerseits selbstbewusst in die Reihe denkmalgeschützter Bauten entlang des Ufers eingliedert und den Blick auf den Fluss zelebriert, zugleich aber auch die Heterogenität des Gärtnerplatzviertels anerkennt.« So jedenfalls beschreibt der Immobilienentwickler Euroboden die Herausforderung.
Die Firma des umtriebigen Baukultur-Enthusiasten Stefan Höglmaier hatte 2013 ein Grundstück an der Erhardtstraße 10 erworben. Um Platz für einen Neubau zu schaffen, wurden sowohl das bestehende Wohngebäude an der Straße als auch eine marode Lackfabrik im Hinterhof abgebrochen. Das in der Nachkriegszeit entstandene Vorderhaus hatte gerade mal sieben Wohneinheiten beherbergt, der Investor schickte sich an, das gesamte Grundstück einschließlich des verwinkelten Hofareals zu bebauen und alles in allem 28 Wohnungen zu schaffen. Bei der Planung kam mit Thomas Kröger ein Architekt zum Zuge, der sich mit sensibel in die norddeutsche Landschaft gefügten Wohnhäusern einen Namen gemacht hatte und nun seinem ersten innerstädtischen Großprojekt entgegensah. Kröger nahm sich vor, »die historische Prachtstraße mit einem eleganten, identitätsstiftenden Stadtbaustein zu ergänzen, der sich angenehm in die Häuserreihe einfügt.« Dabei sollten »die benachbarten, historisierenden Fassaden mit ihren heterogenen Gliederungen maßstäblich aufgegriffen und zeitgemäß in Material und Gestalt übersetzt werden.«
Geglückte Balance
Was aus dem Plan geworden ist, lässt sich seit gut einem Jahr besichtigen. Zu entdecken ist dabei natürlich viel mehr als eine Fassade, zieht sich der im Mai 2021 fertiggestellte Komplex doch weit in den unregelmäßig geschnittenen Hof hinein und umfasst neben dem Vorderhaus ein siebengeschossiges Hofhaus sowie einen weiteren Riegel samt Seitenflügeln. Doch bei einem Stadthaus in solch prominenter Lage ist es nun mal v. a. die Straßenfront, in der sich Qualität und Charakter eines Entwurfs abzeichnen, sodass es sich allemal lohnt, die Physiognomie des Gebäudes näher in Augenschein zu nehmen. Allerdings ist es mit Hausfassaden nicht anders als mit menschlichen Gesichtern: Der erste Eindruck entscheidet darüber, ob ich mich überhaupt näher mit dem Gegenüber befassen möchte. Beim Haus an der Isar ist das definitiv der Fall. Es fällt angenehm auf. Es demonstriert Individualität, ohne angeberisch aufzutrumpfen. Es aktualisiert gattungsspezifische Muster, ohne sie platt zu kopieren. Die geglückte Balance zwischen Historizität und Aktualität verschafft dem Objekt Aufmerksamkeit im bestmöglichen Sinne: Passanten betrachten es weder als Ärgernis noch als Banalität, sondern als spannende Variation eines altvertrauten Themas.
Trompe l’Œil
Im Unterschied zu den steinernen Nachbarhäusern setzt der Neuling auf eine Vielzahl von Materialien, um sich in Szene zu setzen. Kupfer, Stahl, Glas und Putz spielen die Hauptrollen. Die horizontale Gliederung der Fassade wird durch metallene Gesimsbänder akzentuiert, die Vertikale durch weiß gestrichene Stahlstützen betont. Hinter den vorspringenden Säulchen liegen die Glasflächen der geschosshohen Fenster, die einen Großteil der Fassade einnehmen und gleichsam ihre Kulisse bilden. Ein weiteres hervorstechendes Element ist der über fünf Geschosse aufragende Erker, der mit seinen großen Fenstern die rechte Seite des Gebäudes dominiert. Doch damit nicht genug. Glas und Metall sind nur zwei der drei Materialien, die den Charakter der Fassade prägen. Hinzu kommen verputzte Wandpartien, die aufgrund ihrer ornamentalen Oberflächenstruktur ins Auge fallen. Das zweifarbige Muster aus parallel verlaufenden Zackenbändern erzeugt einen Trompe-l’Œil-Effekt, der die Flächen dreidimensional erscheinen lässt. Kröger erweist damit den in Sgraffito-Technik ausgeführten Wandmalereien seine Reverenz, die man in München vielerorts entdecken kann, wo sie bis in 50er Jahre hinein beliebt waren. Was allerdings die Originale ganz unabhängig von ihrer bildnerischen Klasse gegenüber der Cover-Version in der Erhardtstraße auszeichnet, ist die haptische Qualität massiver Wände. Berührt man die Zackenbandfläche bei diesem Bau, fühlt sie sich warm an; klopft man dagegen, klingt es hohl. Die Wärmedämmschicht als Illusionskiller – sie trübt die Laune bei der Besichtigung dieses insgesamt erfreulichen Bauwerks durchaus.
Aber zurück zur Komposition der Fassade. Deren fünfgeschossiges Mittelstück erhebt sich über einem zweigeschossigen Sockel, der einige gestalterische Besonderheiten aufweist. So springt das EG mit Garagenzufahrt, Hauptportal und Nebeneingang ein wenig zurück, sodass hinter den vier exponierten Zackenbandstützen eine frei zugängliche Loggia entsteht, die den öffentlichen Raum erweitert und Eintretende vor Wind und Wetter schützt. Eine weitere Besonderheit ist das breite Gesimsband zwischen EG und 1. OG: Die Blende aus geflochtenen Kupferstreifen veredelt die Eingangszone und stellt ein Materialthema vor, dem sich Thomas Kröger in luftiger Höhe noch einmal mit großer Leidenschaft widmet. Die Rede ist von der kupfernen Dachlandschaft mit ihren horizontalen Lamellen, abgerundeten Fenstern und gaubenartigen Balkonen. Hinter den Fenstern liegen doppelgeschossige Penthousewohnungen – mit Blick über das Gärtnerplatzviertel auf der einen Seite und zur Isar auf der anderen.
Der Weg zu den Wohnungen im Vorderhaus führt zunächst in ein lang gestrecktes, etwas schummriges Foyer. Dort startet der Aufzug, der jeweils direkt vor den Wohnungstüren haltmacht. Eine Treppe gibt es natürlich auch. Aber sie windet sich in einem erstaunlich engen Gehäuse in die Höhe und dient wohl hauptsächlich als Fluchtweg. Vom Foyer gelangt man auch zu den Rückgebäuden, die sich um zwei Innenhöfe gruppieren. Den vorderen Patio überfängt eine Plattform mit riesigem, kreisrundem Ausschnitt. Ein Opäum? Jedenfalls verleiht das gelochte Dach dem Hofraum eine gewisse Grandezza und hat zudem einen doppelten Nutzen: Im Parterre schützt die Plattform vor Regen, und im 1. OG dienen Teile davon als Terrasse.
Stilgefühl und Ironie
Übrigens fallen auch in den Rückgebäuden die Treppenhäuser ziemlich klein aus. Auf Schritt und Tritt ist zu spüren, dass es bei der Bemessung der Wohnungsgrundrisse offenbar auf jeden Quadratzentimeter ankam. Aber warum man die beengten Erschließungswege ausgerechnet mit schwarzer Teppichware ausgelegt und dadurch visuell noch weiter geschrumpft hat, ist kaum erklärlich. Vielleicht war es einfach die billigere Lösung. Oder handelt es sich etwa um Retro-Pop? Sind es die psychedelischen Siebziger mit ihrer Liebe zum flauschigen Höhlenambiente, denen Thomas Kröger und Stefan Höglmaier hier ihre Reverenz erweisen? Der Gedanke lässt einen nicht so schnell los. Ihn im Hinterkopf, schaut man auch ganz anders auf das Zickzack-Dekor der Außenwände. Erinnert es nicht an die Op-Art-Bilder eines Victor Vasarely oder an die neugeometrischen Objekte eines Marcello Morandini? Betrachtet man das Gebäude durch diese Brille, wirkt es mit seinen doch recht verspielten Fassadenmodulen gar nicht mehr so sehr wie eine zeitgemäße Interpretation gründerzeitlicher Bürgerhäuser. Vielmehr stellt es sich dar als zeitgemäße Version postmoderner Architekturen. Auch in diesem Fall leitet das retrospektive Motiv die Gestaltung. Im Spiel ist aber nicht nur der Sinn für Stil, sondern auch der Wille zur Ironie – die bekanntlich nicht jedermanns Sache ist. Aber die Besitzer der teuren Apartments wird’s kaum tangieren, schließlich wohnen sie in Bestlage.db, Di., 2022.06.14
14. Juni 2022 Klaus Meyer