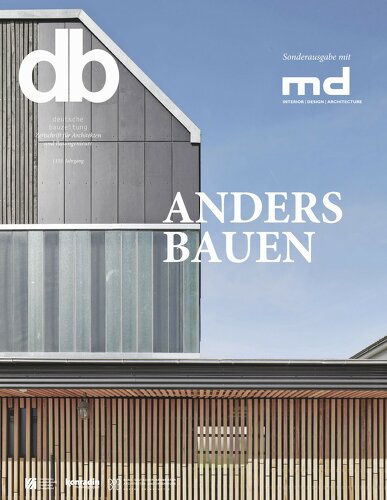Editorial
Umdenken, neu denken, gewohnte Bahnen verlassen, anders planen und anders bauen – wie das aussehen kann und wie es sich in konkreten Projekten, aber auch in Denk- und Forschungsansätzen widerspiegelt, das zeigen wir in dieser Sonderausgabe. Für unser Sommer-Sonderheft haben wir diesmal die Kolleginnen und Kollegen der Innenarchitektur-Fachzeitschrift md interior design architecture dazu geholt und für Sie Projekt-Beispiele aus unterschiedlichen Disziplinen und verschiedenen Ländern aufgespürt und zusammengestellt. Doch den Auftakt zum Heft bilden zunächst zehn Thesen zum Thema – entwickelt aus dem jüngst, ebenfalls mit der md veranstalteten eintägigen Zukunftskongress, mit dem wir zu »Mut zum Experiment« und eben zum anders Denken und Bauen aufgerufen haben.
Unser Titelbild zeigt ein Gebäude von CITYFÖRSTER architecture + urbanism, bei dem alle eingesetzten Materialien bereits einen Lebenszyklus durchlaufen haben. Nun muss »Anders Bauen« nicht immer gleich heißen, dass keinerlei neue Materialien zum Einsatz kommen, aber bei der Planung ‧intelligent, zurückhaltend und schonend mit Material und Fläche umzugehen, sollte stets das Ziel sein. Und so haben wir für diese Sonderausgabe – die unsere Reihe von Kongressen und Heften zum Thema »Anders Bauen. Suffizienz in der Baukultur« fortführt – Projekte (Neubauten und Umnutzungen) ausgewählt, die diesen Anspruch einlösen. Wohnmodelle, Arbeitswelten, Bürobauten, bei denen sich die Bauherren und Architekten vor Beginn des ‧Planungsprozesses fragten: Wie viel Raum benötigen wir wirklich und wie können wir diesen optimal nutzen und gestalten? Welche Funktionen können gemeinschaftlich organisiert werden, welche individuell? Und was lässt sich vom Bestand erhalten, was wird sinnvollerweise hinzugefügt? Gut nutzbare und genutzte Architektur, die darüber hinaus – wie das Recyclinghaus in Hannover – Diskussionsbeiträge sind und Denkanstöße liefern. Mit ergänzenden Fachbeiträgen zu Materialinnovationen und 3D-Gebäudedruck wollen wir auch mit diesem Heft wieder Mut zum Experiment machen! | Ulrike Kunkel
Weniger ist mehr
(SUBTITLE) Kleines Haus in Jonschwil (CH)
Ein nicht mehr benötigter Lagerschuppen hat eine neue Nutzung als Wohngebäude für vier Personen erhalten. Ein sich über drei Geschosse erstreckendes Wohnkontinuum lässt die räumliche Beschränkung vergessen. Neben dem geringen Flächenverbrauch basiert das architektonische Konzept auf der Wiederverwendung von Baustoffen und der Verwendung unbehandelter und demontierbarer Materialien.
Bescheiden wirkt das Haus auf einer kleinen Parzelle an einer Straßenecke in Jonschwil, einer Gemeinde mit knapp 4000 Einwohnern im Nordwesten des Kantons St. Gallen. Auffallen würde es im Kontext des Ortszentrums kaum, nur die helle, noch unverwitterte vertikale Holzlattung der Fassaden zeugt �davon, dass die Fertigstellung nicht allzu lange zurückliegt. Der minimale Dachüberstand, die präzise gesetzten Fensteröffnungen, die perfekt fassadenbündig sich einfügenden Fensterläden: All das sind untrügliche Zeichen architektonisch-gestalterischer Sorgfalt. Aber mit seinen zwei Vollgeschossen und dem traufständigen Satteldach passt sich das Gebäude in die von Einzelbauten geprägte Kernzone von Jonschwil ein, als hätte es schon immer dort gestanden. Was auch nicht ganz falsch ist, denn es handelt sich nicht um einen Neubau, sondern einen Umbau.
Transformation eines Schuppens
Denn das »Kleine Haus«, wie Architekt Lukas Lenherr es nennt, wurzelt in einer Remise, einem hölzernen Schuppen, in dem früher das Holz für die nahe gelegene Konditorei und das Gasthaus lagerte. 1988 wurden Betonwände und eine Decke zwischen EG und 1. OG eingezogen, um die mittlerweile windschiefe Konstruktion zu stabilisieren und damit vor dem Einsturz zu bewahren.
Schließlich entschieden sich die heutigen Eigentümer – ein Paar mit zwei �Kindern –, den nicht mehr benötigten Wirtschaftsbau in ein Wohnhaus umzubauen. Dabei blieb so viel wie möglich von der bestehenden Substanz erhalten: um die Kosten möglichst niedrig zu halten, aber auch, um ein Zeichen zu setzen gegen den Verschleiß von weiter nutzbaren Ressourcen. Das – nun grundsanierte – Volumen entspricht dem des Altbaus; eine Veränderung hätte der Ortsbildschutz ohnehin nicht zugelassen.
Erhalten werden konnte das Tragwerk des nach traditioneller Technik in Fachwerkbauweise erhaltenen Gebäudes samt der als Sprengwerk ausgeführten Dachkonstruktion; die bestehenden Elemente wurden lediglich sandgestrahlt und konnten dann wiederverwendet werden, wobei Teile der einstigen äußeren Holzbekleidung nunmehr als Innenbekleidung eingesetzt sind. Erhalten blieb überdies der gut 20 Jahre alte Betoneinbau, in den allerdings verschiedene Öffnungen geschnitten wurden. Markant ist insbesondere der fünfeckige Deckendurchbruch, der nicht nur Platz für die Treppe lässt, sondern darüber hinaus auch der Belichtung des EGs dient – und den Sichtverbindungen zwischen den Geschossen. Die Größe des Durchbruchs erzwang eine Verstärkung der verbliebenen Deckenplatte, die mittels CFK-Lamellen erfolgte. Diese mit Epoxidkleber gebundenen Kohlefaserbündel erlaubten es, auf Unterzüge oder Stützen zu verzichten. In der Deckenuntersicht treten sie als schwarze Lineaturen in Erscheinung. Ganz bewusst, denn Auftraggeberschaft und Architekt verfolgten das Konzept, die verschiedenen Materialien sichtbar zu lassen, nach Möglichkeit aber auch später wieder trennen und demontieren zu können. Dies implizierte den weitgehenden Verzicht auf hybride Baustoffe: Die verwendeten Elemente sind weitestgehend naturbelassen und im Idealfall nur verschraubt, sodass sie später demontierbar bleiben und anderenorts wiederverwendet werden können. Auch die Biberschwanzziegel des Dachs wurden erneut eingesetzt, mussten angesichts der neuen Doppeldeckung aber durch neues Material ergänzt werden. Die Küchengeräte stammen von der Bauteilbörse und wurden in einen Unterbau aus Birkensperrholz eingesetzt.
Flexibler und offener Wohnparcours
So schlicht das Volumen von außen auch erscheint, die große Qualität des Umbaus manifestiert sich im Innern. Die Wohnräume folgen keiner traditionellen Zimmeraufteilung, sondern zeigen sich wie eine drei Geschosse übergreifende, fließende Raumlandschaft. Um den Platz im Innern möglichst effizient zu nutzen, unterbleibt die klassische Trennung von bedienten und �dienenden Räumen, also von Wohnräumen, Korridor oder Erschließungszonen. Letztere existieren hier nicht – wer sich durch die Geschosse bewegt, nutzt den skulptural anmutenden, hinsichtlich seiner funktionalen Determiniertheit flexiblen Wohnparcours, der im Küchen- und Essbereich beginnt, sich auf der Betonplattform im 1. OG fortsetzt und schließlich im partiell eingebauten DG endet. Die vielen Durchbrüche und -blicke zwischen den Geschossen, bei denen Netze als Absturzsiche�rungen dienen, erzeugen eine trotz der geringen Größe des Hauses erstaunliche Großzügigkeit, angesichts derer Lukas Lenherr nicht zu Unrecht auf die Raumkonzepte japanischer Kleinhäuser verweist. Reizvoll ist die Tatsache, dass die Fachwerkkonstruktion, die von der Geschichte des Gebäudes erzählt, im Innern sichtbar ist und damit zum wirkungsbestimmenden Faktor wird.
Weniger Flächenverbrauch pro Kopf
Für die Fassade wählte Lenherr Lärchenholz, die Dämmung besteht aus Holzfasern und Schafwolle, die Fenster sind in unbehandeltem Föhrenholz ausgeführt. Die Bodenheizung im einfach geschliffenen Estrich – im OG befindet sich ein einfacher Brettschichtboden – ist an einen Holzofen angeschlossen. Die Verwendung einfacher, unbehandelter Materialien folgt dem Gebot baubiologischer Korrektheit, erzeugt aber auch eine angenehme Raumatmosphäre.
Das Projekt überzeugt in nachhaltiger Hinsicht aber nicht nur durch die Wiederverwendung von Baustoffen und den Einsatz unbehandelter und demontierbarer Materialien, sondern v. a. durch seine räumliche Bescheidenheit. Laut dem Bundesamt für Statistik beträgt die Wohnfläche pro Kopf in der Schweiz durchschnittlich 46 m². Hier aber lebt eine vierköpfige Familie auf 99 m², auch wenn die geschickte Raumorganisation nirgends das Gefühl räumlicher Enge entstehen lässt. Gewisse Beschränkungen waren aber in Kauf zu nehmen: Ein Keller beispielsweise existiert aufgrund des hohen Grundwasserspiegels nicht, und auch die Abstände zu den Nachbargrundstücken sind nicht gerade großzügig. Aber immerhin bot die Auflösung des Parkplatzes Raum für einen kleinen Gemüsegarten – und da das Haus klein ist, konnte die gesamte Haustechnik in einem Schrank im Waschraum untergebracht werden.
Die Klarheit der schlichten Fassaden, bei der auf Vorsprünge und Außenräume verzichtet wurde, lässt das nunmehr domestizierte frühere Wirtschaftsgebäude noch anklingen.db, Di., 2021.07.06
06. Juli 2021 Hubertus Adam
Die Baugruppe von Bullerbü
(SUBTITLE) Baugruppenprojekt B.R.O.T. in Pressbaum (A)
Das Gemeinschaftswohnprojekt B.R.O.T. in Pressbaum ist eines der auf den ersten Blick unscheinbarsten und bei näherer Betrachtung wohl schönsten Baugruppen-Projekte Österreichs. Das Wiener Büro nonconform zimmerte ein nachhaltiges Dorf aus zehn vorgefertigten Holzhäusern.
Die Kleinen laufen nackt durch die Botanik und richten wassergefüllte Spritzpistolen aufeinander. Fangenspielen, Räuber und Gendarm, Käferbegutachtungen auf der ausgebreiteten Handfläche. »Spinnst du? Das ist doch kein Marienkäfer! Der ist ja nicht mal rot!« – »Oh ja, die sind nicht alle rot! Du hast ja keine Ahnung …« Die ersten Minuten vor Ort fühlen sich an, als wäre man in eine Zeitmaschine ein- und in irgendeiner smartphone- und applosen Parallelwelt wieder ausgestiegen. Wie ein Wald- und Wiesenspaziergang durch Bullerbü, mit Pippi Langstrumpf , Tommy und Annika an der Hand.
»Die meisten von uns kommen aus Wien und haben sich nach einem ruhigen, nachhaltigen Leben mit geringem CO2-Fußabdruck gesehnt«, sagt Johanna Leutgöb. »Es gibt sehr viele Kinder, sehr viel Natur und auch ein gewisses Bewusstsein für die Gestaltung des Wohn- und Lebensalltags, das uns alle verbindet. Und trotzdem wohnen hier ganz viele unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen beruflichen Backgrounds mit unterschiedlichen Lebensvorstellungen.« Johanna, 64 Jahre alt, ist Coach und Organisationsberaterin und lebt hier gemeinsam mit ihrem Partner Peter, seines Zeichens Landschaftsplaner und Landschaftsökologe. Er steht gerade in der Küche und mischt den Teig für Rosinenbrot und gebackene Mäuse.
»Mit 22 Jahren bin ich in mein erstes ökotopisches Wohnprojekt eingezogen, und ich würde sagen, mit Baugruppen und gemeinschaftlichen Wohnmodellen mit all ihren Vor- und Nachteilen kenne ich mich mittlerweile ziemlich gut aus«, so Johanna. »Viele Fehler, die man zu Beginn macht, haben wir hier versucht zu vermeiden.« Soziale Homogenität sucht man vergeblich. Die Bewohnerinnen und Bewohner stammen aus mehreren Generationen, Einkommensschichten und kulturellen Backgrounds. Es wurde sogar eine Crowd�funding-Kampagne gemacht, um einer jungen Flüchtlingsfamilie aus Afghanistan eine 50 m² große Wohnung zur Verfügung zu stellen. Mehr als 40 000 € konnten auf diese Weise zusammengetragen werden.
All diese Wärme und Lebendigkeit dieses ungewöhnlichen Projekts scheint in der niederösterreichischen Frühlingsluft zu liegen, sobald man zwischen den vorgefertigten Holzhäusern durchmarschiert und hinter den großen, ungemähten Flockenblumen, Schafgarben und Kamillen in den Fenstern das soziale Durcheinander beobachtet. Die Initiative geht zurück auf Helmuth Schattovits (1939-2015), der bereits in den 90er Jahren in Wien das erste Wohnprojekt unter der Dachmarke B.R.O.T. errichtete. Hinter dem etwas eigenwillig kohlehydrathaltigen Akronym verbergen sich die Worte und Werte »Begegnen, Reden, Offensein, Teilen«.
Nach mehreren Wohnprojekten dieser Art innerhalb der Wiener Stadtgrenzen stieß Schattovits 2011 durch Zufall auf dieses Grundstück am Haitzawinkel, 20 km westlich von Wien, das von der Pfarre Pressbaum zur Bebauung im Baurecht angeboten wurde. B.R.O.T. griff zu und sicherte sich das Areal für 99 Jahre. Eine weitere Fügung sorgte dafür, dass Schattovits bei einer Straßenbahnfahrt auf Architekt Peter Nageler, Partner im Wiener Architekturbüro nonconform, stieß, und so nahm das Projekt seinen Lauf. Einreichplanung 2015, Spatenstich 2017, Fertigstellung 2018. Jetzt stehen wir also da, die Rotzlöffel und ich, die Spritzpistole auf den Journalisten gerichtet. »Wer bist du? Was machst du da?«
Aufgeteilt ist das ursprünglich 14 000 m² große Hanggrundstück, das von der höchsten bis zur tiefsten Stelle um rund 10 m abfällt, auf elf Parzellen mit insgesamt zehn Wohnhäusern und einem Gemeinschaftshaus im Zentrum. Außerdem gibt es einen Sportplatz und eine E-Ladestation im Süden sowie Spielplatz, Schwimmteich, Gewächshaus, Parkplatz und in den Hang eingegrabene Stauraumboxen im nördlichen Teil des Areals. Einer der Bewohner betreibt sogar eine Bienenfarm mit etlichen Stöcken. Aktuell wird ein Haus der Stille errichtet. Das Fundament steht schon.
»Partizipationsprojekte haben wir schon viele gemacht, aber in diesem Fall war der Prozess besonders reibungslos und unkompliziert«, sagt Johanna Steinhäusler, Projektleiterin bei nonconform. »Die Baugruppe zeichnete sich von Anfang an durch ein hohes Engagement aus – und durch eine gewisse Sturheit, weil sie auf manche Dinge auf keinen Fall verzichten wollte. Der starke gemeinschaftliche Zusammenhalt funktioniert bis heute.« Zu den unumstößlichen Entscheidungen der Gruppe zählen v. a. Bauweise und Haustechnik. Bis auf das Gemeinschaftshaus und die Treppenhauskerne, die in Stahlbeton errichtet wurden, handelt es sich beim gesamten Projekt um Holzleichtbau mit kreuzlagenverleimten Deckenplatten.
Die vorgefertigten Fassadenelemente sind geschoßhoch und bis zu 8 m lang und bestehen aus einer Fichtenkonstruktion mit vertikaler Lärchenlattung und innen liegender, eingeblasener Zellulosedämmung mit 30 cm Dicke. Innenbeplankung und nichttragende Wände sind ganz klassisch im Trockenleichtbau errichtet worden. Auffällig ist die Raumhöhe von 2,70 m in den Wohnräumen sowie die KLH-Decke mit belassener Sichtoberfläche in den Aufenthaltsräumen. Die meisten Bewohner haben eine unbehandelte Deckenuntersicht, einige wenige haben das Holz eingeölt oder lackiert. Lediglich in den Vorzimmern sowie in den Sanitärräumen wurde eine abgehängte Gipskartondecke eingezogen. In den Hohlräumen befindet sich die Installation für die kontrollierte Wohnraumlüftung.
»Ein großes Anliegen«, sagt Architektin Steinhäusler, »war uns die Positionierung der Fenster und Fenstertüren. Wo immer dies mit Rücksicht auf die Möblierung möglich war, haben wir die Fensteröffnungen ganz in die Ecke gerückt. Durch den flächenbündigen Anschluss an die angrenzende Innenwand ergibt sich auf der Oberfläche ein sehr schönes Licht- und Schattenspiel. Zudem sorgt das flach einfallende Streulicht durch die Reflexion für zusätzliche Helligkeit in den Innenräumen.« Sämtliche Fenster – auch jene in den OGs – sind französisch ausgeführt und verlaufen fast bis zum Boden. Die Absturzsicherung besteht aus verzinkten Stabgeländern. Sehr easy, sehr rough, sehr passend zum hier innewohnenden Geist.
Geheizt wird mit Biomasse. Neben dem Gemeinschaftshaus wurde eine kleine Hackschnitzelanlage errichtet, die mit Holzabfällen aus dem lokalen Maschinenring gespeist wird. Zudem wurden auf den Gebäuden 50 m² Sonnenkollektoren mit 4 000 l Pufferspeicher sowie sechs PV-Anlagen im Gesamtausmaß von 97 kW Peak-Nennleistung angebracht. Übers Jahr gerechnet können damit rund 75 % des Strombedarfs gedeckt werden. Kleiner Wermutstropfen: Während der Großteil des Wohnprojekts aussieht wie eine Mischung aus Bullerbü und Biene Majas Klatschmohnwiese mit einem Hauch Woodstock, dominiert auf der Technikzentrale mit ihren schräg aufgeklappten Kollektorflächen der Eindruck eines etwas aus den Fugen geratenen Sonnenkraftwerks. Der visuelle Schmerz ist verkraftbar.
Umso schöner die Tatsache, dass sich die Baugruppe vom Kärntner Holzproduzenten Weissenseer, der sich auf dem innovativen Holzbausektor mittlerweile einen über die Branche hinaus bekannten Namen gemacht hat, die Holz- und KLH-Reststücke hat anliefern lassen. Einige davon fristen nun ein Dasein als Klettergerüst oder Küchenarbeitsplatte im Gemeinschaftshaus. Neben der Werkstatttür lehnt ein unförmiges Holzstück mit etwa 1,50 m Länge. Mit Bleistift hat jemand die Absichtserklärung auf die Oberfläche geschrieben: »Reserviert Rutsche!!!«
»Wir wohnen hier jetzt seit über drei Jahren«, sagt Stefan Fittner, Kassier der Vereins B.R.O.T. Pressbaum. »Über eine eigens eingerichtete Signal-Gruppe stehen wir permanent in Kontakt. Wer auch immer etwas braucht, ob das nun Hilfe in der Werkstatt oder Unterstützung in der Food-Coop ist, schreibt einfach eine kurze Nachricht in die Gruppe.« Und Anita Scharl, die beruflich in der Umweltanwaltschaft tätig ist und den Verein eine Zeit lang als Pressesprecherin repräsentierte, freut sich v. a. über das gute Raumklima in den Wohnungen und über das insgesamt gute Preis-Leistungs-Verhältnis des Projekts. »Es gab viele Aufs und Abs mit der Kirche, mit den Kreditvereinbarungen, mit den Kostenangeboten bei den Baufirmen, aber letztendlich ist das Projekt verhältnismäßig gut über die Bühne gegangen. Es ist super, hier zu wohnen.«
Auf ihrer Terrasse wird gerade eine Pergola errichtet. Der Bruder, Zimmermann von Beruf, ist zur Stelle, die Mutter zupft das Unkraut aus den Gemüsebeeten, der 80-jährige Vater, der dem Autor dieses Artikels schnell noch einen Crash-Kurs im Sensenmähen gibt, kümmert sich um das viel zu hohe Gras auf der Böschung zwischen Wohnhaus und Sportplatz. »Es ist nicht immer alles so harmonisch wie heute«, sagt Anita. »Aber fast immer. Ich mein’, schau dich mal um! Ich persönlich hätte mir zwar ein klassisches Satteldach gewünscht, aber in diesem Punkt bin ich halt von der Baugruppe und den Architekten überstimmt worden. Abgesehen davon ist unser kleines Dorf hier einfach nur großartig.«db, Di., 2021.07.06
06. Juli 2021 Wojciech Czaja